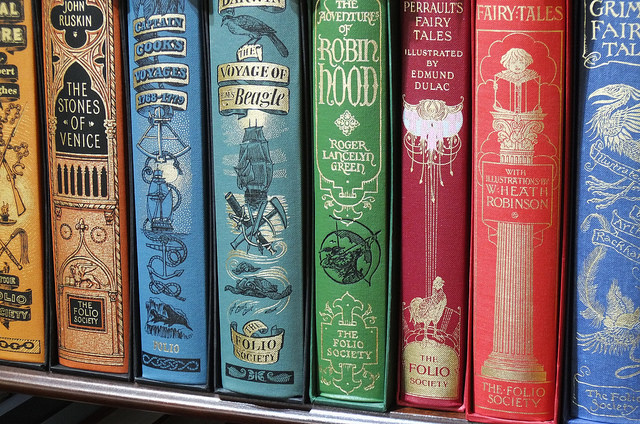Inhaltsverzeichnis
Fundstücke
- Beeindruckender Bericht von einer 70jährigen, die mit ihrer Familie Auschwitz besuchte.
- Wie Kohl die Welt sieht
- Nazi-Versteck im Dschungel Argentiniens entdeckt. Die Typen waren selbst auf der Flucht besessen von megalomanischen, völlig unpraktischen Lösungen.
- Türkische Geschichtsbücher sind ein gutes Beispiel dafür, warum ein halbwegs ideologiefreier Geschichtsunterricht wichtig ist.
Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2015/05/fundstucke.html
SZ zu den ersten Suchmaschinen
Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022427047/
Das Bild des Krieges im Objektiv des deutschen Soldaten, Karl Lutz
Wir danken Prof. Dr. habil. Krzysztof Ruchniewicz – Direktor und Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte am Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien der Universität Breslau sehr herzlich für diesen Gastbeitrag!
Jeder von uns, der eine neue Veröffentlichung vorbereitet, will in der Regel – sofern es die Möglichkeit gibt – Illustrationen einsetzten, die bisher wenig bekannt sind. Zurzeit beobachten wir ein interessantes Phänomen. Das Verschwinden der Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts, vor allem solcher des Zweiten Weltkrieges, hat zur Folge, dass immer mehr Nachlässe von ihnen an Archive übergeben werden. Manchmal wollen die Enkelkinder einfach nur das Problem und den Kram der Großeltern loswerden, manchmal aber sehen sie darin auch die Möglichkeit, die wertvollen Sammlungen zu schützen und zu popularisieren.
[...]
Die triumphale Gedenkkultur des 9. Mai und die Leerstellen der Erinnerung in Deutschland
Die Feiern zum 9. Mai werden sich in Berlin auch in diesem Jahr an Orten abspielen, die von der sowjetischen Gedenkkultur geprägt wurden, wie zum Beispiel dem Treptower Park und dem Ehrenmal am Brandenburger Tor. Die Gedenk-Ensemble sind durch internationale Verträge zwischen Deutschland und Russland geschützt, dennoch entzündet sich immer wieder Kritik an der Formsprache der Denkmäler. Vor einem Jahr, am 15.4.2014, titelte die BILD-Zeitung gar: „Russen-Panzer als Symbol kalter Machtpolitik!“ und initiierte zusammen mit der B.Z. eine Petition zur Entfernung der zwei T-34 Panzer, die das 1945 errichtete Denkmal zur Erinnerung an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg flankieren. „In einer Zeit, in der russische Panzer das freie, demokratische Europa bedrohen, wollen wir keine Russen-Panzer am Brandenburger Tor!
[...]
Conference “Scientific Computing and Computational Humanities” in Heidelberg
================================================================
5nd Conference “Scientific Computing and Computational Humanities”
SCCH 2015
November 23rd-25th 2015, IWH, Heidelberg, Germany
http://scch2015.wordpress.com/
================================================================
**************************SPREAD THE WORD *****************************
Dear Colleagues,
IWR (Interdisciplinary Research Centre for Scientific Computing) and the Heidelberg University in collaboration with the Heidelberg Academy of Sciences and Humanities are organizing the fifth conference on topics of computational and mathematical methods with applications to the humanities.
Traditionally, the conference is scheduled in autumn: Nov 23rd-25th 2015. The conference is planned to synch with some local satellite workshops. More details will be published on the web site:
[...]
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=5014
Neue Rezensionen: H-Soz-Kult
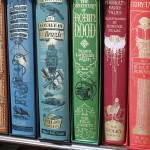
In den letzten Wochen sind interessante Bücher aus dem Bereich der historischen Bildforschung auf H-Soz-Kult rezensiert worden. Wir stellen einige davon auf Visual History vor.
Loretana de Libero, Rache und Triumph. Krieg, Gefühle und Gedenken in der Moderne
De Gruyter Oldenbourg, München 2014
rezensiert von Manfred Hettling, redaktionell betreut durch Jan-Holger Kirsch
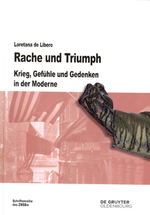 Loretana de Libero, Althistorikerin, untersucht in ihrer materialreichen Studie deutsche Kriegerdenkmäler nach 1918 und ergänzt ihre Arbeit mit punktuellen Ausblicken auf andere Länder. Ihr besonderes Interesse gilt der Darstellung des Feindes auf den Denkmälern. Seien es Figuren, Symbole, Allegorien, Embleme, Waffen, sprachliche Formeln – die Verweise auf den Kriegsgegner sind vielfältig.
Loretana de Libero, Althistorikerin, untersucht in ihrer materialreichen Studie deutsche Kriegerdenkmäler nach 1918 und ergänzt ihre Arbeit mit punktuellen Ausblicken auf andere Länder. Ihr besonderes Interesse gilt der Darstellung des Feindes auf den Denkmälern. Seien es Figuren, Symbole, Allegorien, Embleme, Waffen, sprachliche Formeln – die Verweise auf den Kriegsgegner sind vielfältig.
[...]
Quelle: https://www.visual-history.de/2015/05/04/neue-rezensionen-h-soz-kult-2/
Befreiung? Sieg? Niederlage? Interviews zum Kriegsende (1): Frankreich
Im Rahmen des 70. Jahrestags des Kriegsendes in Europa eröffnet die Max Weber Stiftung einen Einblick in die Erinnerungskultur der Gastländer ihrer Institute. Neben einer Auseinandersetzung mit dem Gedenken an 1945 geben wir auch einen kurzen Einblick in die jeweiligen Forschungstendenzen zum Zweiten Weltkrieg. Den Anfang macht Stefan Martens, Stellvertretender Direktor des Deutschen Historischen Institut in Paris. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der Weimarer Republik, des Dritten Reiches und des Widerstandes, die Geschichte der französischen Dritten Republik und des Vichy-Regime sowie die Geschichte der Internationalen Beziehungen.
Herr Martens, wie wichtig ist der 8.
[...]
Quelle: http://mws.hypotheses.org/26843
Luxemburg: Schwerpunktnummer zu Prekarität
Zu finden und downzuloaden unter: http://www.rosalux.de/publication/41412
Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022426844/
Die Notwendigkeit von und Kritik an Identität am Beispiel feministischer/ frauen*spezifischer Sammel-, Speicher- und Dokumentationseinrichtungen in Österreich
Ein Gastbeitrag von Ulrike Koch, Wien
Transparente, Buttons, wissenschaftliche Werke, Plakate und gesellschaftspolitische Analysen sind alle Ausdruck einer lebhaften (queer-)feministischen Wissensproduktion, die in feministischen/frauen*spezifischen Sammel-, Speicher- und Dokumentationseinrichtungen gesammelt werden. Entstanden sind diese Einrichtungen aus der Kritik an „klassischen“ Bibliotheken und Archiven sowie der dort durch Machtmechanismen strukturierten Ausschlussmechanismen. Die Einrichtungen wenden sich dabei nicht nur gegen diese Diskriminierungen, sondern sammeln auch als Gegenort den Gegendiskurs, stellen diesen interessierten Personen zur Verfügung und ermöglichen durch das vorhandene Wissen neues Wissen zu generieren und dieses für die eigene Lebensgestaltung zu nutzen.
Anhand von feministischen/frauen*spezifischen Archiven und Bibliotheken in Österreich demonstriert der Artikel die Bedingungen, Potentiale aber auch Kritikpunkte an diesen Einrichtungen. Im Fokus stehen dabei die Abteilung Ariadne der Österreichischen Nationalbibliothek, das STICHWORT – Frauen- und Lesbenarchiv, die Bibliothek der Frauensolidarität, die alle drei in Wien angesiedelt sind, die Bibliothek des Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft in Innsbruck, die Sammlung Frauennachlässe an der Universität Wien sowie die inzwischen nicht mehr zugänglichen Einrichtungen des DOKU Graz sowie des Violetta Lesbenarchivs in Graz.
Der Fokus des Artikels liegt auf den drei Achsen Zeit, Raum und Identität. Unter der Achse Zeit steht die historische Dimension im Mittelpunkt, denn die in den Archiven und Bibliotheken gespeicherten Materialien ermöglichen die Entwicklung der Bewegung nachzuvollziehen, stellen Vorbilder zur Verfügung und bieten damit Identifikations- aber auch Abgrenzungspotential.
[...]