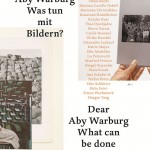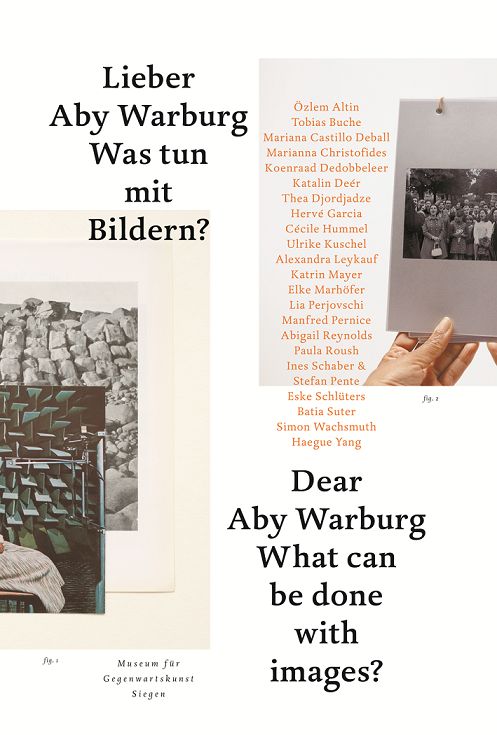Tagungsbericht von Christian Griesinger (Trier Center for Digital Humanities)
Die 15. internationale Tagung der „Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition“ fand vom 19. bis 22. Februar 2014 an der Universität Aachen statt. In ca. 50 Vorträgen aus den Bereichen der Älteren und Neueren Germanistik, der Musikwissenschaft, Philosophie, Geschichte, Hochschuldidaktik und dem Verlagswesen wurden nicht nur verschiedene Aspekte des Tagungsmottos „Vom Nutzen der Editionen“ beleuchtet, sondern auch aktuelle Editionsvorhaben unter Berücksichtigung des zu erwartenden Nutzens vorgestellt. Die Tagung wurde aufgrund des großen Themenangebots in Plenarvorträge und mehrere parallel zueinander verlaufende Sektionen unterteilt. Daher kann der Tagungsbericht eines einzelnen Berichterstatters nicht alle Vorträge und diskutierten Themen darstellen, sondern muss sich auf eine subjektive Auswahl einzelner Referate sowie übergreifender Tendenzen beschränken – für weiterführende Lektüre sei auf den geplanten Tagungsband verwiesen.
Aspekt Digitale Edition, Visualisierung und Vernetzung
Viele Vorträge der Tagung bestätigten den sich fortsetzenden Trend von der analogen zur digitalen (Hybrid-)Edition. In vielen Fällen kommt nun die Auszeichnungssprache XML in Verbindung mit den Richtlinien der TEI für die Kodierung der Texte zum Einsatz. Die Projektvorhaben umfassen häufig neben einer Druckausgabe zusätzlich eine webbasierte Publikation der Edition und stellen viele ihrer Materialien auf den Projekthomepages zur Verfügung.
So stellte beispielsweise Jakub Šimek die laufende Neuedition des Welschen Gastes Thomasins von Zerklære‘ vor, die seit 2011 in Heidelberg erarbeitet wird. Diese Ausgabe wird eine diplomatische Transkription aller erhaltenen Textzeugen sowie eine Bilddatenbank mit sämtlichen Bilderzyklen enthalten, so dass eine reine Druckfassung schon wegen des Umfangs nicht praktikabel erscheint. Für die Rezipierbarkeit und Verbreitung der Edition ist eine Druckversion des nach dem Leithandschriftenprinzip kritisch edierten Textes geplant, während die diplomatischen Texte der Onlineversion vorbehalten sind. Ein weiterer Fokus der Onlineversion soll auf der Visualisierung des Variantenapparates liegen: Die chronologische Distribution der verschiedenen Lesarten zu einer Textstelle soll sich der Benutzer auf einer Zeitleiste darstellen können, die diatopische Distribution der Überlieferungsträger auf einer elektronischen Landkarte. Das Projekt ist zudem bemüht, die Editionstexte mit dem in Trier digitalisierten und gepflegten „Wörterbuchnetz“ und nach Möglichkeit auch mit dem neuen „Mittelhochdeutschen Wörterbuch“ durch das Verfahren der Lemmatisierung zu verknüpfen.
Die laufenden Unternehmen zu Briefeditionen – wie das von Vera Hildenbrandt und Roland Kamzelak vorgestellte Projekt „Vernetzte Korrespondenzen“ – beschäftigen sich ebenfalls intensiv mit Visualisierungsverfahren, um soziale Netzwerke der Briefschreiber und ihre Themen und Inhalte graphisch ansprechend darzustellen. Auch hier werden Inhalte, zum Beispiel Personen und Orte, mit einem Referenzwerk, der Gemeinsamen Normdatei (GND), verlinkt.
Es zeigt sich demnach, dass Editionen nicht mehr als für sich stehende Werke begriffen werden, sondern in einen übergeordneten Forschungskontext eingeordnet und an verschiedene Standards der Kodierung und Vernetzung angepasst werden. Die Verweise auf die lexikographischen Werke oder die Datenbanksysteme der Normdaten, die nur im elektronischen Medium ihr volles Potenzial ausschöpfen können, ermöglichen editionsübergreifende Fragestellungen und erleichtern sowohl den Datenaustausch als auch die Weiternutzung der Editionen in anderen Kontexten. Mit der wachsenden Komplexität der erarbeiteten Editionen steigt allerdings auch das Bedürfnis der Editoren wie auch der Editionsbenutzer, die Sachverhalte visuell darzustellen.
Leider spielte die einstmals engen fachlichen Verbindung von Editionswissenschaft, Wörterbuch- und Grammatikschreibung auf der Tagung nur eine Nebenrolle. Es wäre wünschenswert, die wechselseitige Nutzung von Editionen in den Wörterbücher- und Grammatikvorhaben wie auch die Nutzung der Lexika und Grammatiken in den Editionsprojekten stärker zu beleuchten.
Aspekt Benutzung historisch-kritischer Ausgaben in der Wissenschaft
Bislang fehlt es an Studien zur Benutzungssituation von Editionen im Wissenschaftsbetrieb. In der Neugermanistik liegen zwar mittlerweile für viele moderne Autoren Historisch-Kritische Ausgaben (HKA) ihrer Werke vor, die sich vornehmlich an wissenschaftliche Nutzer richten, inwiefern sie jedoch benutzt werden, wurde bislang nicht untersucht. Um die Akzeptanz, Verbreitung und Benutzung dieser Editionen zu untersuchen, wertete Rüdiger Nutt-Kofoth hierzu die Jahrgänge 2000–2013 wichtiger Publikationsorgane wie ZfdPh, Euphorion und DVjs aus. In ca. 540 Aufsätzen mit einem Umfang von ca. 29.000 Seiten betrachtete er, welche Textausgaben und welche Teile der Editionen zitiert wurden.
Das Ergebnis war wenig schmeichelhaft, denn in etwa 60% der Fälle wurden die maßgeblichen kritischen Editionen nicht konsultiert, sondern auf andere oder ältere Ausgaben zurückgegriffen. In den 40% Prozent der Fälle, in denen die HKA als Textgrundlage genommen wurden, zitierten die Autoren der Beiträge zu etwa 90% den edierten Haupttext, die Erläuterungen der Ausgaben wurden nur in 10% und die Textvarianten in lediglich 5% der Fälle zitiert. Es scheint damit, dass gerade der aufwendigste Teil einer HKA, der kritische Apparat, am wenigsten berücksichtigt wird. Auch die seltene Verwendung der Erläuterungen, Einleitungen und Vorworte gibt Rätsel auf.
Als mögliche Ursachen für dieses ernüchternde Ergebnis wurde zum einen ein mangelndes Bewusstsein für wissenschaftliche Standards genannt, zum anderen wurde angeführt, dass in vielen Fällen die zumeist teuren und in nur geringen Auflagen publizierten HKA nicht immer zur Verfügung stehen und dann aus Zeitgründen oder Bequemlichkeit auf Taschenausgaben oder verbreitete Einzelausgaben zurückgegriffen werde. Zum dritten wurde auf die Komplexität der HKA hingewiesen, deren teils kryptische Apparate nicht zu einer näheren Beschäftigung einladen. Fest steht jedenfalls, dass diese erste quantitative Erhebung nur der Beginn einer selbstkritischen Untersuchung des wissenschaftlichen Umgangs mit Editionen in der Germanistik sein kann.
Aspekt Edition und Didaxe
In verschiedenen Vorträgen wurde über den Einsatz von Editionen in der Hochschuldidaktik und als Lektüregrundlage in Schulen berichtet. Burghard Dedner erläuterte, wie er anhand des Woyzeck von Georg Büchner Schulklassen textkritische und editorische Fragestellungen nähert bringt. Sehr häufig kämen in Schulklassen veraltete Ausgaben oder von Lehrern selbst erstellte Lernmaterialien zum Einsatz, die dem fragmentarisch erhaltenen Text eine vermeintlich geschlossene Gestalt geben oder Forschungsergebnisse zur Datierung einzelner Textschichten ignorieren. So wird den Schülern zum einen ein falsches Bild von der Genese des Textes vermittelt, zum anderen die Interpretation durch den Willen des Lehrer gelenkt. Die Konfrontation mit im Unterricht nicht benutzen Ausgaben, die den Schülern die Unfestigkeit des Textes vor Augen führen, eignet sich besonders zur Sensibilisierung für textkritische Fragen.
Florian Radvan zeigte anhand didaktischer Modelle und einer statistischen Auswertung verschiedener, in Schulen zur Anwendung kommender Textausgaben, dass die auf Schulen spezialisierten Verlage bei der Vermittlung von Primärliteratur in unterschiedlichem Maße Wort- und Sacherläuterungen in ihre Texte einbauen, aber keineswegs immer ihre Textgrundlage von den maßgeblichen kritischen Ausgaben beziehen.
Den Einsatz der neuen, 15. Auflage von ‚Walthers von der Vogelweide‘ Leich, Liedern und Sangsprüchen (ed. Thomas Bein) in universitären Proseminaren erläuterte Dörte Meeßen. Da diese Auflage viele Strophen ‚Walters‘ in mehreren Fassungen bietet, können an ihr Merkmale der handschriftlichen Textüberlieferung des Mittelalters und die damit verbundenen Fassungsprobleme den Studenten nahe gebracht werden. Darüber hinaus können verschiedene Interpretationsansätze auf den Text angewendet werden, die bei der Darstellung nur einer Fassung verborgen blieben. Allerdings wurde auch in diesem Fall auf die engen Grenzen der Druckfassungen hingewiesen, die die Überlieferung nicht in ihrer gesamten Breite berücksichtigen können. Um die große Varianz der Strophen innerhalb eines Tones darstellbar zu machen, braucht man digitale Werkzeuge und Analyseverfahren.
Fazit
Die Tagung „Von Nutzen der Editionen“ zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass sie ein großes Spektrum an Themen und Fachrichtungen berücksichtigte. Auch wenn in der Editionswissenschaft viele unvereinbare editorische Grundsätze nebeneinander existieren und Fragen wie Normalisierung, Apparataufbau, Darstellung der Textgenese und gar die editorische Terminologie heftig umstritten sind, wurde in allen Diskussionsrunden, denen der Berichterstatter beiwohnen konnte, sachlich diskutiert und durchaus auch wissenschaftskritische Positionen bezogen. Dadurch und weil neben Editoren auch Nutzer von Editionen und Verlagsvertreter in Plenarvorträgen ihre Sichtweise und Erfahrungen im Umgang mit Editionen und deren Vertrieb darstellen konnten, war es möglich, Anregungen, Wünsche und Kritik in laufende Editionsvorhaben zu tragen und die Forschungsdiskussion zu bereichern.
Quelle: http://scriptorium.hypotheses.org/364