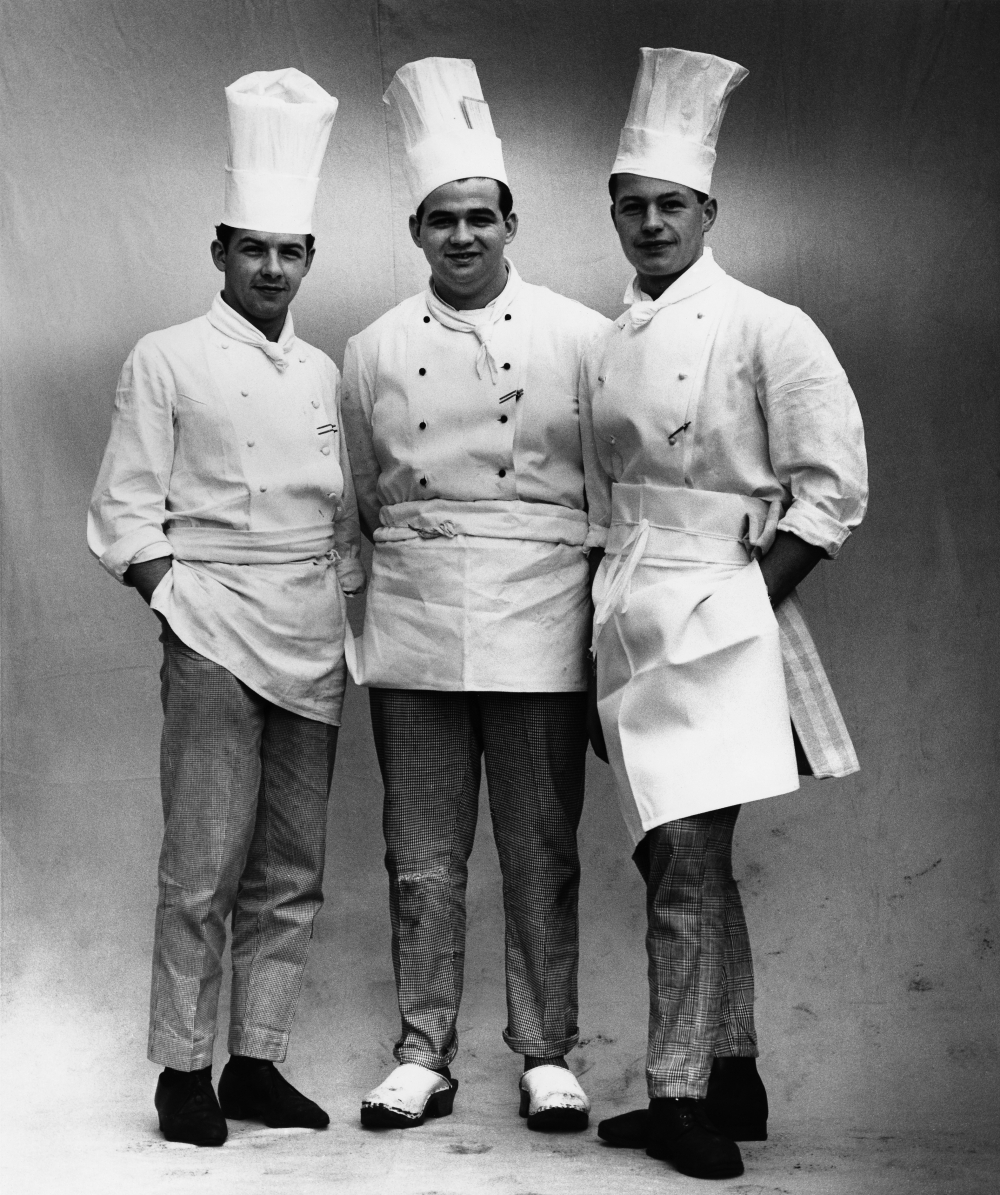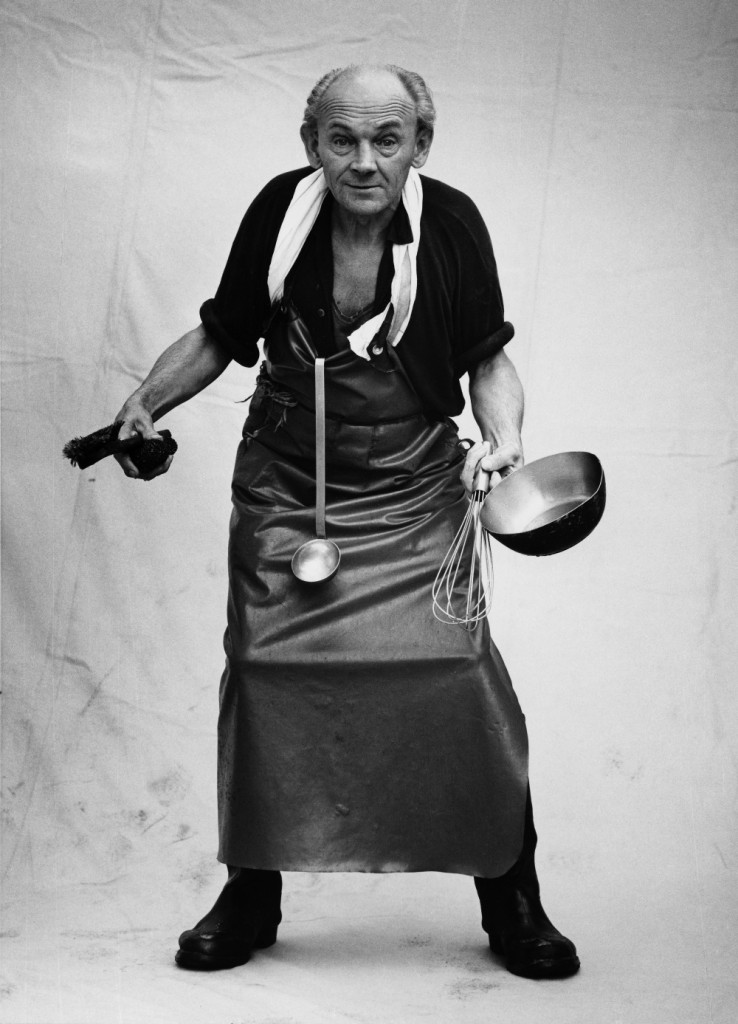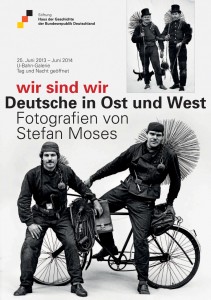[1] Wenn sich 2014 das Erscheinen von Susan Reynolds Werk „Fiefs and Vassals“ zum zwanzigsten Mal jährt,[2] kommen wir nicht umher zu konstatieren, dass sich unser Bild des anscheinend so feststehenden Konstrukts des „Lehnswesens“ seit 1994 fundamental wandelt. Grundlegend ist dabei für das Frühmittelalter die massive Dekonstruktion des lange Zeit feststehenden Diktums einer vasallitisch durchstrukturierten Gesellschaft der Karolingerzeit. Stattdessen sehen wir heute ein „reichlich diffuses Spektrum mannigfaltiger Möglichkeiten, personale Bindungen zu begründen“, wie es Steffen Patzold kürzlich so treffend betonte.[3] Vor diesem Hintergrund dürfen wir aber eines nicht vergessen, nämlich dass Vasallen ein Teil der damaligen gesellschaftlichen Realität waren, auch wenn ihre Bedeutung für das strukturelle Gefüge des Karolingerreiches längst nicht so groß war, wie früher angenommen.[4] Interessanterweise wird in der Forschung nun aber sehr viel Wert, durchaus zu Recht, auf die Frage gelegt, welche Bedeutung das Benefizium oder besser gesagt, die Landleihe im Allgemeinen im Rahmen der Herstellung besagter personaler Beziehungen hatte. Das Element der Vasallität erscheint dagegen eher, etwas zugespitzt ausgedrückt, als eine Art Randphänomen, denn, um nochmals Steffen Patzold zu zitieren: „Was sich Handfestes über die vassi und vassalli sagen läßt […], ist nicht allzu viel […].“[5]
Ich möchte im Folgenden daher einige Bemerkungen zu der Frage machen, welche gesellschaftliche Relevanz die Vasallität als Mittel einer personalen Bindung unter diesen Umständen nun tatsächlich im 9. Jahrhundert besaß. Beginnen wir mit einigen statistischen Betrachtungen. Aus Freising sind uns durch den Diakon Cozroh für den Zeitraum zwischen 800 und 900 ca. 850 Urkunden überliefert. Nur in sieben von ihnen tritt der Begriff vassus bzw. vassallus auf, also in einem Anteil von etwa 0,8%.[6] Aus den Passauer und Regensburger Traditionen ergibt sich ein kaum besserer Befund. Etwa vierzig Passauer Traditionen sind uns aus dem 9. Jahrhundert überliefert, zwei, also 5% von diesen, enthalten die genannten Begriffe.[7] Aus Regensburg kennen wir ca. 170 zwischen 800 und 900 verfasste Urkunden. Sieben dieser Urkunden beinhalten vassus oder vassallus, etwa 4,1%.[8] Uns liegen also insgesamt ca. 1060 Urkunden aus diesen drei Überlieferungszusammenhängen vor. Die Ausdrücke vassus bzw. vassallus werden jedoch nur in sechzehn Stücken gebraucht, einem Anteil von etwa 1,5%. Auch für St. Gallen sieht der Befund nicht besser aus. Auf insgesamt etwa 800 Originale für die Zeit zwischen 700 und 920 kommen nur sechs Urkunden, in denen namentlich genannte Vasallen überliefert werden, wobei die erste erst von 864 datiert und nur eine dieser sechs keine Königsurkunde ist.[9]
Ich bin mir über die grundsätzliche Problematik dieser statistischen Befunde angesichts der Überlieferungsproblematik durchaus im Klaren, dennoch halte ich sie für aussagekräftig, zumal sie in bezeichnender Weise mit der aus diesen Urkunden bekannten Anzahl der Vasallen auffällig kontrastiert. Allein in zwei Freisinger Gerichtsurkunden des Jahres 822 werden einmal 16 vassi dominici[10] und einmal sogar 56 vassalli[11] aufgezählt, die an dem jeweiligen Urteil beteiligt waren. Woher kommt diese auffallende Diskrepanz zwischen der relativ hohen Anzahl der an Gerichtsverhandlungen und Rechtsgeschäften ihres jeweiligen Herrn beteiligten Vasallen und der kaum vorhandenen Bereitschaft, die eigene Position als vassus bzw. vassallus bei eigenen Rechtshandlungen anzuzeigen? In einer eigenen Schenkung, die zudem nicht einmal Landbesitz umfasste, wird allein Meginhart, der 819 in Pannonien dem Kloster Freising einen Reliquienbehälter und Weidevieh übergab, ausdrücklich als vassus dominicus bezeichnet.[12] Hatte Meginhart selbst ein Interesse daran, seine Stellung in dieser Form in der Urkunde erwähnt zu sehen? Wir wissen es nicht, wenn dem so wäre, wäre er allerdings die absolute Ausnahme gewesen.
Es scheint seitens der Vasallen in jedem Fall wenig Interesse daran bestanden zu haben, als solche aufzutreten, wenn sie nicht für ihren Herrn tätig waren oder in offizieller Funktion bei Gericht auftraten. Dabei konnten sie durchaus wichtige Positionen einnehmen. Die 16 vassi dominici aus der Gerichtsurkunde von 822 wurden beispielsweise direkt hinter dem publicus iudex Kysalhart und dem Grafen Liutpald aufgeführt, noch vor den übrigen Zeugen.[13] Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass der beklagte Adaluni angegeben hatte, die umstrittene Kirche zur einen Hälfte als Eigentum, zur anderen Hälfte als beneficium dominicum besessen zu haben. Die Vasallen traten also geradezu als regionale „Experten“ für die Belange Ludwigs des Frommen auf.[14] Wir können an diesem Beispiel sehr gut sehen, dass ihre Dienste auch außerhalb des Kriegswesens von hoher Relevanz waren.
Warum verschwiegen Vasallen trotz ihrer hohen Bedeutung ihren eigenen Status dennoch so konsequent, wenn es um Schenkungen oder Tauschgeschäfte ging, die keinen Bezug zu ihrer Stellung oder zum eventuell an sie verliehenen Gut hatten? Der Grund dafür dürfte in der Feststellung liegen, dass sowohl Herren als auch Vasallen die Vasallität unter einem bestimmten Blickwinkel betrachteten, der beide Seiten zu unterschiedlichen Folgerungen bezüglich des eigenen Status in dieser personalen Bindung führte.
Um das zu erklären, muss man auf die Wurzeln der Vasallität verweisen. Vassus ist eine Ableitung vom keltischen gwas, was so viel bedeutet wie „Knecht“.[15] Im sogenannten Pactus Legis Salicae vom Anfang des 6. Jahrhunderts wird ein vassus ad ministerium, quod est horogauo im Zusammenhang mit Schmieden erwähnt.[16] Von Vasallen freier Herkunft ist erst zu Beginn des 8. Jahrhunderts in der Lex Alamannorum die Rede.[17] Diese langsame Entwicklung schien sich nach Ansicht der älteren Forschung stark zu beschleunigen, als der bayerische Herzog Tassilo III. Pippin dem Jüngeren und dessen Söhnen nach Auskunft der Reichsannalen 757 Treue gelobte, ergeben, wie ein vassus seinem dominus gegenüber sein soll.[18] 787 soll er sich sogar in die Hände Karls des Großen in vassaticum tradiert haben.[19] Spätestens seit Matthias Bechers grundlegender Neuinterpretation der Vorgänge dürfte deutlich geworden sein, wie sehr unsere Hauptquelle, die um 790 am Hofe Karls verfassten Reichsannalen, unser Bild dieser Vorgänge bestimmt hat. Dass Tassilo sich 757 bzw. 787 wirklich in die Vasallität der Karolinger begeben haben soll, dürfte kaum aufrecht zu erhalten sein.[20] In jedem Fall ist herauszustellen, dass die Eingehung einer vasallitischen Bindung zwischen dem bayerischen Herzog und dem fränkischen König vom Verfasser der Reichsannalen sehr stark betont wurde, was ein Hinweis darauf sein dürfte, dass dieser ganze Vorgang den späteren Treuebruch als umso schlimmer erscheinen lassen sollte. Betrachtet man jedoch die Herkunft der Vasallität aus einem unfreien und gesellschaftlich wenig angesehenen Umfeld, sollte man nicht außer Acht lassen, dass Tassilos Inferiorität durch diese Formulierungen zusätzlich verdeutlicht wurde. Zeitgenössische Anhänger Tassilos hätten die Betonung einer vasallitischen Beziehung mit Sicherheit als Herabsetzung und Demütigung ihres Herzogs angesehen.
Ähnlich, wenn auch nicht direkt mit dem Begriff der Vasallität verbunden, erscheint vor diesem Hintergrund die Beschreibung der Kommendation des Dänenkönigs Harald Klak 826 im Gedicht In honorem Hludovici christianissimi Caesaris Augusti des Ermoldus Nigellus. Während der auf seine Taufe folgenden Jagd habe er sich und sein Reich mittels einer Kommendation an Ludwig den Frommen tradiert und gelobt, dass er sich seinen servitii zur Verfügung stellen wolle. Harald sei so zu Ludwigs fidelis geworden.[21] Ermoldus gibt keine Grundlage dafür her, hier eine vasallitische Kommendation anzunehmen, der Ritus selbst wird jedoch als klare Unterwerfungsgeste definiert und bewegt sich damit auf einer Linie mit der Beschreibung der Kommendation Tassilos in den Reichsannalen. Bedenkt man, dass Harald einige Jahre zuvor vor den Söhnen des 810 ermordeten Dänenkönigs Göttrik geflohen war, wird deutlich, dass Machtlosigkeit und eigene Schwäche Haralds Kommendation geradezu bedingten.[22] Sieht man sich etwa die Beschreibungen der Kommendationen anderer Normannenführer des 9. Jahrhunderts an, so bestätigt sich dieser Eindruck.
858 erschien der dux eines Teils der Seine-Normannen, Berno, vor Karl dem Kahlen, gab sich in die Hände des westfränkischen Königs und leistete ihm einen Treueid.[23] 862 kommendierte sich der dux Weland Karl und leistete ihm mit den anderen anwesenden Normannen einen Eid.[24] 873 belagerte Karl Angers, das von den Normannen besetzt war. Schließlich kommendierten sich ihm die normannischen Großen, leisteten ihm Eide und stellten Geiseln.[25] Alle drei hier beschriebenen Kommendationen können mit der Situation Haralds verglichen werden, denn auch die Normannen willigten in einer Notsituation in die Kommendation ein.[26] Berno wird ausdrücklich als dux partis pyratarum Sequanae bezeichnet, vielleicht ein Hinweis darauf, dass es unter den Seine-Normannen zu Unstimmigkeiten gekommen und seine Position nicht ungefährdet war.[27] Kurz vor der Kommendation Welands war es Karl gelungen, dessen Sohn gefangen zu nehmen. Möglicherweise benutzte er ihn, um Weland zur Unterwerfung zu zwingen.[28] Klarer ist die Situation in Bezug auf die in Angers eingeschlossenen Normannen, die sich Karl ergeben mussten. Begriffe, die auf eine vasallitische Kommendation hindeuten könnten, werden auch in anderen Quellen, die sich mit diesen Ereignissen oder Personen beschäftigen, nicht genannt.[29]
Noch deutlicher wird die Verbindung von Vasallität und Inferiorität, wenn man sich dem Epitaphium Arsenii des Paschasius Radbertus zuwendet. In c. 17 des zweiten Buches dokumentiert Radbertus mehrere capitula, die die drei ältesten Söhne Ludwigs des Frommen, Lothar I., Ludwig der Deutsche und Pippin I. von Aquitanien wohl im Juni 833 kurz vor dem Abfall des kaiserlichen Heeres von Ludwig auf dem „Lügenfeld“ von Colmar als Antwort auf Beschwerden ihres Vaters verfasst hatten. In einem dieser capitula betonte Ludwig: „Erinnert euch, dass ihr meine Vasallen (vasalli) seid und dass ihr mir durch einen Eid Treue geschworen habt.“ Diese antworteten, dass es der Fall sei, dass sie von Natur aus, durch Versprechen und durch Treueide seine fideles seien und niemals den militärischen Dienst für ihn verweigert hätten. Ludwigs Ruhm, Ehre und prosperitas seien ihnen wichtiger als ihr eigenes Leben.[30]
Die Stellungnahmen des Kaisers scheinen nur verkürzt und zusammengefasst überliefert worden zu sein.[31] Da Radbert im Epitaphium die Vita Abt Walas von Corbie beschrieb, eines Anhängers Lothars, betrachtete er den Standpunkt der Söhne natürlich mit einer gewissen Sympathie.[32] In der Antwort der Söhne wird bezeichnenderweise der Begriff vasallus vermieden, stattdessen verwenden sie den Ausdruck fideles. Aus ihrer Sicht stehen nicht die promissiones oder die sacramenta an erster Stelle der Begründung, warum sie fideles Ludwigs seien. Hier wird der Ausdruck a natura gebraucht, offenbar also auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass Söhne und Väter in einem besonderen Treueverhältnis zueinander stehen, das bereits durch die Geburt geknüpft wurde. Dies weist darauf hin, dass der Begriff vasallus lediglich den untergeordneten Status der Söhne darstellen sollte. Dass dieses mit einem Ausdruck geschah, der durchaus missverständlich verstanden werden konnte, dürfte in der Absicht Radberts gelegen haben.[33]
Aus den genannten Beispielen wird eines deutlich: Unterwerfungsgesten, wie etwa die Kommendation, konnten im Nachhinein durchaus vasallitisch gedeutet werden, da die rituellen Elemente sich nicht wesentlich voneinander unterschieden. Insbesondere der Bericht des Paschasius Radbertus weist darauf hin, wie schwer der angebliche Anspruch Ludwigs des Frommen, dass seine Söhne Vasallen seien, deren Selbstverständnis angegriffen haben könnte. Die Verkürzung der komplexen Vater-Sohn-Beziehung weist, ebenso wie die beabsichtigte Falschdarstellung der Unterwerfung Tassilos durch die Reichsannalen, darauf hin, wie sehr das Denken bis weit ins 9. Jahrhundert hinein von der Inferiorität der Vasallen geprägt worden sein muss. Es ist nicht verwunderlich, dass im Ostfränkischen Reich erst ab dem 10. Jahrhundert Grafen ausdrücklich als Vasallen bezeichnet wurden.[34]
Neben diesen Quellen, die entweder im unmittelbaren Umfeld des karolingischen Hofes entstanden sind oder die die klare Perspektive einzelner Mitglieder der Herrscherfamilie vertraten, gibt es jedoch auch noch solche, die unabhängig davon verfasst wurden, wenn auch Vasallität bei Ihnen nur äußerst selten eine Rolle spielt. Sie tragen jedoch dazu bei, das einseitige Bild, das sich uns bislang geboten hat, zu korrigieren. Es sei zunächst auf die zeitgenössischen Annales Laureshamenses verwiesen, die den Abodritenfürst Witzan anlässlich seiner Ermordung 795 als rex und vassus Karls des Großen bezeichnen.[35] Es ist aus zwei Gründen nahezu ausgeschlossen, dass hier eine technische Verwendung des Begriffes vorliegt.
Zum einen ist es die im Chronicon Moissiacense bezeugte Verwendung des Begriffs Vasall auf die Verhältnisse zwischen Dänenkönig Göttrik und seinen Untergebenen. Zum Jahre 810 wird berichtet, dass der Abodritenfürst Drasco durch einen vassallus Göttriks ermordet wurde. Noch im gleichen Jahr fiel auch Göttrik selbst dem Mordanschlag eines seiner vassalli zum Opfer.[36] Offensichtlich hat der Verfasser des Textes hier versucht, ihm bekannte Institutionen auf Beziehungen zu übertragen, deren genaue Natur ihm nicht vertraut war. Man wird kaum davon ausgehen dürfen, dass dies die Existenz vasallitischer Strukturen bei den Dänen bezeugt. In unserem Zusammenhang gewinnen diese Berichte nun insofern an Bedeutung, als dass das Chronicon Moissiacense sich dabei wohl im Wesentlichen auf eine nicht erhaltene Ausgabe der Lorscher Annalen stützte, die über das Jahr 803 hinaus weitergeführt wurde.[37] Wenn wir nun in Bezug auf Göttrik den offensichtlich untechnischen Gebrauch des Begriffs vassallus herausgestellt haben, so ist zu überlegen, ob nicht auch die Beziehung Witzans zu Karl dem Großen durch den Annalenschreiber mit dem Wort vassus nur eine verherrlichende Umschreibung der völligen Abhängigkeit des Abodritenfürsten von Karls Gunst war und nicht im technischen Sinne gebraucht wurde. Zum anderen wird diese Problematik noch deutlicher, wenn man berücksichtigt, dass Witzan der einzige Heide wäre, den wir als Vasallen bezeugt hätten. Es war durchaus nicht unüblich, dass sich Nichtchristen dem fränkischen Herrscher unterwarfen und sich ihm kommendierten.[38] Doch handelte es sich in keinem Fall um eine Kommendation mit vasallitischen Implikationen. Sollte sich also Witzan gegenüber Karl kommendiert haben, so wäre es durchaus nachvollziehbar, dass der Verfasser der Lorscher Annalen versuchte, diese Beziehung mit dem Begriff vassus zu umschreiben. Der in Bezug auf Göttrik gezeigte untechnische Gebrauch dieses Wortes hätte also bereits hier seinen Niederschlag gefunden.
Ein weiterer Beleg stammt aus den Gesta Karoli Magni des Notker Balbulus aus den 880er Jahren. Er berichtet dort, dass Ludwig der Fromme seinem Vater Ludwig den Deutschen, der zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt war, vorstellen wollte. Als Karl ihn unter den anderen statores stehend bemerkte, erkundigte er sich, wem dieser Junge gehöre. Auf Ludwigs Antwort, dass es seiner sei und dass er, wenn Karl ihn für würdig halte, ihm gehören würde, antwortete der Kaiser: „Gib ihn mir.“ Karl küsste den Knaben und schickte ihn wieder an seinen alten Platz zurück, Ludwig der Deutsche jedoch stellte sich in die gleiche Reihe wie sein Vater. Auf Karls Aufforderung hin fragte Ludwig der Fromme nach, warum er das getan habe. Daraufhin antwortete der junge Ludwig, dass, solange er ein vassallus seines Vaters war, sein Platz hinter diesem, inmitten seiner commilitones gewesen sei. Da er nun aber ein socius und commilito seines Vaters geworden sei, sei er nicht im Unrecht, wenn er sich ihm gleichstelle.[39]
In der historischen Forschung ist man sich schon länger einig, dass Notkers Werk mehr ist als ein Fürstenspiegel. Aus ihm können wir viele Informationen über die soziale und verfassungsrechtliche Wirklichkeit innerhalb des Frankenreichs gegen Ende des 9. Jahrhunderts gewinnen.[40] Welche Aussage steht aber hinter der hier geschilderten Episode? Hans-Werner Goetz sah den Begriff vassallus bei Notker nicht als einen technisch gebrauchten Ausdruck an, sondern betonte, dass er ein „auszeichnender Begriff für die königlichen Gefolgsleute“ gewesen sein soll.[41] Er bezieht sich hierbei auf eine Stelle in Notkers Werk, in der Karl seine legati als optimi vassalli anredet.[42] Seine Auffassung dürfte dort korrekt sein, jedoch muss eine solche Interpretation bei anderen Stellen Notkers nicht unbedingt in dieselbe Richtung verweisen.[43]
Am ehesten lässt sich vielleicht eine untechnische Verwendung dieses Begriffes bei Notkers Beschreibung der Taufe von Normannen zur Zeit Ludwigs des Frommen wiederfinden. Da es sich bei den Normannen herumgesprochen hatte, dass sie bei der Taufe kostbare Geschenke zu erwarten hätten, kamen von Jahr zu Jahr mehr von ihnen am Ostersamstag zum Kaiser, jedoch nicht mehr als fremde legati, sondern als äußerst ergebene vassalli, sich in das obsequium des Kaisers einstellend.[44] Die Getauften wurden von den primores palacii quasi als Adoptivsöhne angenommen, man schuf also einen mit der Taufe Harald Klaks vergleichbaren Kontext. Aus der Erzählung geht nun hervor, dass die Normannen offenbar immer wieder in ihre Heimat zurückkehrten. Wären sie „wirkliche“ Vasallen geworden, wäre ein solches Verhalten kaum zu erklären. Offenbar war das Verhältnis, das Notker hier zwischen Ludwig und den Normannen entwarf, sehr viel unverbindlicher als eines, das auf Vasallität im technischen Sinn aufgebaut worden wäre. Da die Normannen durch die Adoption seitens der primores palacii in ein enges Verhältnis zum fränkischen Hof getreten waren, darf man davon ausgehen, dass hier eindeutig ein „auszeichnender Begriff“ im Sinne von Goetz verwendet wurde.
Auf diese Weise dürfte sich auch das Verhältnis Ludwigs des Deutschen zu seinem Vater und seinem Großvater erklären lassen. Nicht eine vasallitische Bindung, die nicht nachgewiesen werden kann, sondern das quasi naturgegebene obsequium eines Sohnes gegenüber dem Vater macht das „Vasallenverhältnis“ Ludwigs des Deutschen zu Ludwig dem Frommen aus. Durch den Kuss des Großvaters und den Satz „Gib ihn mir!“ rückt ersterer gegenüber Karl in eine Stellung auf, die mit der des Vaters vergleichbar ist, bestimmt durch die Nähe zum Herrscher.[45] Wie bereits am Beispiel des Paschasius Radbertus gesehen, dürfte auch hier die Treue a natura, die Vater und Großvater zu schulden war, grundlegend für das Verhältnis Ludwigs zu diesen gewesen sein, jedoch mit der entscheidenden Wendung, dass es offenbar nicht negativ verstanden wurde.
Es dürfte deutlich geworden sein, dass offenbar ein, wenn ich es so nennen darf, technisches und ein, wenn auch weniger gebräuchliches, untechnisches Verständnis von „Vasallität“ nebeneinander existierten, einmal mit einem klaren Unterordnungsaspekt, in dem sich die Herkunft des Wortes vassus widerspiegelt, und einmal eher als „Auszeichnung“, durch die sich der Träger von anderen Personen durch die spezielle Beziehung zum jeweiligen Herrn hervorhob. Warum aber war die technische Auffassung so dominierend, dass die Vasallen diese Sicht übernahmen und ihre Position nicht als Heraushebung verstanden?
Der Grund dafür dürfte in der Art der Beziehung der Vasallen zum Königshof zu suchen sein. In der Zeit der Merowinger sind die pueri regis bezeugt, deren militärische und Botendienste denen der späteren Vasallen nicht ganz unähnlich sind.[46] Hierbei handelte es sich um unfreie und freie Personen, die wohl den Söhnen adliger Familien, die zur Erziehung bei Hofe waren, nicht gleichgestellt waren, obwohl es durchaus möglich ist, dass sie zusammen mit ihnen unterrichtet wurden. So lässt sich die enge Beziehung, die selbst Angehörige der Königsfamilie zu pueri hatten, leicht erklären.[47] In den karolingischen Zeugnissen über Personen, die bei Hof militärisch ausgebildet wurden, ist jedoch von pueri in der Regel nicht mehr die Rede. Sehr viel öfter hören wir stattdessen von iuvenes. Dieser Ausdruck wurde auf diejenigen angewandt, die eine Ausbildung an Waffen erhalten hatten, aber eher dem Adel entstammten, was etwa an den iuvenes zu sehen ist, die den westfränkischen König Karlmann 884 auf der Jagd im Wald Bezu begleiteten, auf der er zu Tode kam.[48]
Die Quellen bestätigen, dass die Art der Unterweisung der adligen Jugendlichen sich gegenüber dem Unterricht, den die pueri der Merowingerzeit genossen, nicht wesentlich verändert hatte. Noch immer stand die militärische Ausbildung im Vordergrund. Dies wird etwa aus der um 830 entstandenen Fassung der Vita des hl. Wandregisel deutlich. In der ältesten Vita, die aus dem 8. Jahrhundert stammt, wird der Dienst des jungen Wandregisel bei König Dagobert nur kurz angerissen.[49] Dagegen wird dieser Aspekt in der jüngeren Version weiter mit den Inhalten der Ausbildung ausgeschmückt, wobei die militärische Ausbildung an erster Stelle genannt wird.[50] Die durch Wilhelm Levison dem um 800 lebenden Metzer Diakon Donatus zugeschriebene Vita des Abtes Ermenland von Indre, berichtet, dass die Eltern des zukünftigen Abtes über sein angehäuftes „Bücherwissen“ anscheinend beunruhigt waren und eine andere Laufbahn für ihren Sohn vorgesehen hatten. Sie führten ihn in die aula regia ein und kommendierten ihn dem König zur militärischen Unterweisung und Dienstleistung.[51] Auch wenn neben der Unterweisung in militärischen Dingen ebenfalls eine vorgelagerte Wissensvermittlung zur geistigen Reifung der jungen Adligen zum Unterricht gehörte, wie es Einhard für die Söhne Karls des Großen überliefert,[52] wird doch der Unterschied der Formung einer kriegerisch und aristokratisch geprägten Maskulinität zur rein geistigen Ausbildung an der Hofschule deutlich.[53]
Welche Verbindung lässt sich nun von den iuvenes zu den Vasallen ziehen? Diese ergibt sich aus der Schrift De ordine palatii, die Hinkmar von Reims 882 verfasste, wobei er sich aber in maßgeblicher Weise auf ein nicht mehr überliefertes Werk des Abtes Adalhard von Corbie stützte, das entweder bald nach 781 oder zwischen 810 und 814 entstanden war.[54] Teil dieses Werkes Adalhards dürfte auch die Beschreibung der Aufteilung der Hofgesellschaft sein, die aus drei ordines bestanden haben soll. Die erste Gruppe waren die expediti milites ohne besonderes Amt, die von hohen Herren versorgt wurden und insbesondere von den Inhabern der Hofämter immer wieder zum gemeinsamen Mahl und zur Bekräftigung ihrer freundschaftlichen Bindungen eingeladen wurden. Die zweite Gruppe waren die discipuli, die ihrem Lehrer folgten und von denen jeder einzelne an seinem locus von ihren Herren durch Aufsicht und Ansprache gefördert wurde. Die dritte Gruppe schließlich waren die pueri vel vassalli der höheren und geringeren Leute, die jeder, der sie ohne Verfehlung unterhalten könne, um sich haben wollte.[55]
Von allen drei ordines, das macht schon die Stellung in der Aufzählung deutlich, dürften die expediti milites wohl die angesehenste Gruppe bei Hofe gewesen sein. Hierbei wird es sich um die Vasallen gehandelt haben, die zumindest über längere Zeiträume bei Hofe anwesend waren.[56] Schon die Art der Gaben, die sie erhielten, u.a. Gold, Silber und Pferde, weist darauf hin, dass sie aus höheren Kreisen stammten. Von ihnen unterschieden werden die discipuli. Es ist nicht sicher, wer unter diese Personengruppe fiel. Während Brigitte Kasten annahm, dass es sich um die „Verwaltungshochschule“ der Karolinger handelte, in der die jungen Adligen von den Inhabern der Hofämter unterrichtet würden,[57] sah Bernard Bachrach hierin eher die Schule für die zukünftigen Kommandeure des karolingischen Heeres.[58] Bedenken wir, dass geistige und militärische Ausbildung bei den jungen Adligen durchaus zusammenfallen konnten, sollte man nicht ausschließen, dass beide Ansichten zu berücksichtigen sind, obwohl der militärische Anteil bedeutsamer gewesen dürfte.
Wenden wir uns schließlich dem dritten ordo zu, den pueri vel vassalli der höheren und geringeren Leute. Auch diese durften nach Ausweis Adalhards bzw. Hinkmars eigene bewaffnete Gruppen unterhalten, aber nur unter der Bedingung, dass sie es sich auch leisten konnten. Bemerkenswert ist hierbei, dass für diesen ordo offenbar zwei Bezeichnungen synonym gebraucht werden konnten. Bedenkt man die Herkunft der Begriffe puer und vassallus aus ursprünglich unfreien Zusammenhängen, ist es verständlich, dass sie nur im Zusammenhang mit den Untergebenen der Angehörigen des Hofes verwendet wurde. Geht man davon aus, dass die expediti milites die Königsvasallen bei Hofe waren, die von den discipuli abgegrenzt wurden und aufgrund ihrer Beziehung zum Herrscher offenbar schon eine erhöhte Stellung eingenommen hatten, scheint Adalhard die Bezeichnungen für den dritten ordo in diesem Zusammenhang als wenig angemessen empfunden zu haben und nahm daher eine Beschränkung auf die Untergebenen der Angehörigen des Hofes vor.[59]
Wie dem auch sei, in De ordine palatii wurden also die Jugendlichen bei Hofe von denen unterschieden, die bereits voll ausgebildet waren. Somit darf man annehmen, dass die discipuli mit Beendigung ihrer Ausbildung expediti milites wurden. Ausgehend von dieser Prämisse, ist es sehr wahrscheinlich, dass die discipuli in anderen Quellen als iuvenes bezeichnet wurden. Beide wurden am Hofe ausgebildet, gehörten dem Adel an und stellten das militärische Gefolge des Königs. Des Weiteren können wir davon ausgehen, dass hinter den expediti milites Königsvasallen zu sehen sind, eine Auffassung, die zusätzlich dadurch bestärkt wird, dass sie absque ministeriis, also keine Grafen waren, und ad regale obsequium inflammatum animum ardentius hattenhahh, somit offenbar nicht nur auf bestimmte Aufgabenbereiche, etwa militärische, beschränkt waren.[60] Damit dürfte deutlich geworden sein, dass die iuvenes am karolingischen Hof zum einen als Schüler, zum anderen aber auch als Vorstufe der Vasallen zu sehen sind und dass Königsvasallen zumindest Teile ihrer Ausbildung am Königshof erhielten.
Im Rahmen dieser Ausbildung dürfte eine enge Bindung zum König geknüpft worden sein. Gleichzeitig war damit aber auch die Grundlage dafür gegeben, dass die am Hof herrschende Auffassung von Vasallität als ungleiche Beziehung auch von den Vasallen selbst aufgenommen und so ein Teil der gesellschaftlichen Realität wurde. Man kann also in diesem Fall von einer gezielten Systematisierung des Sprachgebrauchs im Sinne des Hofes ausgehen, wie er etwa im Falle Tassilos zum Ausdruck kam. Diesem entspricht auch die Feststellung Brigitte Kastens, dass Grafen, Äbte und Bischöfe nicht als Vasallen bezeichnet wurden, weil ihr Amt als Teilhabe an einem göttlichen Herrschaftsauftrag interpretiert wurde, das ministerium somit göttlich legitimiert war und nicht einer von Menschen errichteten Größe wie dem Vasallenstatus unterliegen konnte.[61] Wer Vasall wurde, wurde also nicht automatisch Teil des „Establishments“, sondern ging mit dem jeweiligen Herrn nur eine Verbindung zu gegenseitigem Nutzen ein.
Daher scheint die Vasallität für junge Adlige ein erstrebenswerter Status gewesen zu sein, wie ihre Herren von ihnen ergebenen Vasallen auch in Krisenzeiten profitieren konnten. Selbst Baldrich, der ehemalige Markgraf von Friaul, hatte ausweislich einer Freisinger Urkunde 843 in Bayern noch mindestens 15 Vasallen, obwohl er in den Auseinandersetzungen um die Nachfolge Ludwigs des Frommen auf der Seite Lothars I. stand.[62] Obwohl also auf beiden Seiten Interesse an dieser Art von Verbindung bestand, war sie für die „Öffentlichkeit“ oft nur dann von Bedeutung, wenn sie im Rahmen von Rechtshandlungen sozusagen „aktiviert“ wurde, im militärischen Rahmen, als Zeugen oder Beteiligte im Rahmen von Besitzübertragungen bzw. –tausch oder, im Fall von Königsvasallen, als unterstützende Personen bei Gerichtsverhandlungen. Außerhalb dieses Rahmens scheint sie nur von geringer Relevanz gewesen zu sein, da ihre Assoziation mit der Unfreiheit nicht dazu diente, aus der Vasallität ein äußerlich bestimmendes Merkmal der karolingischen Gesellschaft zu machen. Wenn wir uns der Vasallität in Zukunft nähern wollen, sollte man diese Divergenz berücksichtigen. So ist aber auch das Missverhältnis zwischen der lange vorherrschenden Sicht einer vasallitisch durchstrukturierten Gesellschaft und der von der jüngeren Forschung dargestellten untergeordneten Bedeutung der Vasallität als einer von mehreren Bindungsoptionen, der keinesfalls ein Vorrang zukam, zu erklären. Wenn sie im Innenverhältnis wichtiger war als im Außenverhältnis, ist der geringe Niederschlag in den Quellen erklärbar, ändert jedoch nichts daran, dass man ihr kaum die beherrschende Stellung in der Gesellschaft zubilligen kann, die ihr früher zugerechnet wurde. Es gilt eher, den Einzelfall zu betrachten und aus ihm die entsprechenden Schlüsse für die jeweilige Beziehung zwischen Herr und Vasall zu ziehen.
[1] Den folgenden Beitrag habe ich im Rahmen eines Workshops zum Lehnswesen im Oktober 2013 in Freiburg vorbereitet, der von Prof. Dr. Jürgen Dendorfer und Prof. Dr. Seffen Patzold organisiert wurde. Wesentliche Teile dieses Vortrags beruhen auf meiner kürzlich erschienenen Dissertation: Vasallität und Benefizialwesen im 9. Jahrhundert. Studien zur Entwicklung personaler und dinglicher Beziehungen im frühen Mittelalter (Texte zur historischen Forschung und Lehre 1), Hildesheim 2013. Zentrale Gedanken der Arbeit sind hier in geraffter Form dargestellt und zum Teil mit ergänzenden Bemerkungen versehen worden, die meine Überlegungen noch etwas weiter führen.
[2] Vgl.: Susan Reynolds, Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford 1994. Vgl. auch die späteren Beiträge, in denen sie sich mit der Kritik an ihrem Werk auseinandergesetzt hat und weitergehende Gedanken entwickelte: Susan Reynolds, Afterthoughts on Fiefs and Vassals, in: The Haskins Society Journal 7 (1997), S. 1-15; Dies., Susan Reynolds responds to Johannes Fried, in: German Historical Institute London, Bulletin 19, Nr. 2 (November 1997), S. 30-40; Dies., Carolingian Elopements as a Sidelight on Counts and Vassals, in: Balázs Nagy/Marcell Sebők (Hgg.), …The Man of Many Devices, Who Wandered Full Many Ways… Festschrift in Honor of János M. Bak, Budapest/New York 1999, S. 340-346; Dies., Fiefs and Vassals after Twelve Years, in: Sverre Bagge/Michael H. Gelting/Thomas Lindkvist (Hgg.), Feudalism. New Landscapes of Debate (The Medieval Countryside 5), Turnhout 2011, S. 15-26. Zusammenfassungen des aktuellen Forschungsstandes bieten: Brigitte Kasten, Das Lehnswesen – Fakt oder Fiktion, in: Walter Pohl/Veronika Weiser (Hgg.), Der frühmittelalterliche Staat – europäische Perspektiven (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 16 = Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Denkschriften, 386. Band), Wien 2009, S. 331-353 sowie Steffen Patzold, Das Lehnswesen, München 2012, S. 14-43.
[3] Vgl.: Patzold, Lehnswesen, S. 39.
[4] Nach wie vor die klassische Sichtweise auf das Lehnswesen im frühen Mittelalter am besten darstellend: François Louis Ganshof, Was ist das Lehnswesen? Darmstadt 71989, S. 1-64.
[5] Vgl.: Patzold, Lehnswesen, S. 38.
[6] Vgl.: Die Traditionen des Hochstifts Freising, ed. Theodor Bitterauf (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte N.F. 4), Bd. 1 (744-926), München 1905, ND Aalen 1967: Nr. 419, S. 359-360; Nr. 466, S. 398-400; Nr. 475, S. 406-407; Nr. 604, S. 516-517; Nr. 634, S. 538-549; Nr. 661, S. 556-558; Nr. 989, S. 749-750.
[7] Vgl.: Die Traditionen des Hochstifts Passau, ed. Max Heuwieser (Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte N.F. 6), München 1930, ND Aalen 1969: Nr. 73a, aa, S. 61-70; Trad. Pass. Nr. 89, S. 76.
[8] Vgl.: Die Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klosters S. Emmeram, ed. Josef Widemann (Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte N.F. 8), München 1943, ND Aalen 1969: Nr. 11, S. 9-10; Nr. 20, S. 25-27; Nr. 40, S. 46-47; Nr. 42, S. 47-48; Nr. 81, S. 75; Nr. 87, S. 79-80; Nr. 92, S. 82-83.
[9] Vgl.: Die Urkunden der deutschen Karolinger 1. Die Urkunden Ludwigs des Deutschen, Karlmanns und Ludwigs des Jüngeren, ed. Paul Kehr (MGH DD regum Germaniae ex stirpe Karolinorum 1), Berlin 1934, Nr. 113, S. 162; D LD, Nr. 158, S. 222; Die Urkunden der deutschen Karolinger 2. Die Urkunden Karls III., ed. Paul Kehr (MGH DD regum Germaniae ex stirpe Karolinorum 2), Berlin 1937, Nr. 164, S. 266-267; Die Urkunden der deutschen Karolinger 3. Die Urkunden Arnolfs, ed. Paul Kehr (MGH DD regum Germaniae ex stirpe Karolinorum 3), Berlin 1940, Nr. 51, S. 74; D Arn, Nr. 73, S. 110; Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, ed. Hermann Wartmann, Bd. 2, Zürich 1866: Nr. 576, S. 188-189.
[10] Trad. Freis. Nr. 466, S. 399: Kysalhart publicus iudex, Liutpald comes vassi dominici. [sic!] Cundachar. Meginhart. Uuolfperht. Hroadolt. Camanolf. Machelm. Atto. Meiol. Cotescalch. Deotpald. Engilhart. Cundpald. Ratpot, Einhart. Cundperht. Hitto. Vgl. auch: Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit, ed. Rudolf Hübner, 1. Abt., Weimar 1891-1893, ND Aalen 1971, S. 42-43, Nr. 243 (zu 823). Dass der Editor den Begriff vassi dominici zu Liutpald comes gezogen hat, ist unverständlich, da in der Urkunde zwei der hier genannten Personen ausdrücklich mit diesem Titel belegt werden: Similiter et Liutpald comes, Hrodolt, Camanolf vassi dominici dixerunt se vidisse ubi Deotperht ipsam ecclesiam in manus Hittonis episcopi reddidit.
[11] Trad. Freis. Nr. 475, S. 406-407: Alii autem vassalli: Machelm. Cotescalch. Reginhart. Etih. Haholf. Emheri. Parto. Hemmi. Crimuni. Hamminc. Meiol. Reginhart. Kamanolf. Chuniperht. Hroadolt. Suuarzolf. Pernker. Cundpald. Chuniperht. Oadalscalch. Coteperht. Engilhart. Lantfrid. Heipo. Reginperht. Spulit. Situli. Regino. Sigur. Paldachar. Poapo. Adalker. Poran. Ratolt. Adalker. Pero. Deothart. Ellanperht. Cundalperht. Hroadhart. Uuichelm. Kotehelm. Sigiperht. Tiso. Crimheri. Morizzo. Chonrat. Hroadolt. Ellanperht. Heilrih. Uuolfolt. Uuolfperht. Tato. Tuti. Reginolt. Alius Uuolfperht seu alii multi. Vgl. auch: Hübner, Gerichtsurkunden, Nr. 238, S. 41.
[12] Trad. Freis. Nr. 419, S. 359: Denique omnibus tam eclesiasticis quam etiam et saecularibus venerabilibus viris satis sit dilucidatum, qualiter Meginhardus vassus dominici reddidit in manus Hittonis episcopi pro manice cervino capsam quam a domo sanctae Marię cum reliquiis accepit Uuasucrim aramiator.
[13] Zur Urkunde, vgl.: Stefan Esders/Heike Johanna Mierau, Der althochdeutsche Klerikereid. Bischöfliche Diözesangewalt, kirchliches Benefizialwesen und volkssprachliche Rechtspraxis im frühmittelalterlichen Baiern (MGH Studien und Texte 28), Hannover 2000, S. 212-214.
[14] Prosopografische Untersuchungen haben ergeben, dass sämtliche in dieser Urkunde genannten Vasallen in Bayern beheimatet waren und daher mit den regionalen Verhältnissen vertraut gewesen sein dürften, vgl.: Salten, Vasallität, S. 189-197.
[15] Vgl.: Heinrich Mitteis, Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Weimar 1933, ND Darmstadt 1958, S. 17-18; K.-J. Hollyman, Le développement du vocabulaire féodal en France pendant le haut moyen age (Étude sémantique) (Société de publications romanes et françaises 58), Genf/Paris 1957, S. 115; Walther Kienast, Die fränkische Vasallität. Von den Hausmeiern bis zu Ludwig dem Kind und Karl dem Einfältigen, hg. von Peter Herde (Frankfurter Wissenschaftliche Beiträge, Kulturwissenschaftliche Reihe 18), Frankfurt a.M. 1990, S. 89.
[16] Vgl.: Pactus Legis Salicae, ed. Karl August Eckhardt (MGH LL nat. Germ. 4/1), Hannover 1962, c. 35, 9, S. 132. Zur weiteren Begriffsentwicklung, vgl.: Hollyman, Développement, S. 116-117; Kienast, Vasallität, S. 89-96.
[17] Vgl.: Lex Alamannorum, ed. Karl Lehmann (MGH LL nat. Germ. 5/1), Hannover 1888, S. 36-157, hier: c. 36, 3, S. 95-96.
[18] Annales regni Francorum inde ab a. 741. usque ad a. 829. qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi, ed. Friedrich Kurze (MGH SS rer. Germ. i. us. schol. 6), Hannover 1895, ND Hannover 1950, ad a. 757, S. 14-16: Et rex Pippinus tenuit placitum suum in Compendio cum Francis; ibique Tassilo venit, dux Baioariorum, in vasatico se commendans per manus, sacramenta iuravit multa et innumerabilia, reliquias sanctorum manus inponens, et fidelitatem promisit regi Pippino et supradictus filiis eius, domno Carolo et Carlomanno, sicut vassus recta mente et firma devotione per iustitiam, sicut vassus dominos suos esse deberet.
[19] Annales regni Francorum, ad a. 787, S. 78: Tunc praespiciens se Tassilo ex omni parte esse circumdatum et videns, quod omnes Baioarii plus essent fideles domno rege Carolo quam ei et cognovissent iustitiam iamdicti domni regis et magis voluissent iustitiam consentire quam contrarii esse, undique constrictus Tassilo venit per semetipsum, tradens se manibus in manibus domni regis Caroli in vassaticum, et reddens ducatum sibi commissum a domno Pippino rege, et recredidit se in omnibus peccasse et male egisse.
[20] Vgl.: Matthias Becher, Eid und Herrschaft. Untersuchungen zum Herrscherethos Karls des Großen (Vorträge und Forschungen Sonderbd. 39), Sigmaringen 1993, S. 21-78.
[21] Ermoldus Nigellus, In honorem Hludovici christianissimi Caesaris Augusti, ed. Edmond Faral, in: Ders., Ermold le Noir. Poème sur Louis le Pieux et Épitres au roi Pépin (Les Classiques de l’Histoire de France au Moyen Age 14), Paris 1932, S. 2-201, hier: lib. 4, v. 2482-2493, S. 188-190: Mox manibus junctis regi se tradidit ultro / Et secum regnum, quod sibi jure fuit. / „Suscipe, Caesar, ait, me nec non regna subacta; / Sponte tuis memet confero servitiis.“ / Caesar ad ipse manus manibus suscepit honestis; / Junguntur Francis Danica regna piis. / Mox quoque Caesar ovans Francisco more veterno / Dat sibi equum nec non, ut solet, arma simul. / Festa dies iterum surgit renovata nitescens, / Francis et Denis concelebrata micat. / Interea Caesar Heroldum jamque fidelem / Munere donat opum pro pietate sua. Zur grundsätzlichen Bewertung des gesamten Vorgangs, vgl.: Salten, Vasallität, S. 87-94.
[22] Zu den Vorgängen, die der Taufe und Kommendation Haralds unmittelbar vorausgingen, vgl.: Raimund Ernst, Karolingische Nordostpolitik zur Zeit Ludwigs des Frommen, in: Carsten Goehrke/Erwin Oberländer/Dieter Wojtecki (Hgg.), Östliches Europa. Spiegel der Geschichte. Festschrift für Manfred Hellmann zum 65. Geburtstag (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 9), Wiesbaden 1977, S. 81-107, hier: S. 92-94; Volker Helten, Zwischen Kooperation und Konfrontation: Dänemark und das Frankenreich im 9. Jahrhundert, Köln 2011, S. 92-107.
[23] Annales de Saint-Bertin, ed. Félix Grat/Jeanne Vielliard/Suzanne Clémencet, Paris 1964, ad a. 858, S. 76: Berno dux partis pyratarum Sequanae insistentium ad Karlum regem in Vermeria palatio uenit, eiusque se manibus dedens fidelitatem statim iurat.
[24] Annales de Saint-Bertin, ad a. 862, S. 89: Et post uiginti circiter dies ipse Vuelandus ad Karolum ueniens, illi se commendauit et sacramenta cum eis quos secum habuit statim praebuit.
[25] Annales de Saint-Bertin, ad a. 873, S. 194-195: Karolus uiriliter ac strenue obsidionem Nortmannorum in gyro Andegauis ciuitatis exsequens, adeo Nortmannos perdomuit, ut primores eorum ad illum uenerint seseque illi commendauerint et sacramenta qualia iussit egerint, et obsides quot et quantos quaesiuit illi dederint, ut de ciuitate Andegauis constituta de exirent et in regno suo, quamdiu uiuerent, nec praedam facerent nec fieri consentirent.
[26] Vgl.: Harald Neifeind, Verträge zwischen Normannen und Franken im neunten und zehnten Jahrhundert (Heidelberg; Univ.; Diss.), Heidelberg 1971, S. 75.
[27] Der andere Teil der Seine-Normannen nahm noch im gleichen Jahr Abt Ludwig von Saint-Denis gefangen, vgl.: Annales de Saint-Bertin, ad a. 858, S. 77.
[28] Annales de Saint-Bertin, ad a. 862, S. 88-89. Vgl. auch: Neifeind, Verträge, S. 73.
[29] 863 wurde Weland der infidelitas angeklagt und im Zweikampf getötet, dieser Begriff alleine sagt aber nicht über ein spezielles Vasallitätsverhältnis zum König aus, vgl.: Annales de Saint-Bertin, ad a. 863, S. 104. Vgl. auch: Reynolds, Fiefs, S. 31 und 88. Zum Tode Welands, vgl.: Horst Zettel, Das Bild der Normannen und der Normanneneinfälle in westfränkischen, ostfränkischen und angelsächsischen Quellen des 8. bis 11. Jahrhunderts, München 1977, S. 168. Die Belagerung von Angers wird von verschiedenen Quellen des 9. und 10. Jahrhunderts erwähnt, aber auch hier findet sich nichts, was die Annahme einer vasallitischen Bindung erhärten könnte, vgl.: Annales Vedastini, ed. Bernhard von Simson (MGH SS rer. Germ. i. us. schol. 12), Hannover/Leipzig 1909, S. 40-82, hier: ad a. 873, S. 40; Regino von Prüm, Chronicon cum continuatione Treverensi, ed. Friedrich Kurze (MGH SS rer. Germ. i. us. schol. 50), Hannover 1890, ad a. 873, S. 106-107; Cartulaire noir de la cathédrale d’Angers, ed. Ch. Urseau, Paris/Angers 1908, Nr. 35, S. 79-80; Folcwin, Gesta abbatum S. Bertini Sithiensium, ed. Oswald Holder-Egger (MGH SS 13), Hannover 1881, S. 607-635, hier: c. 74, S. 621.
[30] Paschasius Radbertus, Epitaphium Arsenii, ed. Ernst Dümmler, in: Abhandlungen der königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom Jahre 1900, Phil.-Hist. Classe, II. Abh., Berlin 1900, S. 1-98, hier: lib. 2, c. 17, S. 85-86: Deinde in alio capitulo: „Mementote, inquit, etiam et quod mei vasalli estis, mihique cum iuramento fidem firmastis.“ Ad quod rursus iidem: „Bene, inquiunt, recolimus ita esse uti mandastis, quoniam et a natura, et a promissis, et ab omni vere fidei sacramento profecto fideles sumus. Unde sicut numquam deseruimus militiae vestrae servitutem, ita donec spiritus in nobis superest, numquam desertores erimus, quia nobis gloria vestra, honor et prosperitas carior est, quam vita nostra. [...]“
[31] Vgl.: Carl Rodenberg, Die Vita Walae als historische Quelle (Göttingen; Univ.; Diss.), Göttingen 1877, S. 53-54; Mayke de Jong, The Penitential State. Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814-840, Cambridge 2009, S. 226.
[32] Vgl.: Brigitte Kasten, Aspekte des Lehnswesens in Einhards Briefen, in: Hermann Schefers (Hg.), Einhard. Studien zu Leben und Werk (Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission N.F. 12), Darmstadt 1997, S. 247-267, hier: S. 261.
[33] Vgl.: Charles Edwin Odegaard, Vassi and Fideles in the Carolingian Empire (Harvard Historical Monographs 19), Cambridge, Mass. 1945, S. 45-46. Vgl. auch: Brigitte Kasten, Economic and Political Aspects of Leases in the Kingdom of the Franks during the Eighth and Ninth Centuries: A Contribution to the current Debate about Feudalism, in: Bagge/Gelting/ Lindkvist (Hgg.), Feudalism, S. 27-55, hier: S. 47-48, die betont, dass Ludwig ein schwerer Fauxpas in den Mund gelegt worden sei, indem er provozierend von seinen Söhnen vasallitischen Gehorsam verlangte.
[34] Vgl.: Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 1. Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I., ed. Theodor Sickel (MGH DD regum et imperatorum Germaniae 1), Hannover 1879-1884, Nr. 198, S. 278.
[35] Annales Laureshamenses, ed. Georg Heinrich Pertz (MGH SS 1), Hannover 1826, S. 22-39, hier: ad a. 795, S. 36: [...] ipsi eum pleniter adhuc non venerunt, eo quod vassum domni regis Wizzin regem Abotridarum occiserunt; [...].
[36] Chronicon Moissiacense, ed. Walter Kettemann, in: Ders., Subsidia Anianensia. Überliefeurngs- und textgeschichtliche Untersuchungen zur Geschichte Witiza-Benedikts, seines Klosters Aniane und zur sogenannten „anianischen Reform“ (Duisburg; Univ.-GH; Diss.), Teil 2, Beilage 2, Duisburg/Essen 2008, ad a. 810, S. 113: Et godafredus rex nortmannorum misit quasi pacifice per insidias uassallum suum ut in dolo drosocum, regem abdritorum, occidisset quod ita factum fuit.[...] Et postea illi godafredus fuit interfectus a suo uassallo et perdidit regnum cum uita.
[37] Vgl.: Friedrich Kurze, Ueber die karolingischen Reichsannalen von 741-829 und ihre Ueberarbeitung. III. Die zweite Hälfte und die Ueberarbeitung, in: NA 21 (1896), S. 9-82, hier: S. 26-29; Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, Heft 2: Die Karolinger vom Anfang des 8. Jahrhunderts bis zum Tode Karls des Großen, bearb. von Wilhelm Levison und Heinz Löwe, Weimar 1953, S. 265.
[38] Neben Harald Klak und den erwähnten Normannenführern im Westfränkischen Reich wäre hier insbesondere die Kommendation ’Abdallahs, Sohn des Emirs ’Abdarrahman I. von Cordoba, gegenüber Karl dem Großen 797 zu erwähnen, den sein Bruder nach dem Tode des Vaters nach Mauretanien vertrieben hatte, vgl.: ARF, ad a. 797, S. 100: Et in Aquis palatio Abdellam Sarracenum filium Ibin Mauge regis, qui a fratre regno pulsus in Mauretania exulabat, ipso semetipsum commendante suscepit. Vgl. dazu: Roger Collins, The Arab Conquest of Spain 710-797, Cambridge 1989, S. 202-203, 211.
[39] Notker Balbulus, Gesta Karoli Magni Imperatoris, ed. Hans F. Haefele (MGH SS rer. Germ., N.S. 12), Berlin 1959, lib. 2, c. 10, S. 65-66: Cumque prima die vel secunda inter reliquos statores eum imperator curiosioribus oculis intueretur, dixit ad filium: „Cuius est ille puerulus?“ Illo respondente: „Quia meus et vester, si dignamini“ postulabat eum dicens: „Da illum mihi.“ Quod cum factum fuisset, deosculatum serenissimus augustus pusionem remisit ad stationem pristinam. Ille mox dignitatem suam cognoscens et cuiquam post imperatorem secundus remanese dispiciens, collectis animis et membris compositissime collocatis ęquato gradu stetit iuxta patrem suum. Quod providentissimus aspectans Karolus vocato ad se filio Hludowico praecepit, ut interrogarent cognominem suum, cur ita faceret vel qua fiducia se patri adęquare praesumeret. Ille vero raione subnixum reddidit responsum: „Quando“ inqiuens „vester eram vassallus, post vos, ut oportuit, inter commilitones meos steteram. Nunc autem vester socius et commilito non inmerito me vobis coęquo.“
[40] Vgl.: Heinz Löwe Das Karlsbuch Notkers von St. Gallen und sein zeitgeschichtlicher Hintergrund, in: Ders., Von Cassiodor zu Dante. Ausgewählte Aufsätze zur Geschichtsschreibung und politischen Ideenwelt des Mittelalters, Berlin/New York 1973, S. 123-148; Hans-Werner Goetz, Strukturen der spätkarolingischen Epoche im Spiegel der Vorstellungen eines zeitgenössischen Mönchs. Eine Interpretation der „Gesta Karoli“ Notkers von Sankt Gallen, Bonn 1981, S. 21-59. Simon MacLean, Kingship and Politics in the late ninth century. Charles the Fat and the end of the Carolingian Empire (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series, Nr. 57), Cambridge 2003, S. 199-229 sieht Notkers Werk auch als einen Kommentar zur politischen Situation des Frankenreiches unter Karl III. und als Beitrag zur politischen Theorie der karolingischen Renaissance an.
[41] Vgl.: Goetz, Strukturen, S. 31, Anm. 92. Dieser Ansicht schließt sich auch Brigitte Kasten, Königssöhne und Königsherrschaft. Untersuchungen zur Teilhabe am Reich in der Merowinger- und Karolingerzeit (MGH Schriften 44), Hannover 1997, S. 237 an, die in der Selbstbezeichnung Ludwigs als Vasallen eine „pointierte Übertreibung eines konkurrierenden Befehl-Gehorsam-Gefüges zwischen Großvater und Enkel sowie Vater und Sohn“ zu erkennen glaubt.
[42] Notker Balbulus, Gesta Karoli Magni, lib. 2, c. 12, S. 74.
[43] Dies scheint zumindest der Fall zu sein, wenn er von bischöflichen Vasallen spricht, vgl.: Notker Balbulus, Gesta Karoli Magni, lib. 1, c. 18, S. 23; lib. 1, c. 20, S. 26.
[44] Notker Balbulus, Gesta Karoli Magni, lib. 2, c. 19, S. 89-90.
[45] Vgl.: Kasten, Aspects, S. 48.
[46] Belege für pueri als Boten, vgl.: Gregor von Tours, Libri Historiarum X, ed. Bruno Krusch/Wilhelm Levison (MGH SS rer. Mer. 1,1), Hannover 1951, lib. 3, c. 18, S. 118; lib. 5, c. 19, S. 227: lib. 6, c. 35, S. 306; lib. 7, c. 40, S. 363; lib. 7, c. 42, S. 364. Desgleichen für pueri als militärisches Gefolge, vgl.: Ebd., lib. 6, c. 17, S. 286; lib. 6, c. 32, S. 303; lib. 7, c. 29, S. 348-349; lib. 7, c. 47, S. 366; lib. 10, c. 27, S. 520.
[47] Es sei hier nur auf das Beispiel des Gailenus hingewiesen, der ein puer des Chilperichsohnes Merowech, aber auch dessen familiaris war, vgl.: Gregor von Tours, Libri Hstoriarum X, lib. 5, c. 14, S. 208 bzw. lib. 5, c. 18, S. 224.
[48] Annales Vedastini, ad a. 884, S. 56: Franci vero, qui cum Karlomanno fuerant redierunt ad sua loca; pauci iuvenes cum eo remanserunt venandi causa in Basiu silva. In den Annales Fuldenses, ed. Friedrich Kurze (MGH SS rer. Germ. i. us. schol. 7), Hannover 1891, ad a. 884, S. 101 wird von einem satelles gesprochen, der Karlmann verwundet habe.
[49] Vita Wandregiseli abbatis Fontanellensis, ed. Bruno Krusch (MGH SS rer. Mer. 5), Hannover 1910, S. 13-24, hier: c. 7, S. 16.
[50] Vita altera S. Wandregisili abbatis, in: AA SS Jul. V, Paris/Rom 1868, S. 272-281, hier: c. 2, S. 272: Cumque adolescentiae polleret aetas in annis, sub praefato rege Dagoberto militaribus gestis ac aulicis disciplinis, quippe ut nobilissimus nobiliter educatus est.
[51] Vita Ermenlandi abbatis Antrensis auctore Donato, ed. Wilhelm Levison (MGH SS rer. Mer. 5), Hannover 1910, S. 682-710, hier: c. 1, S. 684: Parentes autem eius, videntes eum litterarum doctrinis magna ex parte instructum regalibusque miliciis aptum, ab scolis eum recipientes, regiam introduxerunt in aulam atque regi Francorum cum magno cum honore militaturum commendaverunt, quatenus per tramitem huius militiae ad debitum progenitorum perveniret honorem. Zur vermuteten, aber nicht gesicherten Autorenschaft des Donatus, vgl. die Vorbemerkung zur Edition, ebd. S. 674-678 sowie Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, Heft 1: Die Vorzeit von den Anfängen bis zur Herrschaft der Karolinger, bearb. von Wilhelm Levison, Weimar 1952, S. 139.
[52] Einhard, Vita Karoli Magni, ed. Oswald Holder-Egger (MGH SS rer. Germ. i. us. schol. 25), Hannover 1911, ND Hannover 1965., c. 19, S. 23: Liberos suos ita censuit instituendos, ut tam filii quam filiae primo liberalibus studiis, quibus et ipse operam dabat, erudirentur. Tum filios, cum primum aetas patiebatur, more Francorum equitare, armis ac venatibus exerceri fecit [...]. Vgl.: Régine Le Jan, Frankish Giving of Arms and Rituals of Power: Continuity and Change in the Carolingian Period, in: Frans Theuws/Janet L. Nelson (Hgg.), Rituals of Power. From Late Antiquity to the Early Middle Ages (The Transformation of the Roman World 8), Leiden/Boston/Köln 2000, S. 281-309, hier: S. 283-284.
[53] Vgl.: Matthew Innes, „A Place of Discipline“: Carolingian Courts and Aristocratic Youth, in: Catherine Cubitt (Hg.), Court Culture in the Early Middle Ages. The Proceedings of the First Alcuin Conference (Studies in the Early Middle Ages 3), Turnhout 2003, S. 59-76, hier: S. 67. Zur Ausbildung eines Zusammengehörigkeitsgefühls junger adliger Krieger durch gemeinsame „Lerngruppen“, vgl.: Christoph Dette, Kinder und Jugendliche in der Adelsgesellschaft des frühen Mittelalters, in: AKG 76 (1994), S. 1-34, hier: S. 14-16.
[54] Vgl.: Carlrichard Brühl, Hinkmariana, in: Ders., Aus Mittelalter und Diplomatik. Gesammelte Aufsätze, Bd. 1: Studien zur Verfassungsgeschichte und Stadttopographie, Hildesheim/München/Zürich 1989, S. 292-322, hier: S. 296-298; Brigitte Kasten, Adalhard von Corbie. Die Biographie eines karolingischen Politikers und Klostervorstehers (Studia humanoria 3), Düsseldorf 1985, S. 79.
[55] Hinkmar von Reims, De ordine palatii, ed. Thomas Gross/Rudolf Schieffer (MGH Font. iur. Germ. ant. in us. schol. 3), Hannover 1980, c. 27-28, S. 80-82: Et ut illa multitudo, quae in palatio semper esse debet, indeficienter persistere posset, his tribus ordinibus fovebatur. Uno videlicet, ut absque ministeriis expediti milites, anteposita dominorum benignitate et sollicitudine, qua nunc victu, nunc vestitu, nunc auro, nunc argento, modo equis vel ceteris ornamentis interdum specialiter, aliquando prout tempus, ratio et ordo condignam potestatem administrabat, saepius porrectis, in eo tamen indeficientem consolationem nec non ad regale obsequium inflammatum animum ardentius semper habebant: quod illos praefati capitanei ministeriales certatim de die in diem, nunc istos, nunc illos ad mansiones suas vocabant et non tam gulae voracitate quam verae familiaritatis seu dilectionis amore, prout cuique possibile erat, inpendere studebant; sicque fiebat, ut rarus quisque infra ebdomadam remaneret, qui non ab aliquo pro huiusmodi studio convocaretur. Alter ordo per singula ministeria in discipulis congruebat, qui a magistro suo singuli adhaerentes et honorificabant et honorificabantur locisque singuli suis, prout oportunitas occurrebat, ut a domino videndo vel alloquendo consolarentur. Tertius ordo item erat tam maiorum quam minorum in pueris vel vassallis, quos unusq uisque, prout gubernare et sustentare absque peccato, rapina videlicet vel furto, poterat, studiose habere procurabat. Gemäß der Einschätzung von Jakob Schmidt, Hinkmars „De ordine palatii“ und seine Quellen (Frankfurt, Univ., Diss), Gelnhausen 1962, S. 51 gehört dieser Abschnitt zu jenen, bei denen sich Hinkmar an seine Vorlage gehalten haben dürfte.
[56] Dass die expediti milites „the lowest level of the king’s fighting men“ bildeten, wie Bernard S, Bachrach, Early Carolingian Warfare. Prelude to Empire, Philadelphia 2001, S. 66 annimmt, erscheint fragwürdig, da die Inhaber der Hofämter offenbar großes Interesse daran hatten, sich ihrer Freundschaft zu versichern. Bei Personen geringerer Herkunft erscheint ein solches Verhalten unlogisch. Bachrachs Ansicht beruht auf der Übersetzung der Wendung absque ministeriis zu „ohne Diener“. Eine entscheidende Begründung, warum diese Übersetzung der sonst üblichen „ohne Amt“ vorzuziehen ist, sucht man allerdings vergebens, vgl.: ebd., S. 302-303, Anm. 129.
[57] Vgl.: Kasten, Adalhard, S. 82. Vgl. auch: Henri Peltier, Adalhard. Abbé de Corbie (Bulletin des Antiquaires de Picardie, Mémoires 52), Amiens 1969, S. 82.
[58] Vgl.: Bachrach, Early Carolingian Warfare, S. 71-75.
[59] Bachrach, Early Carolingian Warfare, S. 75-76 denkt an einen engen Zusammenhang der erwähnten pueri mit den ebenso bezeichneten unfreien Kriegern der Merowingerzeit. Zwar ist es nicht auszuschließen, dass auf unterer Ebene, gerade bei den minores, auch unfreie Vasallen vorkamen, dies kann aber nicht mit völliger Ausschließlichkeit gesagt werden.
[60] Reynolds, Elopements, S. 342-343 nimmt zurecht an, dass Vasallen eher zu den jüngeren Personen am Hofe gezählt werden müssen.
[61] Vgl.: Kasten, Aspekte, S. 262-263.
[62] Trad. Freis. Nr. 661, S. 556-558. Zur Wahrscheinlichkeit der Identität des dort erwähnten vir nobilis Baldrich mit dem 828 abgesetzten Markgrafen, vgl.: Salten, Vasallität, S. 203-206.
D O W N L O A D (pdf)
Empfohlene Zitierweise
Oliver Salten: Überlegungen zur gesellschaftlichen Relevanz vasallitischer Beziehungen in der Karolingerzeit, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, 22. März 2014, http://mittelalter.hypotheses.org/3278 (ISSN 2197-6120).
Quelle: http://mittelalter.hypotheses.org/3278