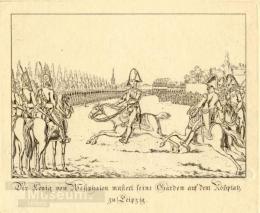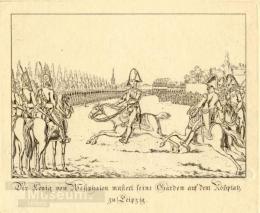
C. G. H. Geißler, Der König von Westphalen mustert seine Garden auf dem Roßplatz, Radierung, 1809, aus:
Kriegsszenen bei und in Leipzig im Juni und Juli 1809, Bl. 9, Leipzig 1810, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Gei IV 22, CC BY-NC-ND 2.0 DE
GStA PK, Berlin, V. HA, Nr. 571, Das Dekret des Königs Jérôme über den Gebrauch der deutschen und französischen Sprache bei den öffentlichen Verhandlungen, März 1808
Quelle:
1 – „Rapport au Roi
Sire
J’ai l’honneur de soumettre à Votre Majesté la proposition de déterminer dans quelle langue seront écrits les actes de son Gouvernement. La langue allemande est la langue naturelle et par conséquence la plus commune des peuples soumis à Votre obéissance. Cependant quatre à cinq dialectes différens et tous fort irréguliers sont répandus dans les diverses parties de Vos Etats, sans qu’on puisse justement déterminer, quel est celui de ces dialectes qui a le plus de faveur et qui en mérite d’avantage.
Le doute est tel à cet égard, que les hommes les plus instruits dans vos conseils reçoivent et se renvoyent réciproquement le reproche de ne pas savoir l’allemand, et qu’on ne peut obtenir une traduction du Bulletin des Loix qui réunisse deux suffrages. Toute fois la langue française est familière dans les états de Brunswick, et n’est pas entièrement étrangère dans la principauté de Hesse et dans les pays démembrés de la Monarchie prussienne. Frédéric 2. avait en effet adopté la langue française pour plusieurs actes [1 verso] actes de son Gouvernement et il y avait eu dans son choix autant de politique que de prédilection. Ce Systême a changé sous son successeur; mais il a duré assez longtems en Prusse, pour que l’usage de la langue française s’y soit conservé. Si J’examinais la question sous le rapport grammatical, je rappellerais à Votre Majesté, que la langue française est la langue des loix et des affaires, parce que son régime sévère et dégagé d’inversions, la rend éminemment claire. Mais Votre Majesté n’a point à choisir entre une langue ou une autre, mais à adopter celle qui lui est indiquée par la politique.
Votre Majesté m’a répété, que le principal objet, qu’elle se proposait, était, de fondre sous une Loi, et un gouvernement unique des peuples soumis à des Loix et à des Gouvernemens divers, et de faire qu’il n’y eût dans son royaume de Westphalie, ni hessois, ni Brunswikois, ni Prussiens, mais des Westphaliens. Le second intérêt de Votre Majesté est de distraire insensiblement ces peuples du souvenir de la Constitution germanique, de ses formes, et de ses usages, et de les rapprocher de la fédération du Rhin par leurs habitudes, comme ils y seront unis par la Politique.
L’adoption de la langue française pour les actes du Gouvernement me semble [2] un moyen puissant de seconder ces deux intérêts. L’Expérience de tous les tems a prouvé, qu’un langage commun est entre les peuples le plus fort des liens; et aujourd’hui même, cette communauté de langage resserrera deux nations, dont les intérêts deviennent chaque jour plus opposés; L’Angleterre et les Etats unis.
Daignez remarquer, Sire, qu’en adoptant dès à présent la langue française pour les actes de son Gouvernement, Votre Majesté n’aura fait qu’avancer de quelques années à l’avantage de ses peuples, une sorte de révolution, que la situation de Westphalie rend indispensable.
Le rêgne de Fréderic, l’Emigration, la guerre, le long séjour des légions, il m’est permis d’ajouter le mérite de la langue française et les chefs d’œuvre en tout genre écrits dans cette langue, l’ont répandue dans le Nord de l’Allemagne. Il y a 20 ans que l’Académie de Berlin couronna un ouvrage où l’on annonçait que cette langue deviendrait celle de l’Europe.
La Confédération du Rhin hâtera l’accomplissement de cette prédiction. La langue française sera parlée dans les diètes, et conséquemment cette langue deviendra celle du nouveau droit public d’Allemagne, ainsi que la langue latine l’était de l’ancien. Mais comme le français aura sur le latin le grand avantage d’être une langue vivante et celle d’un peuple voisin, et du peuple dominant en Europe, il ne se peut pas que la langue admise par le droit public, ne descende au droit [2 verso] droit civile, et ne refonde insensiblement la langue allemande parmi ces dialectes populaires qu’on retrouve par toute l’Europe et même en France.
Ces considérations générales, sire, auraient suffis pour me déterminer à proposer à Votre Majesté, d’arrêter que les actes de son gouvernement seront écrits en français. Mais d’autres considérations particulières s’unissent à celles que je viens de développer.
Des Conseillers d’Etat chargés de la Direction de quelques branches d’administration croyent convenable d’y introduire la lange [sic!] allemande ou de l’y maintenir; et plus d’une fois on m’a exprimé le regret de ce que la langue française était employée dans les bureaux des Ministres.
Je crois, Sire, que ces regrets ne sont pas réfléchis et qu’il y aurait de graves inconvéniens à introduire la langue allemande dans les bureaux ministériels, et à la Trésorerie. Le 1er et le plus sensible de tous consisterait en ce que Votre Majesté ne pourrait pas vérifier par Elle même les actes de son Gouvernement. Ensuite Elle se trouverait insensiblement engagée à n’avoir pour Ministres que des personnes familières avec la langue allemande, ce qui est la même chose que des allemands, et Elle éleverait ainsi entre son Gouvernement & le Systême français une barrière difficile à franchir.
[3] Les partisans de la langue allemande conviennent, que les Départements de la guerre et des affaires étrangères peuvent se servir de la langue française, mais que dans ceux de l’Intérieur, de la Justice et des Finances la langue allemande est indispensable. Cependant il me semble, que, puisque la langue française est seule admise dans vos conseils, elle doit être seule employée par Vos ministres et que s’il y avait entr’eux une différence aussi prononcée que celle qu’on propose, les Ministres qui parleraient allemand, paraîtraient les seuls nationaux et qu’ils auraient trop d’avantage sur les deux autres. Ceux-ci, par cela même qu’ils employeraient la langue française sembleraient étrangers, et seraient chargés de toute la défaveur attaché à cette circonstance.
Cependant, Sire, Je ne me suis pas dissimulé, avec quelles précautions doit être traité un peuple sur lequel on établit une domination nouvelle. Le grand sécret consiste à lui faire perdre ses habitudes, sans paraître les contrarier, et il n’y a pas d’habitude, à laquelle le peuple soit plus justement attaché, qu’à son langage naturel. Je ne propose donc point à Votre Majesté, d’établir par une Loi la Mesure que j’indique, mais par un simple règlement d’administration. Ensuite j’insiste pour qu’on prenne toutes les précautions capables d’en adoucir l’effet par exemple: celles de publier dans les deux langues les Loix et les actes du gouvernement, de laisser l’usage de la langue allemande devant l’assemblée [3 R] l’assemblée des Etats, dans les Tribunaux et les actes pardevant notaire, enfin d’amener la Révolution dans le langage par des moyens insensibles et doux, qui ne contrarient que fort peu vos sujets, et surtout, qui ne les irritent jamais.
Je suis avec un profond respect, Sire
De Votre Majesté.
Le très humble, très obeissant et très devoué Serviteur.
Cassel, ce 19 mars 1808“.
Provenienz:
Bestand des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz
frühere Signatur: GStA PK, V. HA., Rep. I., C., II., Nr. 9
Hauptabteilung V Königreich Westfalen
Rep. I. Akten des Staatssekretariats und des Ministeriums des Aeußern zu Cassel
C. Andere Akten
II. Innere Verhältnisse, Staatsrat etc.
Inhalt: 4 Blätter/2 Dokumente
1. Einsicht: Mai 2001 (CP)
Zur Quelle:
Dieser Bericht an den König Jérôme Bonaparte, Regent im Königreich Westfalen, ging der Entscheidung (im gleichen Aktentitel übermittelt) des Königs über den Gebrauch der deutschen und französischen Sprache bei den öffentlichen Verhandlungen im neuen napoleonischen Staat auf deutschen Territorien. Der Autor des Berichts hat ihn nicht namentlich unterschrieben. Dieser rapport au roi stammt von einem Mitglied des Staatrsrats. Er enthält eine kurze Bestandsaufnahme der verschiedenen im Königreich Westfalen vorhandenen Sprachgemeinschaften udn wägt Vor- und Nachteile des Gebrauches der deutschen und französischen Sprache in der Verwaltung ab.
Der Verfasser stellt zunächst fest, dass die deutsche Sprache in den Trritorien, die das Königreich Westphalen bilden, sehr uneinheitlich war und dass mindestens fünf Dialekte existierten. Die französische Sprache war ihrerseits im Braunschweigischen, im Hessischen und in den preußischen Territorien seit längerem präsent.
Der Autor zählt zunächst Argumente auf, die für die französische Sprache sprechen: Französisch könne identitätsstiftend für die neuen westphälischen Staatsbürger werden, damit sie ihre deutschen regionalen Zugehörigkeit ablegen können. Der Vorteil einer Einheitssprache zur Förderung eines einheitlichen Geistes unter den westphälischen Staatsbürgern sei demnach nicht zu unterschätzen. Die Sprache sei ein Hebel, um die deutschsprachige Bevölkerung peu à peu von den herkömlichen deutschen Gesetzen abzubringen. Der Autor geht so weit, dass er sich durch die sofortige und konsequente Durchsetzung der französischen Sprache in der Verwaltung eine vorteilhafte Revolution verspricht.
Für die französische Sprache im Staatsrat und in den Ministerien spreche, dass nur so der König den Verhandlungen folgen könne. Im entgegengesetzten Fall der Verwendung der deutschen Sprache im Staatsrat und in den Ministeiren würden Deutschsprachige den Vorzug haben und König Jérôme würde zwischen seiner Regierung und dem französischen System eine schwer überwindbare Barriere aufstellen. In diesem Zusammenhang scheut sich der Autor nicht, von unüberwindlichen Sprachbarrieren als Schrekcensvorstellung für das Staatsoberhaupt zu sprechen. Allerdings bezieht sich diese Angst vor sprachlichen Verständigungsproblemen auf das Verhältnis des Königreichs Westphalen zum Kaiserreich Franrekcih, dem der Staat Westfalen seine Gründung politisch verdankte.
Der Autor des Berichts geht ebenfalls auf die Einwände der Befürworter der deutschen Sprache ein. Einige Staatsräte sähen gern die deutsche Sprache in einigen Zweigen der Verwaltung, wogegen der Autor des Berichts große Vorbehalte äußert. Die Befürworter der deutschen Sprache räumten ein, dass das Kriegsministeriums und das Außenministerium sich weiterhin der französischen Sprache bedienen sollten, während sie für die Ressorts des Inneren, der Justiz und der Finanzen die Notwendigkeit der deutschen Sprache betonten. Der Autor rät davon ab, die deutschen Mitglieder des Staatsrats das Sprechen auf Deutsch in diesem zu erlauben, damit sie nicht als die „wahren” nationalen Westphalen im Empfinden der französischen Mitglieder hervorgehen. Der Autor zeigt, dass er durchaus von der Sorge motiviert ist, eine nationale Einheit zu schaffen, und dass er die Sprachenfrage als entscheidenden Motor dafür ansieht.
Im Wesentlichen sollte nach Empfehlung des Berichts die Verwendung der französischen Sprache in der oberen Verwaltung überwiegen. Für die Art und Weise, wie die französische Sprache allmählich die deutsche dominieren sollte, gibt der Autor allerdings recht vorsichtige Anweisungen. Er empfiehlt keine Maßnahme im Bezug auf die Regelung des Sprachgebrauchs in der Verwaltung öffentlich zu treffen, um jegliche Empörung darüber zu vermeiden. Der Berichterstatter schlägt vor, kein Gesetz über die Sprachenfrage zu verabschieden, sondern lediglich ein einfaches Reglement herauszugeben. Als mildernde Maßnahmen rät er, Gesetze und Dekrete stets in beiden Sprachen zu veröffentlichen, der Ständeversammlung – das Königreich Westphalen war die erste konstitutionelle Monarchie auf deutschen Territorien – in der deutschen Sprache debattieren zu lassen, und die deutsche Sprache ebenfalls in den Tribunälen und bei den Notaren zu belassen, um die Westfalen mit der Sprachregelung in der Verwaltung nicht zu verärgern. Dem Berichtserstatter nach solle der König Jérôme die deutsche Sprache pragmatisch zulassen.
Weitere Themen in dieser Quelle:
- nationale Einheitsprache konstitutiv eines Nationalstaats
- Übersetzungsschwierigkeiten in der Regierungspraxis
- Französisch als lingua franca und in der deutschen Aufklärungsgesellschaft
Weiterführend:
Über die Berliner Preisfrage der Akademie der Wissenschaft von 1784, vgl.: Bernd Spillner, „Der gefällige Souffleur“. Franzsösiche Sprache unf ranzsösicher Sprachunterricht im Rheinland, in: Ders. (Hg.), Franzsösiche Sprache in Deutschalnd im Zeitalter der Französischen Revolution, Frankfurt a. M., Berlin 1997, S. 71–106, hier S. 74.
Zitiert/verwendet, in:
Claudie Paye, „Der französischen Sprache mächtig“. Kommunikation im Spannungsfeld von Sprachen und Kulturen im Königreich Westphalen, 1807–1813, München (Oldenbourg) 2013 (Pariser Historische Studien, 100), S. 62–65, 378, 456.
Quelle: http://naps.hypotheses.org/97