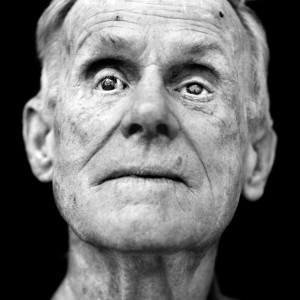Unter Friedrich Wilhelm I. setzte sich zunehmend eine restriktive und allgemein gültige Judenpolitik durch, die durch Friedrich II. weitergeführt und verschärft wird. In den 1710er und 1720er Jahren gab es immer wieder verschärfte Verordnungen und neue Reglements, die sich aber regional sehr unterschieden, da es noch keine einheitliche Verwaltung mit einheitlichem Steuersystem gab (vgl. Stern 1962a, S. 39). Zur Erlangung von Privilegien mussten jüdische Familien immer wieder die eigene Nützlichkeit für den brandenburgisch-preußischen Staat unter Beweis stellen, die jüdischen Familien in einen permanenten Konkurrenzkampf untereinander führte. Friedrich Wilhelm I. kündigte immer wieder an, alle Juden ohne Schutzbrief, die bisher wegen ihrer Akzise sehr willkommen waren, ausweisen zu lassen und ab 1728 grundsätzlich keinen Schutzbrief mehr für die Mark Brandenburg auszustellen (vgl. Schenk 2010, S. 73). Sehr liberal blieb es hingegen noch in Preußen, das als ein wichtiges Transitland für jüdische Händler zwischen Russland, Litauen, Polen, England und Holland geschützt werden musste (vgl. Stern 1962a, S. 66f.). In Berlin wurde die Judenpolitik durch die Edikte von 1700 und 1714 geordnet, das viele Freiheiten gewährte, die allerdings 1730 wieder unterdrückt wurden. Weitere Abschiebungsversuche gab es nach 1735, als der jüdische Handel nach Missernten und einem allgemeinen Konjunktureinbruch durch geringe Nachfrage und steigende Preise teilweise zum Erliegen kam (vgl. Mittenzwei/Herzfeld 1988, S. 262, 256).
Der „Soldatenkönig“, der die Hofausgaben drastisch reduzierte und in das Heer und die Infrastruktur investierte, wollte auch die Judenpolitik vereinheitlichen: Das „General-Privilegium und Reglement“ vom 29. September 1730 sollte erstmalig versuchen für den gesamten Staat die jüdischen Lebensverhältnisse und Wirtschaftsmöglichkeiten neu zu ordnen, was allerdings als der Beginn eines langen Entwicklungsprozesses bis weit in die Regierungszeit Friedrich II. hinein zu verstehen ist und nicht in jeder Provinz sofort durchgesetzt werden konnte (vgl. Stern 1962a, S. 20; vgl. auch Rürup 1995, S. 27f. und Jersch-Wenzel/John 1990, S. 182ff.).
Eine Zäsur war die vermögensabhängige Übertragung des Schutzbriefs auf das erste Kind, die nur wohlhabenden Familien eine Zukunft in Brandenburg-Preußen sicherte und viele jüdische Familien in Existenzangst und Konkurrenz zu einander trieb. Außerdem sollten keine neuen Schutzbriefe mehr ausgestellt, die Anzahl der Juden im ganzen Staat begrenzt, der Handel wieder auf seltene oder Luxuswaren beschränkt und die Abgaben zusätzlich erhöht werden. Die seit 1674 bestehende solidarische Haftbarkeit für die Zahlung von Steuern und Schäden der jüdischen Gemeinden wurde auch auf fremde Juden ausgeweitet (vgl. Jersch-Wenzel/John 1990, S. 285). Das hatte zur Folge, dass die jüdischen Gemeinden daran interessiert waren, dass jüdische Einwanderer ein hohes Vermögen von mindestens 10.000 Reichstaler mitbrachten. Das Reglement führte zu zahlreichen Bittschriften und Beschwerden, sodass es in den Folgejahren einige Überarbeitungen erlebte, bis es unter Friedrich II. revidiert werden sollte. Insgesamt konnte die brandenburgisch-preußische Einwanderungspolitik bis 1740 das Land politisch und wirtschaftlich stabilisieren. Mit dem Regierungsantritt Friedrich II. wird die jüngere jüdische Geschichte in Brandenburg-Preußen rund 70 Jahre alt, sodass die Eingewanderten schon um eine 2. oder auch 3. Generation gewachsen sind und sich vielerorts jüdische Gemeinden etabliert haben.
Am 17. April 1750 wurde durch Friedrich II. ein „Revidiertes General-Privilegium und Reglement, vor die Judenschaft im Königreiche, Preußen, der Chur- und Marck, Brandenburg, den Hertzogthümern, Magdeburg, Cleve, Hinter-Pommern, Crossen, Halberstadt, Minden, Camin und Moers; ingleichen den Graf- und Herrschaften Marck, Racensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Lingen, Lauenburg und Bütau“ (zit. n. Stern 1971b, S. 236/Nr. 102) erlassen, aber auf Bitten der jüdischen Gemeinden, die damit Zeit für mögliche Änderungen gewinnen wollten, erst 1756 veröffentlicht. Dieses General-Privileg baute auf das Reglement von 1730 und den zahlreichen Kabinetsordren, Bittschriften, Eingaben und Resolutionen der Jahre zuvor auf und wurde auch nach Erlass von zahlreichen Änderungsvorschlägen begleitet. Es wurde weiter nach ökonomischen Nutzen systematisiert und erhielt insbesondere nach dem 7-jährigen Krieg neue Zusatzbestimmungen, die weitere Sonderabgaben und Zwangsexporte von Waren forderten, und wurde erst durch das Emanzipationsedikt 1812 annulliert (vgl. Schenk 2010, S. 82ff.; vgl. auch Jersch-Wenzel 1978, S. 92 und Jersch-Wenzel/John 1990, S. 182ff.).
Die jüdische Existenz in Preußen wurde dazu von ihren Kapitalerträgen und ihrem ökonomischen Engagement abhängig gemacht und durch ein komplexes Abgabensystem bestimmt. So wurden alle jüdischen Familien in dem Reglement von 1750 je nach Privilegien in sozialen Klassen statistisch erfasst und als (1) generalpriviligiert, (2) ordentlich, (3) außerordentlich, (4) vergleitet, (5) geduldet oder (6) unvergleitet eingeordnet (vgl. Freund 1912, S. 26; ebenso Battenberg 2001, S. 45f. und Bruer 1991, S. 71f.). Generalprivilegien erhielten nur die kleine Schicht an kapitalkräftigen, ökonomisch wertvollen „Hofjuden“ der 1. Klasse, die den Hof oder das Heer versorgten und von fast allen Beschränkungen befreit waren. Schutzjuden der 2. Klasse hatten immerhin das Recht, ihr Schutzprivileg nach ihrem Tod auch auf die mögliche Witwe oder ihr erstes und zweites Kind zu übertragen. Schutzjuden der 3. Klasse waren dazu nicht befugt und durften nur bei Bedarf und gegen Zahlung von 1000 Reichstalern ihren Schutzbrief aufs ihr erstes Kind übertragen. Später hatten durch die Erhöhung von Abgaben nur noch Familien mit einem großen Einkommen oder mit einem Manufakturbetrieb überhaupt noch Chancen, ihren ordentlichen oder außerordentlichen Schutzbrief, auch auf ihre Kinder zu übertragen, was zu Spannungen innerhalb der jüdischen Gemeinden führte (vgl. Jersch-Wenzel 1978, S. 94, 149, 163). Jüdische Familien der Klasse 4 wurden toleriert und waren meist Gemeindeangestellte, wie Schulmeister oder Rabbiner. Geduldete Familien der Klasse 5 besaßen keinen Schutz und erhielten nur Bescheinigungen, die zeitlich begrenzt waren. Die Klasse 6 bildeten jüdische Familien ohne Schutzbrief, Geleit oder Duldung, sodass diese kein Recht auf Niederlassung besaßen und zur dauernden Wanderung gezwungen waren, wobei sie nur ungern von jüdischen Gemeinden aufgenommen wurden, da diese für sie hafteten. Oftmals werden Juden der Klasse 6 in der Literatur auch als „Betteljuden“ geführt, deren Anteil an der jüdischen Bevölkerung Battenberg für das Jahr 1750 mit 50 Prozent und 1780 sogar mit 90 Prozent angibt. (Vgl. Battenberg 2001, S. 114).
Wie zügig der soziale Abstieg sich beispielsweise vollziehen kann, zeigen Herzfeld anhand von Levin Joseph aus Spandau (vgl. Herzfeld 2001, S. 164ff.) und Schenk am Niedergang des Manasse Jacob aus Bernau (vgl. Schenk 2010, S. 175). Um ihre soziale Situation zu verbessern und Privilegien zu erhalten war für jüdische Familien immer wieder der Nachweis der eigenen (ökonomischen) Nützlichkeit für Preußen unabdingbar. Insbesondere auf den Export legte Friedrich II. sein Hauptaugenmerk und forderte somit einen verstärkten Handel nach Holland, Frankreich, Schweden, Spanien, Portugal, Kursachsen, Russland bis in die Türkei und vor allem in das wirtschaftlich unterentwickelte und innenpolitisch geschwächte Polen. Erlaubt war durch das Generalprivileg von 1750 der Handel mit Luxuswaren, Geldwechseln und Krediten, Immobilien, Manufaktur- und Gebrauchtwaren sowie Textilien, Vieh und Pferden. (Vgl. Freund 1912, S. 40; vgl. auch Battenberg 2001, S. 95)
Zwischen 1723 und 1813 machte die jüdische Erwerbsbevölkerung in Berlin im Handelsbereich 68 Prozent aus, während es in der Gesamtbevölkerung nur 7,4 Prozent waren. Jüdische Männer waren dabei zu 47,5 Prozent im Warenhandel und zu 20,5 Prozent im Geldhandel tätig (vgl. Jersch-Wenzel/John 1990, S. 202ff.. Weitere 5,7 Prozent arbeiteten im Handwerk, 5,7 Prozent im Gewerbe und 14 Prozent im Privat- und Gemeindedienst).
Von ökonomischen Engagement hing somit die jüdische Zukunft in Preußen, aber auch die Zukunft für Preußen ab, denn kein „Staat hat die ökonomische Disziplinierung der Juden so systematisch betrieben und genutzt wie Preußen“ (Bruer 1991, S. 18).
Literatur
Battenberg, J. Friedrich (2001): Die Juden in Deutschland vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Enzyklopädie Deutscher Geschichte. Bd. 60. München.
Bruer, Albert A. (1991): Geschichte der Juden in Preussen (1750-1820). Frankfurt/Main.
Freund, Ismar (2012 [1912]): Die Emanzipation der Juden in Preußen. Bd. 2. Urkunden. Hildesheim.
Herzfeld, Erika (2001): Juden in Brandenburg-Preussen. Beiträge zu ihrer Geschichte im 17. und 18. Jahrhundert. Berlin.
Jersch-Wenzel, Stefi; John, Barbara (1990): Von Zuwanderern zu Einheimischen. Hugenotten, Juden, Böhmen, Polen in Berlin. Berlin.
Jersch-Wenzel, Stefi (1978): Juden und „Franzosen“ in der Wirtschaft des Raumes Berlin/Brandenburg zur Zeit des Merkantilismus. Einzelveröffentlichung der Historischen Kommission zu Berlin. Bd. 23. Berlin.
Mittenzwei, Ingrid, Herzfeld, Erika (1988): Brandenburg-Preußen 1648-1789. Das Zeitalter des Absolutismus in Text und Bild. Berlin.
Rürup, Reinhard (1995): Jüdische Geschichte in Berlin. Bilder und Dokumente. Berlin.
Schenk, Tobias (2010): Wegbereiter der Emanzipation? Studien zur Judenpolitik des „Aufgeklärten Absolutismus“ in Preußen (1763-1812). Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Bd. 39. Berlin.
Stern, Selma (1971b): Der Preussische Staat und die Juden. Dritter Teil/Die Zeit Friedrichs des Großen. 2. Abteilung: Akten. Tübingen.
Stern, Selma (1962a): Der Preussische Staat und die Juden. Zweiter Teil/Die Zeit Friedrich Wilhelms I. 1. Abteilung: Darstellung. Tübingen.
Quelle: http://germanjews.hypotheses.org/46