ANNO nun mit OCR-Suche
http://anno.onb.ac.at/anno-suche/
Geschichtswissenschaftliche Blogs auf einen Blick
Soeben erschienen ist die BMBF-Broschüre
Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und Sozialwissenschaften
http://www.bmbf.de/pub/forschungsinfrastrukturen_geistes_und_sozialwissenschaften.pdf ,
die die Ziele und Aktivitäten des BMBF und der durch das Ministerium geförderten Projekte vorstellt. Sie macht anschaulich, wie zentral langfristig angelegte Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und Sozialwissenschaften sind bzw. sein können. Neben TextGrid und DARIAH werden zudem verschiedene Projekte und Aktivitäten aus der Praxis ebenso wie zukünftige Förderstrategien vorgestellt.
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=1678
Der EHRI Newsletter Mai 2013 ist online mit folgenden Themen:
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=1669
 |
| Die irische Flagge seit 1919 |
.svg/800px-Royal_Standard_of_Ireland_(1542%E2%80%931801).svg.png) |
| Flagge des irischen Königreichs, 1542-1801 |
 |
| Henry Grattan |
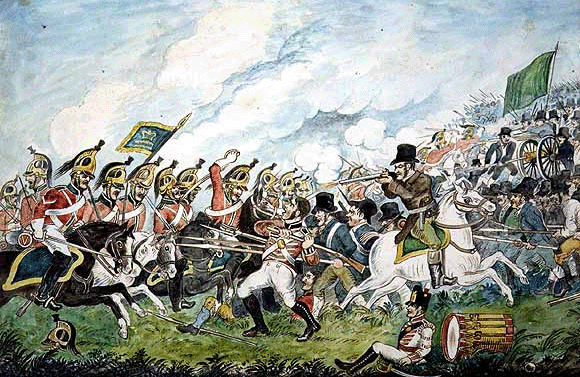 |
| Britische Kavalliere greift bei Vinhill irische Truppen an. |
 |
| Der "Union Jack" mit dem St. Patrick's Cross für Irland |
Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2013/05/irische-geschichte-teil-1-die-geburt.html
Sport ist eine der letzten körperzentrierten Praxen in modernen Gesellschaften und damit ein wichtiger Ort geschlechtlicher Inszenierung. Insbesondere die Struktur des Leistungssports weist eine bis heute kaum in Frage gestellte Geschlechtersegregation auf. Männer und Frauen werden wie selbstverständlich in verschiedenen … Weiterlesen
In der Flugschrift der pommerschen Kriegs-Gravamina von 1630 wird das ganze Panoptikum der Schrecken ausgebreitet, die sich infolge der Einquartierung ergaben. Neben den Exzessen, die die Söldner verübten, werden aber auch Mechanismen deutlich, wie das Militär in diesem Krieg Gewinn machte. Daß Männer sich dafür entschieden, in den Krieg zu ziehen, hatte viel weniger etwas mit Patriotismus oder dem Kampf für die eigene Konfession zu tun; viel mehr spielte das Streben nach Gewinn eine Rolle. Das gilt für den einfachen Söldner genauso wie für den Adligen, der als Offizier diente. Wie ließen sich aber in einem Feldzug Profite erzielen, die den Weg in den Krieg attraktiv erscheinen ließen?
Mehr Geld konnten die Militärs bekommen, indem sie sich einfach über die Kontributionsordonanz hinwegsetzten. So war festgelegt, daß die Gage, die dem Oberst zustand, auch den Anteil enthält, der für die Hauptleute festgeschrieben war (S. 4, Nr. 5). Allerdings hat kein Oberst, Oberstleutnant oder Oberstwachtmeister jemals von seiner Gage einen Hauptmann bezahlt – für diesen mußten eigens Mittel aufgebracht werden, und der Oberst behielt den Hauptmannsanteil für sich. Ähnliches war bei der Bezahlung für den Stab vorgesehen, der aus dem Quantum für die Kompagnie genommen werden sollte. Doch auch dies funktionierte nicht, die Mittel für den Stab mußten extra bezahlt werden (ebd.). Und schließlich wurden die Kompagnien, „wann sie schon nit complet seyn / dannoch vor complet“ bezahlt. Auch wenn die Artillerie gar nicht vorhanden war, mußten für Artillerie Kriegssteuern aufgebracht werden (ebd.).
War dies noch eine plumpe Trickserei bei der Abrechnung der Kontributionen, eröffnete die Eintreibung dieser Kriegskontributionen weitere Möglichkeiten. Laut Gravamen Nr. 7 kam es vor, daß ganze Trupps von Soldaten, „ja wol gantze Compagnien“ ausgeschickt wurden, die „einen geringen Rest / von 1. 2. oder 3. Thalern“ an Kriegssteuern eintreiben sollten (S. 4). Man kann sich leicht vorstellen, daß bei solchen Aktionen die tatsächlichen Ausstände nur den Vorwand boten, um deutlich höhere Werte einzukassieren. Daß diese Verfahren auch nicht ohne Zwang und Gewalt abliefen, machen andere Gravamina deutlich: Dann konnte die Eintreibung der Kontributionen oftmals in reine Plünderungen ausarten, so daß die Salvaguardien, die womöglich von der eigenen Armee ausgestellt worden waren, erst recht nur noch ein Stück Papier waren.
Es ging also nicht immer nur um die großen Kriegsunternehmer, die ganze Regimenter und Armeen für einen Kriegsherrn vorfinanzierten und unterhielten. Auch schon für die unteren Offiziersränge bis hin zu den einfachen Söldnern boten sich hinreichend Gelegenheiten, Profite zu generieren und den Krieg zu einem guten Geschäft zu machen. Daß er vielfach zu derartigen Praktiken gezwungen wurde, weil die regulären Soldzahlungen oftmals monatelang nicht erfolgten, steht auf einem anderen Blatt.
Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/153
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt „Lyrik des hohen Mittelalters. Eine exemplarische elektronische Edition“ (FAU Erlangen-Nürnberg/Univ. Stuttgart) besetzt zum 1. Juli 2013 (oder nach Vereinbarung) befristet für zwei Jahre die Position einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin / eines wissenschaftlichen Mitarbeiters mit 65% der tariflichen Regelarbeitszeit.
Das Projekt steht unter der Leitung von Prof. Dr. Manuel Braun (Univ. Stuttgart), PD Dr. Sonja Glauch und Prof. Dr. Florian Kragl (beide Univ. Erlangen). Es verfolgt das Ziel, mehrere deutschsprachige Minnesang- und Sangspruch-Korpora des 12. und 13. Jahrhunderts neu aus den handschriftlichen Quellen herauszugeben, und zwar in Form einer frei verfügbaren Online-Ausgabe. Deren technische Umsetzung wird ebenfalls im Rahmen des Projekts entwickelt.
Wir suchen daher für die Konzeption und Programmierung der Strukturen der digitalen Edition (Eingabeoberfläche, Datenbankabfragen, Weboberfläche, Datenstrukturen und -transformationen) eine/n in den Digital Humanities versierte/n Mitarbeiter/in.
Voraussetzungen:
Erwünscht (aber nicht Voraussetzung) ist die Anfertigung einer Dissertation im thematischen Umfeld des Projekts.
Der Dienstort ist entweder Erlangen oder Stuttgart (bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung an, an welchem Ort Sie arbeiten möchten). Weitere Auskünfte können bei den Projektleitern eingeholt werden.
Schwerbehinderte Bewerberinnen oder Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Die Universitäten Erlangen und Stuttgart fördern die berufliche Gleichstellung der Frauen. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen sind darum ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.
Beabsichtigte Eingruppierung je nach Qualifikation und persönlichen
Voraussetzungen:
Entgelt-/Bes.Gr.: E 13 TV-L (65%)
Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Nachweisen bzw. Referenzen bisheriger IT-/Programmier-Projekte und einer Skizze zum Profil der geplanten wissenschaftlichen Weiterqualifikation bzw. zum
Dissertationsvorhaben (max. 2 Seiten) sind – nur elektronisch – bis
zum 24.05.2013 zu richten an: stelle@lhm-online.de
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Manuel Braun
Universität Stuttgart
Abteilung für Germanistische Mediävistik
Keplerstraße 17
70174 Stuttgart
Tel.: 0711 / 685-83080
Fax: 0711 / 685-83078
E-Mail: manuel.braun@ilw.uni-stuttgart.de
PD Dr. Sonja Glauch und Prof. Dr. Florian Kragl
Universität Erlangen-Nürnberg
Department Germanistik und Komparatistik
Bismarckstr. 1
91054 Erlangen
Tel.: 09131 / 85-22423 (Glauch)
Tel.: 09131 / 85-29354 (Kragl)
Fax: 09131 / 85-26997
E-Mail: sonja.glauch@ger.phil.uni-erlangen.de
E-Mail: florian.kragl@ger.phil.uni-erlangen.de
Homepages:
http://www.mediaevistik.germanistik.phil.uni-erlangen.de
http://www.uni-stuttgart.de/germed/
PDF-Version der Ausschreibung:
http://www.mediaevum.de/ausschreibungen/LHM_stellenausschreibung2.pdf
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=1666
Im Rahmen der universitätweiten Gedenkwoche aus Anlass der Bücherverbrennung vor 80 Jahren befassen sich alle (oder zumindest viele) Seminarsitzungen des Instituts für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin diese Woche in irgendeiner Weise mit der Bücherverbrennung bzw. mit der damit zusammhängenden Erinnerungsarbeit.
Wir haben also heute einen kleinen Abstecher über die Wikipedia-Artikel zur Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 in Berlin gemacht. Mein einziges klares Ziel war dabei, die deutsche Fassung mit den anderen Sprachversionen zu vergleichen. Was darüber hinausgehen konnte, wusste ich nicht so recht.
Ich hatte ich mir vorgestellt, dass wir einen solchen Artikel in all den im Seminar vertretenen Sprachen vorfinden würden: englisch, italienisch, spanisch, französisch. Nun stellte sich heraus, dass es keine spanische Version gibt, dass die französische Version eine Übersetzung der deutschen Fassung ist (mit einigen Übersetzungsfehlern und ohne die Passagen über Magnus Hirschfeld) und dass die italienische Version ebenfalls eine Übersetzung ist, diesmal der englischen Version, die wiederum unter dem Titel “Nazi book burning” Farbe bekennt und dennoch einen Absatz zu Bücherverbrennungen während der “Denazification” enthält. Dass die Erinnerungsarbeit sich in all diesen kulturellen Zusammenhängen anders entwickelte, damit war wohl zu rechnen. Umso erstaunlicher schien mir die Tatsache, dass es neben der deutschsprachigen und der englischsprachigen Doxa keine Alternative zu geben scheint.
Nach einer Dreiviertel Stunde äußerten die Studenten den Wunsch, die Artikel zu ergänzen. Selbst dem langen, offensichtlich bereits stabilen deutschen Artikel fehlten Quellenangaben, nach denen recherchiert wurde. Es wurden in den weniger umfangreichen Artikeln Informationen aus dem deutschen Artikel eingebaut. Im allgemeinen Artikel über Bücherverbrennungen, den die spanische Wikipedia vorliegen hatte sowie in demjenigen der türkischen Wikipedia – ein äußerst karger Eintrag – wurden neue Absätze zur Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 in Berlin eingebaut.
Immer wieder wurde die deutsche Fassung als Orientierungspunkt herangezogen. Ich musste mich selbst ob der Genauigkeit dieses Artikels wundern. Und wie dort den so bekannten, symbolträchtigen Vorstellungen und Bildern entgegengearbeitet wird, etwa durch die Präzision der Schilderung der Vorbereitungen. Und durch die wiederholte Angabe, dass es regnete und regnete, in Berlin und in den anderen Städten auch, und das Feuer nicht starten wollte.
Zur Arbeit an den genannten Einträgen werden studentische Beiträge folgen.
Die Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins sucht
eine Doktorandin oder einen Doktoranden,
die/der in einem kleinen, interdisziplinären Team eine Datenbank zu historischen Personen, Orten und Begriffen – und Beziehungen zwischen ihnen – mit Verweisen auf die Quellentexte der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ) entwickelt.
In der Sammlung wird rechtshistorisches Quellenmaterial aus allen Teilen der Schweiz vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit (1798) in den verschiedenen Landessprachen sowie Latein ediert. Die Daten der SSRQ zeichnen sich durch ihre Komplexität aus: Zunächst hat praktisch jede Entität mehrere Namen bzw. Namensvarianten. Zweitens haben viele Daten eine zeitliche Dimension. Drittens gibt es eine Vielzahl von Beziehungen zwischen allen Entitäten. Die Datenbank soll es ermöglichen, alle relevanten Informationen in strukturierter Form zu erfassen und abzufragen.
Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Themenkreis mit dem Ziel der Promotion wird erwartet. Die Finanzen sind für eine dreijährige Projektzeit gesichert.
Qualifikationen:
Aufgaben:
Arbeitgeberleistungen:
Vorgesehener Projektbeginn: Sofort oder nach Vereinbarung
Bewerbungsunterlagen: CV, Zeugnisse und Verzeichnis der absolvierten Kurse senden Sie bitte an Dr. Pascale Sutter, Leiterin der Rechtsquellenstiftung (pascale.sutter@ssrq-sds-fds.ch), die Ihnen auch für weitere Informationen gerne zur Verfügung steht.
Bewerbungsfrist: Ab sofort, Dossiers werden laufend geprüft
Arbeitgeber: Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins, in enger Zusammenarbeit mit Professor Abraham Bernstein, Institut für Informatik UZH, und Professor Martin Volk, Institut für Computerlinguistik UZH
Aufgabe: Realisierung einer Datenbank zu historischen
Personen, Orten und Begriffen
Arbeitsort: Universität Zürich, Zürich, Schweiz
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=1655
Am 25.4. veröffentlichte die finnische Armee über 160 000 sog. TK-Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg im Internet. Diese Fotos sind während des Winter- (1939/40) und Fortsetzungskriegs (1941–44) von offiziellen Fotografen der finnischen Armee aufgenommen worden. Sie umfassen sowohl Kriegsfotos von der Front als auch solche von der Heimatfront.Die Fotos sind für jeden Interessierten unter der Adresse www.sa-kuva.fi zugänglich und können als druckfertige Dateien heruntergeladen werden. Das Digitalisierungsprojekt, welches 3,5 Jahre gedauert hat, wurde am nationalen Feiertag der Veteranen bekanntgegeben und erweckte sofort so großes Interesse, dass die Internetseiten erneut geschlossen werden musste, weil die Server unter der Belastung zusammenbrachen. Inzwischen funktioniert die Webseite wieder.
Dieses Großprojekt hat dazu geführt, dass Finnland momentan die Führungsposition hat, was den Onlinezugang von bedeutenden Bildarchiven angeht. Nirgendwo sonst in der Welt gibt es ähnlich umfassende kostenlose Bildarchive: z.B. in Deutschland kann zwar ein Teil der deutschen PK-Fotos (PK=Propagandakompanie) auf der Webseite des Bundesarchivs angesehen werden, aber druckfertige Versionen sind immer noch kostenpflichtig. Vielleicht regt das Beispiel Finnlands auch andere Länder an, ihm Folge zu leisten.
Die finnische Armee macht deutlich, dass die Informationen zu den Bildern in manchen Fällen Fehler oder Lücken enthalten und das man um diese weiß. Zwar haben die Informationsblätter zu den Fotos den Krieg überlebt, und diese Informationen wurden beim Digitalisieren als Bildertexte angegeben, doch enthalten diese Papiere eben Fehler, welche jetzt einfach übernommen wurden. Um diesem Manko entgegenzuwirken, gibt es im Portal ein digitales Formular, das die Zusendung von zusätzlichen Informationen ermöglicht. Die zugeschickten Informationen werden geprüft und gegebenfalls übernommen. Somit wird dieses Bildarchiv möglicherweise im Laufe der Zeit zu einer nationalen Wikipedia der Kriegsfotos.
Was ich persönlich aber als problematisch empfinde, ist die Entscheidung der Armee, die etwa 200 grausamsten Fotos, die Leichen o.Ä. zeigen, nicht im Archiv zu veröffentlichen. Zwar können diese Bilder weiterhin in der Bildstelle der Armee angesehen werden, aber da ein Teil der Bilder bereits auf diversen Websites zu finden ist, wäre es wohl möglich gewesen, diese Bilder zu veröffentlichen, damit sie nicht gefundenes Fressen für verschiede Verschwörungstheoretiker werden können. Sollte man mit dieser Selbstzensur Kindern vor schrecklichen Bildmaterial schützen wollen, wäre es aber technisch durchaus möglich, eine getrennte, passwortgeschützte Archivseite aufzubauen, auf der diese Fotos gezeigt werden könnten. Der einmal gültige Zugangscode könnte automatisch nach Angabe des Geburtsdatums zugeschickt werden.
Beispiel für eine Bildrückseite mit Notizen
Foto: Olli Kleemola
Natürlich vermisse ich auch die im Internetarchiv fehlenden Bildrückseiten (siehe Abbildung). Um die bestmögliche Bildqualität zu erreichen, wurden die Bilder von den Negativen digitalisiert. Das ist auch gut so, aber dabei wurde leider übersehen, welche Fülle an Informationen die Originalabzüge der Bilder, die immer noch in der Bildstelle der Armee aufbewahrt werden, enthalten. Auf den Rückseiten der Abzüge gibt es Stempel, die zeigen, ob das Bild von der Zensur genehmigt wurde oder nicht. Es gibt auch Markierungen, die offenbaren, wohin das Bild für Veröffentlichung geschickt wurde. Weiter gibt es öfters auch propagandistische Bildtitel, die von der Zensurbehörde anhand der Hintergrundinformationen geschrieben wurden, und die sonst nirgends überliefert sind. Wenn man die Abzugsrückseiten auch scannen und ins Netz stellen würde, ließe sich das Archiv noch besser zu Forschungszwecken verwenden.
Hierbei ist aber anzumerken, dass das Archiv bereits jetzt eine wahre Goldgrube für Historiker ist. Wenn man bedenkt, dass die finnischen Kriegsfotografen keine reinen Propagandisten waren, sondern auch viel kulturgeschichtlich und volkskundlich wertvolles Material produziert haben, wird einem klar, dass die Verwendungszwecke des Fotoarchivs beinahe grenzenlos sind!