Elke Gryglewski führte im Rahmen ihrer Promotion zwei, mehrmonatige Projekte mit Berliner Jugendlichen mit arabisch-palästinensischer und türkischer Herkunft durch.
Quelle: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Online-Lernen/content/12098
Geschichtswissenschaftliche Blogs auf einen Blick
Elke Gryglewski führte im Rahmen ihrer Promotion zwei, mehrmonatige Projekte mit Berliner Jugendlichen mit arabisch-palästinensischer und türkischer Herkunft durch.
Quelle: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Online-Lernen/content/12098
Am 17.10.2014 fand an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen das zweite Treffen des Stakeholdergremiums „Wissenschaftliche Sammlungen“ statt.
Das Expertengremium dient als regelmäßiges Plenum des Austausches zwischen Geistes- und KulturwissenschaftlerInnen, BibliothekarInnen, ArchivarInnen und InformationswissenschaftlerInnen, um fachwissenschaftliche Anforderungen an digitale wissenschaftliche Sammlungen zu artikulieren.
Die beim ersten Treffen im JuIi diskutierten theoretischen, methodischen und begrifflichen Themenkomplexe wurden als Ausgangspunkt genutzt, von dem aus konkrete Pläne entwickelt werden konnten, dieses wichtige Thema auch über den kleinen Kreis der Fachleute hinaus zu akzentuieren und grundlegende Strategien zu entwickeln. Das beim ersten Treffen erarbeitete Arbeitskonzept „Sammlung“ wurde in der Runde finalisiert und konkrete Schritte zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Sammlungen in den Geistes- und Kulturwissenschaften beschlossen. Mehr…
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4217
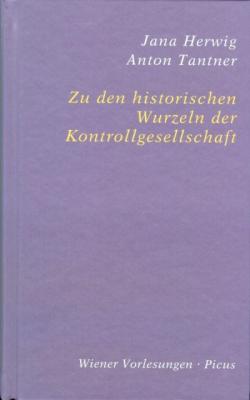
Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022221918/
Für die Erforschung der Wiener Handwerksgeschichte des späten Mittelalters haben sich nicht allzu viele verschiedene Quellen erhalten. Neben verstreuten Einträgen von Handwerksordnungen in den sogenannten Testamentenbüchern und einzelnen erhaltenen Urkunden des Wiener Stadtrates beziehungsweise der habsburgischen Landesfürsten ist es vor allem eine Handschrift des WStLA, die in diesem Zusammenhang Beachtung finden muss: das sogenannte „Wiener Handwerksordnungsbuch“.
Dieser Kodex wurde im Jahre 1430 durch den damaligen Wiener Stadtschreiber Ulrich Hirssauer (im Amt von 1429 bis 1461) angelegt; Hirssauer sammelte zu diesem Zweck Handwerksordnungen, die er in älteren Stadtbüchern oder als Einzelurkunden finden konnte, ordnete sie nach Handwerkssparten und stellte diese Texte erstmals in einem Band zusammen. Mit einer Anzahl von über 100 verschiedenen Handwerksbranchen war im Wien des 15. Jahrhunderts die diesbezügliche Vielfalt offenbar bereits zu groß geworden, um den Überblick über die einzelnen Ordnungen noch in anderer Form bewahren zu können. Hirssauer selbst führte die Einträge in die Handschrift noch bis zu seinem Tod 1461 weiter, doch auch in den folgenden Jahrzehnten nahm die Eintragstätigkeit nicht ab: Die jüngste Ordnung stammt aus dem Jahre 1555, doch finden sich noch einzelne Ergänzungen, Anmerkungen und Verbesserungen bis weit in das 17. Jahrhundert hinein. Somit ergibt sich in Summe eine Sammlung an unterschiedlichen Rechtstexten, die Handwerksordnungen, Ratsbeschlüsse, Bürger- und andere Amtseide und auch Ordnungen zur Stadtsicherung umfasst. Insgesamt enthält der Kodex 225 Papierblätter mit acht dem Papierbuchblock vorgebundenen Pergamentblättern, auf denen diverse Eide eingetragen wurden. Weiters findet sich auf einem nachgebundenen Pergamentblatt (fol. 233) eine Fronleichnamsprozessionsordnung.

HWOB fol. A0v; Notiz über die Anlage des Handwerksordnungsbuches im Jahre 1430 durch Ulrich Hirssauer (Bildrechte: WStLA).
Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte durch Josef Feil eine ausführlichere Auseinandersetzung mit der Handschrift, ebenso beschäftigte sich Karl Uhlirz eingehend mit den im HWOB enthaltenen Texten. Als Standardwerk zur Wiener Handwerksgeschichte gilt auch heute noch die Monographie von Heinz Zatschek. In den letzten Jahrzehnten erschienen nur mehr einige wenige Aufsätze – beispielsweise von Ferdinand Opll − über einzelne Aspekte des HWOB.
Dass aus einer tiefergehenden Analyse der im HWOB enthaltenen Texten jedoch auch heute noch umfangreiche Erkenntnisse über einzelne Berufsgruppen des Handwerks gewonnen werden können, zeigt eine erst kürzlich am IÖG fertiggestellte Masterarbeit, in der das Wiener Gesellenwesen des 15. und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts genauer besprochen wird. Die die Gesellen betreffenden Bestimmungen setzen vermehrt mit dem beginnenden 15. Jahrhundert ein und nehmen besonders um und nach 1430 in ihrer Anzahl stark zu. Zu Beginn bezogen sich die Ordnungen vor allem auf arbeitsrechtliche Fragen; zwischen den Wiener Handwerksmeistern und ihren Gesellen sind ab den 1410er Jahren merkbare Differenzen über das richtige Verhältnis von Arbeits- und Freizeit und die Frage des Nebenverdienstes, des sogenannten Schoßwerks, nachweisbar. In diese Zeit dürfte auch eine erstmals zunehmende Aktivität der Interessensvereinigungen von Gesellen (Gesellenschaften) fallen, deren Vorstände die Forderungen ihrer Kollegen vor den Meistern vertraten. Die Auseinandersetzungen wurden im Jahre 1439 vorerst durch den Wiener Rat mit dem Erlass einer allgemeinen Gesellenordnung beendet, die die meisten Konfliktpunkte der vorigen Jahrzehnte aufgriff. Wenngleich die Bedeutung dieser allgemeinen Gesellenordnung nicht überschätzt werden darf, so scheint sie doch den Grundstein für die weitgehende Durchsetzung von Gesellenschaften in Wien gelegt zu haben; nach 1439 nimmt die Zahl der bruderschaftlich orientierten Gesellenordnungen jedenfalls stark zu. Diese Ordnungen beziehen sich vor allem auf religiös-karitative Aspekte im alltäglichen Leben der Gesellen wie beispielsweise die regelmäßige Organisation von Heiligen Messen, die – meist finanzielle – Unterstützung kranker Kollegen, die Abhaltung von Begräbnissen und die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession. Als weiterer Schwerpunkt lassen sich Bestimmungen zum öffentlichen Verhalten von Gesellen feststellen: Glücksspiele, Betrinken im Wirtshaus oder bei Gesellenfeierlichkeiten, Streitigkeiten, frevelhaftes Verhalten gegenüber Frauen und der Umgang mit Prostituierten waren streng untersagt und wurden teilweise mit hohen Strafzahlungen belegt. Im 15. Jahrhundert finden sich ebenso Hinweise auf die Verpflichtung von Gesellen, Wachdienste und sonstige Stadtverteidungsaufgaben zu übernehmen.
Diese knapp erläuterten Erkenntnisse der Studie wurden vor allem auf Grundlage einer Edition aller im HWOB enthaltenen gesellenbezogenen Ordnungen gewonnen, die der Masterarbeit als Anhang beigegeben ist; erstmals sind somit alle Gesellenordnungen des HWOB in edierter Form versammelt. Eine Gesamtedition des HWOB kann jedoch als dringendes Forschungsdesiderat angesehen werden. Zwar wurden im Zusammenhang mit Studien zu einzelnen Wiener Handwerken ausgewählte Ordnungen bereits in der Vergangenheit abgedruckt, umfangreiche Editionen blieben jedoch weitgehend aus. Von der bereits im Zuge der Masterarbeit erfolgten Edition der Gesellenordnungen ausgehend, ist nun eine umfangreich kommentierte Gesamtedition des HWOB im Entstehen, die in der Reihe „Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (QIÖG)“ erscheinen soll. Die Benützung der Edition wird durch ein Sach-, Personen-, und Ortsregister vereinfacht, ein Glossar erläutert häufig in den Ordnungen auftretende Begriffe beziehungsweise – soweit identifizierbar – Handwerksstücke. Eine umfassende Einleitung stellt zudem die Texte in einen breiteren handwerks- und stadtgeschichtlichen Kontext und sorgt somit für erste Anhaltspunkte der Interpretation. Die damit erstmalig in einem einzigen Band edierten Ordnungen werden somit einem breiten Forschungskreis zur Verfügung gestellt, wodurch eine weiterführende Beschäftigung mit der in den letzten paar Jahrzehnten etwas vernachlässigten Wiener Handwerksgeschichte ermöglicht werden soll.
Quelle: http://bioeg.hypotheses.org/380
Trotz der Vernetzungen von Wissensgebieten und Institutionen war der institutsübergreifende Austausch zwischen jungen HandschriftenbearbeiterInnen und -forscherInnen in Österreich bisher vor allem auf zufällige persönliche Kontakte beschränkt. Um diese Situation und damit den Erfahrungsaustausch zu verbessern, wurde im September 2014 an der Universität Wien das erste Praedoc-Treffen: Österreichische Handschriften veranstaltet.
Ziel dieses ersten Treffens war es, Praedocs aus unterschiedlichen Fachrichtungen, die sich mit österreichischen mittelalterlichen Handschriften beschäftigen oder in österreichischen Katalogisierungsprojekten beschäftigt sind, an einem Ort zusammenzubringen und die einzelnen Forschungsschwerpunkte kurz vorzustellen. Wenn aus Termingründen auch nicht alle Interessierten nach Wien kommen konnten, zeigten die Vorträge und die schriftlich eingegangenen Projektbeschreibungen doch die große Anzahl an JungforscherInnen, die an der Aufarbeitung und Erforschung des österreichischen Handschriftenerbes arbeiten.
In der Diskussion wurde deutlich, wie gewisse Fragestellungen und Problemfelder unabhängig vom Fach die Arbeit leiten oder erschweren. Zu ihnen zählten Fragen nach Wechselwirkungen und Beziehungen zwischen einzelnen Klöstern, Probleme mit validen Datierungskriterien für Handschriften oder – auf ganz praktischer Ebene – auch die Zugänglichkeit und der Erschließungsgrad der Bestände. Über Fach- und Institutionsgrenzen hinaus konnte so im freien Austausch mit KollegInnen lebhaft über unterschiedliche Zugänge, Erkenntnisse und Frustrationen diskutiert werden.
Für die Zukunft sind weitere Treffen geplant, die sich auch spezielleren Forschungsproblemen widmen können.
Weitere InteressentInnen können sich gerne mit einer kurzen Projektbeschreibung melden:
TeilnehmerInnen/Interessierte am Praedoc-Treffen:
Isabella Buben – MA-Arbeit: Kräuterglossar mit ahd. Interpretamenten Hs 2169 Liber medicinalis (Salzburg Museum)
Soňa Černá, ÖAW – Dissertationsprojekt: John of Neumarkt: Transmission, reception and literary and social contexts of literary works written in German
Nikolaus Czifra, ÖAW – Projektmitarbeiter: Manuscripta mediaevalia Gottwicensia
P. Viliam Stefan Dóci OP – MA-Arbeit: Beschreibung der 15 ältesten Handschriften der Dominikanerbibliothek in Wien
Alexander Hödlmoser, Universität Wien – Dissertationsprojekt: Die Österreichische Chronik der Jahre 1454 bis 1467; Projektmitarbeiter: Die Bibliothek als Text. Bestand und Bestandsgeschichte der Stiftsbibliothek Kremsmünster
Christina Jackel, Universität Wien – Dissertationsprojekt: Bestand und Bestandsgeschichte der deutschsprachigen Handschriften in der Stiftsbibliothek Kremsmünster
Edith Kapeller – MA-Arbeit: Cod. 1253 der Stiftsbibliothek Klosterneuburg und Cod. 365 (rot) der Stiftsbibliothek Göttweig. Zwei „Belial“-Handschriften des 15. Jahrhunderts und ihr Bezug zum Weltende
Katharina Kaska, Universität Wien – Dissertationsprojekt: Texttransfer und Buchaustausch – Netzwerke monastischer Handschriftenproduktion am Beispiel des Zisterzienserstifts Baumgartenberg in Oberösterreich
Severin Matiasovits, Institut für Österreichische Geschichtsforschung – Projektmitarbeiter: Die virtuelle Bibliothek der Kartause Gaming
Irina von Morzé, ÖAW – Dissertationsprojekt: Die Krumauer Sammelhandschrift aus der Prager Bibliothek des Nationalmuseums III B 10 (um 1420) und die mit dieser Werkstatt in Verbindung stehenden Handschriften; Projektmitarbeiterin: Katalogisierung der illuminierten Handschriften: Ostmitteleuropa
Rita Maria Neyer, ULB Tirol – Dissertationsprojekt: Einleitung, Übersetzung, Kommentar und Edition eines Teils von Codex Innsbruck, ULBT 664 (Codex „Fuxmagen“); Projektmitarbeiterin: Katalog der Handschriften der ULB Tirol
Lena Sommer, Universität Hamburg – Dissertationsprojekt: Layout und Wissensvermittlung in zwei österreichischen Legendaren (Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek, Csc. 11-14; Zwettl, Stiftsbibliothek, Cod. Zwetl. 13-15, 24)
Christina Weiler, Universität Wien – Dissertationsprojekt: Meditationes Vitae Christi – Die Visualisierungsstrategien in illustrierten Trecento Manuskripten; Projektmitarbeiterin: Katalogisierung der illuminierten Handschriften des 14. Jahrhunderts in der UB Graz
Sophie Zimmermann, Universität Wien – Dissertationsprojekt: Imaginierter Buchverlust in mittelhochdeutschen Texten (Arbeitstitel); Projektmitarbeiterin: Handbuch der deutschen Glossen und Texte in Geheimschrift
Quelle: http://bioeg.hypotheses.org/566
Der (Wohlfahrts-)Staat erfüllt in der kapitalistischen Gesellschaft die Funktion gesellschaftlicher Regulierung. Indem er Ein- und Ausschlüsse moderiert sowie soziale Herrschaftsverhältnisse bearbeitet und zum Teil reproduziert, trägt er zum Fortbestand kapitalistischer Demokratien bei. Mittels welcher Instrumente der Staat die sozialen Verhältnisse … Continue reading →
Der (Wohlfahrts-)Staat erfüllt in der kapitalistischen Gesellschaft die Funktion gesellschaftlicher Regulierung. Indem er Ein- und Ausschlüsse moderiert sowie soziale Herrschaftsverhältnisse bearbeitet und zum Teil reproduziert, trägt er zum Fortbestand kapitalistischer Demokratien bei. Mittels welcher Instrumente der Staat die sozialen Verhältnisse … Continue reading
Conventional wisdom on the teaching of history in Mexico holds that the problem of learning is that today’s young people only think about the present and they are incapable of assessing the past and the future…
Conventional wisdom on the teaching of history in Mexico holds that the problem of learning is that today’s young people only think about the present and that they are incapable of assessing the past and the future. To remedy this, study programs now focus on developing various historical thinking skills grounded in the scientific work of historians. However, I believe this approach is based on an erroneous appraisal of youth and excludes other ways of using history.
Tepoztlán is a town whose long history makes its presence felt. Not far from Mexico City, it was declared a National Park in 1937. A pilgrimage zone from pre-Hispanic times, it has paramount sixteenth-century titles to communal lands and it fought together with Emiliano Zapata in the Mexican Revolution of 1910. The townspeople put up a united front to oppose a forest clearing project in the 1930s that threatened to devastate the nearby forests and fought against an aerial tramway (1979), a prison (1979), a beltway (1986), a scenic train (1990), and the construction of a golf course that planned to replace agricultural lands with an exclusive residential zone in 1995. Six years later, the town hosted the Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN: Zapatista National Liberation Army). It is both a Mexican and a cosmopolitan town.
As part of a project aimed at connecting both oceans[1] and given the saturation of the toll highway—especially on weekends—that passes on one side of Tepoztlán, federal and state governments started an expansion project in 2011. Popular resistance to the project was organized and when construction work began in 2013, a group of townspeople staged a sit-in, setting up the “Caudillo del Sur” camp—in Zapata’s honor—for sustained civil disobedience to put a stop to the work. Their argument is that the new road will expropriate land, harm the environment, and change the local population’s lifestyle. In July that same year, the state government used force, violently razing the camp. The Frente Unido en Defensa de Tepoztlán (FUDT; United Front in Defense of Tepoztlán) decided to pursue the legal route and managed to temporarily halt construction. Now the resolution of the problem is mired in the swamps of the Mexican judicial system.
The Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán (FJDT; Youth Front in Defense of Tepoztlán) is part of the FUDT. It is composed of a diverse group of young people whose identity is defined to a large extent by their rural background. They conduct peaceful protests and actively spread their ideas on blogs and social networks. Their expressions of protest wield history as a central part of their arguments. What stands out, however, is their historical-graphic discourse, which decorates the walls of the town and those of the neighboring communities. These wall paintings depict the idealized pre-Hispanic past and reject capitalism, governmental institutions, and the violence of authorized crime (that is, violence exerted or permitted by the state).[2] The FJDT’s historical narrative is a discourse of resistance. As age-old heirs, they believe their “experience does not begin with this struggle. It began years ago when we saw our fathers and our grandfathers organize to defend the town to the pealing of the church bells.”[3] They took their stand on nation, youth, identity, ecology, history, and religion in a single resistance movement. Of course, this has nothing to do with the historical thinking of historians that they should be acquiring at school.
Perhaps the most significant representation of the use of history as a political tool is FJDT mural painting. Full of contrasting bright colors, the walls of houses tell stories that look at the past and address the future. One of the murals shows a painting—which in the eyes of art critics might be tagged with the deficient label of naïve art—of the repetition of history, where the past is like the present, both in its devastating power and in its restoration of hope. It depicts Nahua eagle warriors clashing with Spanish conquerors. Then it shows a businessman stealing money, destroying the forest, and fleeing on the highway, while other pre-Hispanic warriors confront him. On another mural, a capitalist who declares progress confronts a chinelo, a Carnival dancer, who is exclaiming “culture” while clutching his machete. The dichotomy seems simple, but in reality what we have is an ambivalent process in which two different temporalities are opposed and at the same time are formed thanks to the other. For the businessman, the future, evolutionary and universal, lies ahead; for the chinelo and pre-Hispanic warriors, the future lies behind and before them: it is the conservation and transformation of the past composed of culture and nature. Both need the other, one to dominate and the other to resist.
FJDT youth have been accused of everything: being ninis (NEETs), agitators, fundamentalists, and enemies of progress. If we add to this the conception of young people held by the developers of the state school history curriculum,[4] namely, that FJDT members live only for the moment, without any awareness of the past and future, the resistance against the Tepoztlán highway may seem to be nothing more than a protest staged by a group of young misfits incapable of thinking historically. However, if the struggle against the highway is seen as a battle against temporal typologies (civilized versus primitive, modern versus peasant) [5], we might be able to understand how legitimate uses of history are also a substantial part of political participation.
These uses, normally excluded in the classroom, will continue to drive the struggle to promote the social and symbolic inclusion of different cultures in Mexico and to ensure that there is history beyond Braudel.
____________________
Literature
External links
____________________
[1] Within this mega-project, other development plans include a thermoelectric plant in Huexca, Morelos, and a gas pipeline crossing the states of Puebla, Morelos, and Tlaxcala. The towns in this valley also oppose these projects.
[2] This is not the only important youth movement. In addition to #yosoy132, which fights for the democratization of the media, another similar movement in defense of forests against illegal logging is composed of the indigenous youth of Cherán, Michoacán.
[3] Romero, Carolina (2012) “En Tepoztlán los pueblos se organizan en defensa de la tierra, el agua y el aire” at http://www.anarkismo.net/article/23686 (last accessed 24.10.2014)
[4] Lima, Laura; Bonilla, Felipe; Arista, Verónica (2010) “La enseñanza de la historia en la escuela mexicana.” Proyecto Clío (Barcelona) 36.
[5] Vargas Cetina, G. (2007) “Tiempo y poder: la antropología del tiempo,” Nueva Antropología, vol. 20, no. 67, May, 2007, pp. 41–64. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15906703 (last accessed 24.10.2014)
____________________
Image Credits
© Frente Juvenil En Defensa De Tepoztlán, 2014. https://www.facebook.com/FJDTepoz/photos/a.498856276794339.123068.497297213616912/729932403686724/?type=3&theater.
Recommended Citation
Plà, Sebastiàn: Youth, Resistance, and Public Uses of History in Mexico. In: Public History Weekly 2 (2014) 37, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-2779.
Copyright (c) 2014 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.
Nach gängiger Meinung über den Geschichtsunterricht in Mexiko liegt das Problem mit dem Lernen von Geschichte darin begründet, dass die Jugend von heute nur über die Gegenwart nachdenkt und unfähig ist, Vergangenheit und Zukunft zu beurteilen. Um dies zu ändern, ist in den Studiengängen der Fokus auf die Ausbildung einer Reihe von Fähigkeiten des historischen Denkens gelegt worden, die auf den wissenschaftlichen Arbeitsmethoden von HistorikerInnen basiert. Allerdings glaube ich, dass dieser Zugang auf einer fehlerhaften Einschätzung der Jugendlichen und auf einem Ausschluss anderer Wege, Geschichte zu nutzen, beruht.
Tepoztlán ist eine Stadt, die ihre Geschichte spürbar macht. Sie liegt nicht weit entfernt von Mexico City und wurde 1937 zum Nationalpark erklärt. Sie ist ein Pilgerort aus prähispanischen Zeiten, besitzt seit dem 16. Jahrhundert Besitzansprüche von höchstem Rang an Gemeindeland und kämpfte gemeinsam mit Emiliano Zapata in der mexikanischen Revolution von 1910. Die StadtbewohnerInnen leisteten gemeinsam Widerstand gegen ein Waldrodungsprojekt in den 1930er Jahren, das die Wälder in der Nähe bedrohte. Sie wehrten sich gegen eine Drahtseilbahn (1979), gegen ein Gefängnis (1979), gegen eine Umfahrungsstrasse (1986), gegen eine touristische Sightseeing-Bahn (1990) sowie 1995 gegen den Bau eines Golfplatzes, der Ackerland und exklusive Wohnzonen hätte ersetzen sollen. Sechs Jahre beherbergte die Stadt den Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN: die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung). Sie ist sowohl eine mexikanische wie eine kosmopolitische Stadt.
Als Teil eines Projekts, das beide Küsten verbinden und die – vor allem an Wochenenden – übernutzte bezahlpflichtige Autobahn entlasten sollte,[1] die neben Tepoztlán vorbeiführt, lancierten die nationalen Behörden und jene des Teilstaates im Jahr 2011 ein Ausbauprojekt. Dagegen entwickelte sich in der Bevölkerung Widerstand und als 2013 die Bauarbeiten aufgenommen werden sollten, inszenierte eine Gruppe von StadtbewohnerInnen ein Sit-In und bauten ein Camp, das sie – zu Zapatas Ehren – “Caudillo del Sur” nannten. Damit sollte ein dauerhafter ziviler Widerstand etabliert werden, um einen Baustopp zu erzwingen. Sie begründeten ihren Widerstand damit, dass das Straßenprojekt zu Landenteignungen und Umweltschäden führen und die Lebensbedingungen der EinwohnerInnen von Tepoztlán beeinträchtigen würde. Im Juli des gleichen Jahres räumte die Regierung das Camp mit Gewalt und riss die Bauten ab. Der Frente Unido en Defensa de Tepoztlán (FUDT; Gemeinsame Front zum Schutze Tepoztláns) entschied sich dafür, sich auf dem Rechtsweg zu wehren. Dabei gelang es ihr, die Bauarbeiten vorübergehend anzuhalten. Nun steckt die Lösung im Sumpf des mexikanischen Justizsystems fest.
Der Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán (FJDT; Jugend Front zum Schutze Tepoztláns) ist Teil des FUDT. Er besteht aus unterschiedlichen Gruppen von Jugendlichen, die ihre Identität größtenteils mittels ihrer ländlichen Herkunft definieren. Sie führen friedvolle Protestkundgebungen durch und verbreiten ihre Ansichten in Weblogs und sozialen Netzwerken. In all ihren Äußerungen nutzen sie die Geschichte als zentralen Bestandteil ihrer Argumentation. Doch was heraussticht, ist ihr historisch-graphischer Diskurs, mit dem sie die Mauern der Stadt und der Nachbargemeinden dekoriert haben. Darin zeigen sie durchgehend Bilder einer idealisierten prähispanischen Vergangenheit verbunden mit der Ablehnung des Kapitalismus, der Regierungsinstitutionen und der Gewalt staatlicher Kriminalität, (worunter sie verbrecherische Gewalt verstehen, die vom Staate ausgeht oder von ihm geduldet wird). Das historische Narrativ der FJDT ist ein Widerstandsdiskurs. Sie sehen sich als Erben einer uralten Tradition, denn “die Erfahrung beginnt nicht erst mit diesem Kampf. Sie beginnt vor Jahren, als wir sahen, wie unsere Väter und Großväter beim Klang der Kirchenglocken unsere Stadt verteidigten.”[3] In einer einzelnen Widerstandsbewegung beziehen sie Stellung zu Fragen der Nation, Jugend, Identität, Ökologie, Geschichte und Religion. Natürlich hat das nichts mit dem historischen Denken von HistorikerInnen zu tun, so wie sie es in der Schule hätten lernen sollen.
Die vielleicht signifikanteste Form, wie Geschichte als politisches Werkzeug eingesetzt werden kann, ist die Wandmalerei der FJDT. Voller kontrastierender leuchtender Farben erzählen die Häuserwände Geschichten, die in die Vergangenheit blicken und sich an die Zukunft richten. Eine der Wandmalereien zeigt eine Zeichnung, die in den Augen der Kunstkritik abschätzig als naive Malerei bezeichnet werden könnte. Doch die Zeichnung zeigt die Wiederholung der Geschichte, in der sich die Vergangenheit wie die Gegenwart darstellt, sowohl in ihrer verheerenden Macht, wie auch in der Wiederherstellung von Hoffnung. Sie zeigt die “Adlerkämpfer” der Nahua im Kampf mit den spanischen Eroberern. Dann zeigt sie einen Geschäftsmann, wie er Geld stiehlt, den Wald zerstört und dann auf der Autobahn flieht, während andere prähispanische Kämpfer sich ihm in den Weg stellen. Auf einer anderen Wandmalerei wird ein Kapitalist, der den Fortschritt verkündet, einem chinelo gegenübergestellt, einem Karnevalstänzer, der – mit der Machete in der Hand – nach Kultur schreit. Der Gegensatz erscheint simpel, doch in Wirklichkeit sehen wir einen ambivalenten Prozess, in dem zwei verschiedene Güter einander gegenübergestellt werden und zugleich, bedingt durch das jeweilige Gegenstück, erst ihre Form finden. Für den Geschäftsmann liegt die Zukunft als evolutionäres und universelles Geschehen vor ihm; für den chinelo und die prähispanischen Kämpfer liegt die Zukunft zugleich hinter und vor ihnen, da die Zukunft zugleich Konservierung wie Transformation der Vergangenheit bedeutet, die zugleich Kultur und Natur umfasst. Beide brauchen einander: Der eine dominiert, der andere leistet Widerstand.
Die Jugendlichen der FJDT sind aller möglichen Dinge beschuldigt worden: Sie seien ninis (also NEET = Not in Education, Employment, or Training), AgitatorInnen, FundamentalistInnen und Fortschrittsfeinde. Fügen wir hier das Konzept hinzu, das die Verfasser von Geschichtslehrplänen an Volksschulen von Jugendlichen haben,[4] dann handelte es sich, mit anderen Worten, um Individuen, die lediglich für den Moment leben und denen jedes Bewusstsein für Vergangenheit und Zukunft abgeht. Somit könnte der Widerstand gegen die Autobahn bei Tepoztlán verstanden werden als nichts weiter als eine Gruppe von jugendlichen AußenseiterInnen, die nicht in der Lage sind, historisch zu denken. Doch wenn wir den Widerstand gegen die Autobahn als einen Kampf gegen temporale Typologisierungen[5] (zivilisiert-primitiv, modern-bäuerlich) betrachten, dann können wir verstehen, dass es sich hier um eine legitime Anwendung von Geschichte als Teil einer politischen Partizipation handelt.
Diese Verwendungen, die für gewöhnlich aus dem Schulunterricht ausgeschlossen sind, werden weiterhin eine Rolle dabei spielen, die verschiedenen Kulturen in Mexiko sozial und symbolisch zu verbinden und damit zu behaupten, dass es eine historische Zeit jenseits von Braudel gibt.
____________________
Literatur
Externe Links
____________________
[1] Im Rahmen dieses Megaprojekts gibt es noch Pläne für eine thermoelektrisches Kraftwerk in Huexca, Morelos und eine Gas-Pipeline, die durch die Staaten von Pubela, Morelos und Tlaxcala führen soll. Die Städte in diesem Tal wehren sich ebenfalls gegen diese Projekte.
[2] Dies ist nicht die einzige wichtige Jugendbewegung. Neben #yosoy132, die für die Demokratisierung der Medien kämpft, besteht eine ähnliche Bewegung, die sich für den Schutz der Wälder gegen illegale Abholzung einsetzt und sich aus jugendlichen Eingeborenen aus Cherán, Michoacán, zusammensetzt.
[3] Romero, Carolina (2012) “En Tepoztlán los pueblos se organizan en defensa de la tierra, el agua y el aire”. http://www.anarkismo.net/article/23686 (letzter Zugriff am 24.10.2014)
[4] Lima, Laura; Bonilla, Felipe; Arista, Verónica (2010) “La enseñanza de la historia en la escuela mexicana.” Proyecto Clío (Barcelona) 36.
[5] Vargas Cetina, G. (2007) “Tiempo y poder: la antropología del tiempo,” Nueva Antropología, vol. 20, no. 67, May, 2007, pp. 41–64. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15906703 (Letzter Zugriff am 24.10.2014)
____________________
Abbildungsnachweis
© Frente Juvenil En Defensa De Tepoztlán, 2014. https://www.facebook.com/FJDTepoz/photos/a.498856276794339.123068.497297213616912/729932403686724/?type=3&theater.
Übersetzung aus dem Englischen
von Jan Hodel
Empfohlene Zitierweise
Plà, Sebastiàn: Youth, Resistance, and Public Uses of History in Mexico. In: Public History Weekly 2 (2014) 37, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-2779.
Copyright (c) 2014 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.
La enseñanza de la historia en México sostiene que el problema de aprendizaje se debe a que los jóvenes contemporáneos sólo piensan en el presente y son incapaces de valorar el pasado y el futuro. Para solucionar esto, los programas de estudios han creado una serie de competencias del pensar históricamente que se fundamentan en el quehacer científico de los historiadores. Sin embargo, considero que esta propuesta parte de un diagnóstico equivocado de los jóvenes y de la exclusión de otras formas de usar la historia.
Tepoztlán es un pueblo con mucha historia presente. Próximo a la ciudad de México, fue decretado Parque Nacional en 1937. Zona de peregrinación desde el prehispánico, posee títulos primordiales de tierras comunales del siglo XVI y luchó junto a Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana de 1910. El pueblo resistió frente a un proyecto maderero de los años treinta que amenazó con devastar los bosques aledaños, luchó contra un teleférico (1979), una cárcel (1979), un periférico (1986), un tren escénico (1990) y la construcción de un campo de golf que pretendía sustituir las tierras de cultivo por una zona residencial exclusiva en 1995. Seis años después fueron anfitriones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Es un pueblo mexicano y cosmopolita a la vez.
Como parte de un proyecto que busca conectar ambos océanos[1] y ante la saturación de la carretera de cuota –especialmente los fines de semana- que pasa a un costado de Tepoztlán, los gobiernos federal y estatal iniciaron planes de ampliación en 2011. La resistencia popular al proyecto se organizó y cuando en 2013 se iniciaron las obras, un grupo de pobladores instaló el campamento “Caudillo del Sur” para detener los trabajos. Su argumento es que con la nueva carretera se expropiarán tierras, se dañará el medio ambiente y se trastocará la forma de vida del pueblo. En julio de ese mismo año, el gobierno estatal desalojó violentamente el campamento. El Frente Unido en Defensa de Tepoztlán (FUDT) decidió tomar el camino judicial y consiguieron detener temporalmente la construcción. En este momento, la resolución del problema se encuentra en los pantanos de la justicia mexicana.
El Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán (FJDT) es parte del FUDT. Está compuesto por un grupo plural de jóvenes para quienes lo rural es parte constitutiva de su identidad. Realizan protestas pacíficas y difunden sus ideas activamente en blogs y diversas redes sociales. En todas sus manifestaciones usan la historia como parte central de sus argumentos, pero sobresale su discurso histórico-gráfico que ha decorado las paredes del pueblo y las comunidades aledañas. En ellas, constantemente muestran imágenes del pasado prehispánico idealizado, rechazo al capitalismo, a las instituciones gubernamentales y a la violencia del crimen autorizado, es decir, al producido o permitido por el Estado.[2] La narrativa histórica del FJDT es un discurso de resistencia. Como herederos milenarios, consideran que su “experiencia no comienza con esta lucha. Comenzó desde hace años cuando veíamos a nuestros padres y nuestros abuelos organizarse para defender al pueblo al repique de las campana”.[3] Nación, juventud, identidad, ecología, historia y religión se atrincheran en un solo movimiento de resistencia. Eso sí, nada de pensar históricamente como historiadores, de acuerdo con las competencias que debe desarrollar la escolarización.
La representación más significativa del uso de la historia como instrumento político sea la pintura mural del FJDT. Llena de colores contrastantes y llamativos, las paredes de las casas narran historias que miran al pasado y se dirigen al futuro. En uno de los murales se puede observar una pintura –que a los ojos de críticos de arte podría ser catalogada con la deficitaria etiqueta de arte naíf- en donde aparece la repetición histórica, en la que el pasado es como el presente, tanto en su poder devastador como en su esperanza restauradora. Ahí aparecen guerreros águilas nahuas que enfrentan a los conquistadores españoles. A continuación, se presenta un empresario robando dinero, devastando el bosque y huyendo por la autopista, mientras otros guerreros prehispánicos se le enfrentan. En otro mural, a un capitalista que grita progreso se le enfrenta un chinelo, danzante del carnaval, que con machete en mano grita cultura. La dicotomía parece simple, pero en realidad lo que tenemos es un proceso ambivalente en la que dos temporalidades diferentes se oponen. En el empresario el futuro está adelante, es evolutivo y universal; en el chinelo y los guerreros prehispánicos el futuro está atrás y adelante, en donde el porvenir es la conservación y la transformación del pasado compuesto por la cultura y la naturaleza.
Los jóvenes del FJDT han sido acusados de todo: ninis, revoltosos, fundamentalistas y enemigos del progreso. Si a esto le agregamos la concepción de joven que tienen los creadores de los programas de historia para la educación obligatoria,[4] es decir, individuos que sólo viven para el presente sin conciencia de pasado ni futuro, se podría pensar que la resistencia contra la autopista de Tepoztlán no es más que un grupo de inadaptados incapaces de pensar históricamente. Sin embargo, si observamos la lucha contra la autopista también como una batalla contra tipologías temporales[5] (civilizado-primitivo, moderno-campesino), podremos comprender cómo usos legítimos de la historia también son parte sustancial de la participación política.
Estos usos, normalmente excluidos del aula, seguirán luchando para promover la inclusión social y simbólica de diferentes culturas en México y sostener que hay tiempo histórico más allá de Braudel.
____________________
Bibliografía
Vínculos externos
____________________
[1] Dentro del mega proyecto hay planes de una termoeléctrica en Huexca, Morelos y un gasoducto que atraviesa los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Los pueblos de este valle también se encuentran en rebeldía.
[2] No es el único movimiento juvenil relevante. Además del #yosoy132 que lucha por la democratización de los medios, otro movimiento similar pero defendiendo los bosques contra los aserraderos ilegales es el de jóvenes indígenas de Cherán, Michoacán.
[3] Romero, Carolina (2012) “En Tepoztlán los pueblos se organizan en defensa de la tierra, el agua y el aire” en http://www.anarkismo.net/article/23686
[4] Lima, Laura; Bonilla, Felipe; Arista, Verónica (2010) “La enseñanza de la historia en la escuela mexicana”. Proyecto Clío 36: Barcelona.
[5] Vargas Cetina, G. (2007) “Tiempo y poder: la antropología del tiempo” en Nueva Antropología, vol. XX, núm. 67, mayo, 2007, pp. 41-64. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15906703
____________________
Créditos de imagen
© Frente Juvenil En Defensa De Tepoztlán, 2014. https://www.facebook.com/FJDTepoz/photos/a.498856276794339.123068.497297213616912/729932403686724/?type=3&theater.
Citar como
Plà, Sebastiàn: Youth, Resistance, and Public Uses of History in Mexico. In: Public History Weekly 2 (2014) 37, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-2779.
Copyright (c) 2014 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.
The post Youth, Resistance, and Public Uses of History in Mexico appeared first on Public History Weekly.
Die Möglichkeit, im Rahmen der in der Studieneingangs- und Orientierungsphase (BA Geschichte) vorgesehenen Vorlesung “Theorien und Geschichte schriftlicher Quellen und Medien” in 60-70 Minuten die Geschichte der chinesischen Schrift zu präsentieren (Universität Wien, 29. 10. 2014), stellt zumindest in zweifacher Hinsicht eine Herausforderung dar: einerseits soll ein einführender Längsschnitt durch die Geschichte der chinesischen Schriftkultur geboten werden, andererseits muss auch der politisch-kulturelle Hintergrund (Orakelwesen in der chinesischen Antike, Vereinheitlichungen und “Reformen” der chinesischen Schrift, Einflüsse von Konfuzianismus und Buddhismus auf die Entwicklung von Schriftkultur, Anfänge von Papier und Buchdruck, etc.) berücksichtigt werden.
Nachdem unter anderem “epochen- und raumübergreifendes Grund- und Orientierungswissen über Schriftkultur” sowie “Grund- und Orientierungswissen über Geschichte, Funktion, Bedeutung und Analyse schriftlicher [...] Quellen”[1] vermittelt werden soll, hat sich die folgende Vorgangsweise geradezu angeboten:
Einleitend wurden die zentralen Faktoren bei der Entwicklung der Schrift (Wandel der Schreibmaterialien, ästhetische Vorstellungen (Kalligraphie!), neue Möglichkeiten und Techniken der Vervielfältigung, gesellschaftliche Umbrüche) benannt. Es folgten Beispiele für die zur Rektonstruktion der Geschichte der chinesischen Schrift wichtigen Schriftträger (Knochen, Bronze, Stein, Bambus, Holz, Papier – die auf Seide geschriebenen Bücher wurden der Vollständigkeit halber am Rande erwähnt).[2]
Die Ausführungen zu jüngeren Debatten um die schrifttypologische Einordnung/Beschreibung des Chinesischen wurden bewusst kurz gehalten – ebenso der Hinweis auf die sechs Strukturtypen (liushu 六書) chinesischer Schriftzeichen.
Die Frage nach der Anzahl der chinesischen Schriftzeichen wurde aus drei Blickwinkeln beleuchtet: 1.) Anzahl der allgemein gebräuchlichen Schriftzeichen, 2) Anzahl der Schriftzeichen in zweisprachigen Chinesisch-Wörterbüchern und 3) Anzahl der Schriftzeichen in einsprachigen Wörterbüchern und Zeicheninventaren (Beispiel: Unicode).
Eine Graphik verdeutlichte dann Entwicklung, Abfolge und Zusammenhänge der wichtigsten Schriftstile (Große und Kleine Siegelschrift, Kurialschrift, Modellschrift, Schreibschrift und Konzeptschrift). Als Beispiel für die so genannte “wilde Konzeptschrift” wurde ein Ausschnitt aus der Autobiographie des buddhistischen Mönchs Huaisu (8. Jh.n.Chr.) gezeigt.[3]. Ebensowenig durfte ein Blick auf das älteste erhaltene gedruckte datierte Buch – das Diamantsutra aus dem Jahr 868 n. Chr. – fehlen.[4]
Um den vorgegebenen Zeitrahmen einhalten zu können, folgte dann ein “Sprung” ins 18. Jahrhundert – zu einer Seite aus der wohl umfassendsten jemals gedruckten (chinesischen) Enzyklopädie (Gujin tushu jicheng 古今圖書集成 , d.i. “Sammlung von Texten und Illustrationen aus alter und neuer Zeit”, 1720er Jahre).
Auf Beispiele zur Ordnung und Anordnung der chinesischen Schriftzeichen (unter anderem eine Seite aus einem frühen (1872) chinesischen Telegraphencode) folgten dann zusammenfassende Bemerkungen zu der nach der Gründung der Volksrepublik China (1949) in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts durchgeführten Schriftreform (Vereinfachung der Schriftzeichen, Verbreitung des Hochchinesischen, Entwicklung einer Lautumschrift). Erläuterungen zu nicht nur schriftgeschichtlich bemerkenswerten Einzelheiten der Seite 1 der Renmin Ribao 人民日報 (“Volkszeitung”) vom 20.12.1977 standen am Ende des Vortrags.
Zur Person
Cover: Willy Stiewe, Der Krieg nach dem Kriege. Eine Bilderchronik aus Revolution und Inflation, Deutsche Rundschau, Berlin o. J. [1932]