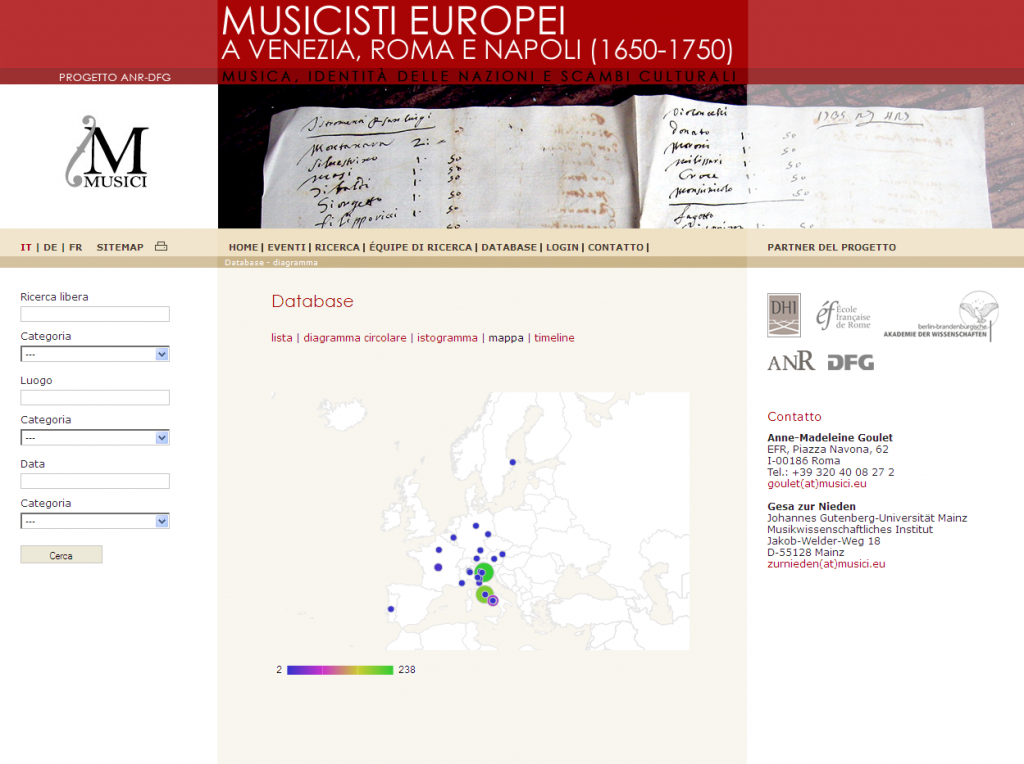1000 Worte Forschung: Dissertation (Mittelalterliche Geschichte) FU Berlin
Im späten 15. Jh. verfasste der Kärntener Kleriker Jakob Unrest drei Chroniken in frühneuhochdeutscher Sprache. Fern der akademischen Welt der Höfe und Universitäten schilderte er, was das Reich, die Welt, insbesondere aber seine Heimatregion bewegte. Seine Aufzeichnungen stellen eine wichtige, in manchen Bereichen die einzige, Quelle für das Geschehen in Kärnten in dieser Zeit dar.
Die drei von Unrest verfassten Chroniken erfuhren eine sehr unterschiedliche Rezeptions- und Überlieferungsgeschichte. Sein bei weitem umfangreichstes Werk ist die Österreichische Chronik, die Unrest bis an sein Lebensende fortführte, die in der Frühen Neuzeit jedoch offenbar kaum Beachtung fand. Sie ist nur in zwei Handschriften erhalten, beides Abschriften aus dem 16. Jahrhundert, von denen die eine, die Hannoveraner Handschrift (Hannover, Niedersächs. Landesbibl. N. XIII, 783.) erst im 18. Jahrhundert wiederentdeckt wurde, die andere, die Wiener Handschrift (Nationalbibl. Wien, cod. lat. n. 8007.) gar erst 1923 durch Karl Grossmann, der die Österreichische Chronik für die Monumenta Germaniae Historica edierte[1].
Die größte Rezeption unter seinen Werken erfuhr unmittelbar nach Unrests Tod vielmehr die Kärntener Chronik, der von der modernen Geschichtswissenschaft lange Zeit nur ein geringer literarischer und historiographischer Wert beigemessen wurde. Im auffälligen Gegensatz zu den anderen Chroniken gelangte sie in der Frühen Neuzeit zu weiter Verbreitung und ist heute noch in 22 Handschriften erhalten[2]. Sie wurde zum Vorbild und Ausgangspunkt einer Kärntner Landesgeschichtsschreibung, was wohl mit ihrer Instrumentalisierung zu legitimatorischen Zwecken zusammenhängt. Mit der Wiederentdeckung der Österreichischen Chronik und ihrer ersten Veröffentlichung im Druck 1724 begann allerdings die Beachtung für die Kärntner Chronik im gleichen Maße zu schwinden, wie das Interesse an der Österreichischen Chronik zunahm[3].
Bis heute eher wenig beachtet wurde die Ungarische Chronik. Sie ist in denselben Handschriften erhalten wie die Österreichische Chronik, in der Hannoveraner Handschrift allerdings nur als Bruchstück, so dass sie bis ins 20. Jh. nicht in voller Länge bekannt war und erst 1974 vollständig ediert wurde. Sie behandelt Leben und Taten der ungarischen Herrscher von Attila bis Matthias Corvinus und ist eine der ältesten bekannten Darstellungen ungarischer Geschichte in deutscher Sprache[4].
Unrest griff auf nur wenige andere Geschichtswerke zurück, wohl aber in hohem Maße auf Flugschriften, Gerüchte und andere kursierende Nachrichten sowohl aus Italien als auch aus dem Reich, die seine Hauptquelle für weiter entfernte Ereignisse bilden. Inhaltlich gilt Unrests Hauptaugenmerk jedoch seinem unmittelbarem Umfeld, der Region Kärnten und den habsburgischen Nachbarländern.
Dabei ist seine Leitlinie die Dynastiegeschichte, in der Ungarischen Chronik die Abfolge der ungarischen Könige, in der Österreichischen die der Habsburger. Dadurch, dass er nach einer kurzen Vorgeschichte, die die Lücke zur Chronik der 95 Herrschaften schließt, als deren Fortsetzer er sich verstand, Gegenwartschronistik betreibt, liegt der Schwerpunkt seiner Darstellung allerdings eindeutig auf der Herrschaft Kaiser Friedrichs III.
Die Kärntener Chronik enthält zwar nur wenig eigene Hinzufügungen Unrests und ist im Wesentlichen aus Versatzstücken aus anderen Geschichtswerken gebildet, doch ist sie durchaus absichtsvoll konstruiert. So wird in ihr durch die Rückverlegung des Zeremoniells der Herzogseinsetzungen auf dem Fürstenstein am Zollfeld bei Maria Saal eine Kontinuität des Herzogtums Kärntens behauptet[5].
Innerhalb dieses Rahmens liegt die eigentliche Stärke seiner Darstellungen im Bereich der Regionalgeschichte, wobei auch eigenes Erleben eine große Rolle spielen dürfte. Über Türkeneinfälle, Ungarnkriege und Bauernaufstände berichtet Unrest aus erster Hand. Immer wieder greift er dabei verbreitete Feindbilder seiner Zeit auf, die pejorative Darstellung des Fremden und Anderen nimmt einen wichtigen Stellenwert in seiner Darstellung ein. Stets ist der Anlass eine Abweichung des als Norm Empfundenen, so die vom Christentum im Falle der religiös begründeten Ablehnung von Juden und Häretikern. Unrest bedient sich antijüdischer Topoi, die im ausgehenden Mittelalter stark an Vehemenz zunahmen, und kolportiert auch die weitverbreiteten Ritualmordvorwürfe. Häretiker sind für ihn vor allem die Hussiten, die er als eine ansteckende, die Rechtgläubigkeit gefährdende Seuche beschreibt.
Soziale Aspekte sind der Grund für die Ablehnung der Schweizer oder ‚aufständischer’ Bauern, die Unrest häufig gleichsetzt. Hier ist es die Abweichung von der idealen Gesellschaftsordnung, die für Unrest noch immer der mittelalterliche Ständestaat ist, welche ihre Ausgrenzung begründet. Dabei ergeben sich jedoch durchaus Nuancen zwischen bäuerlicher Selbstvertretung, legitimem Widerstand und Rebellion.
Ein wiederum anderes Bild offenbart sich in Unrests Darstellung christlicher Feinde, die aus politischen Gründen als Gegner gesehen werden. Dies sind vor allem Venezianer, Franzosen, Burgunder und Ungarn, deren Bild starken Schwankungen unterworfen ist. Diese Feindschaften wechselten mit den politischen Konstellationen, wobei Unrest sich meist auf der Seite der Habsburger positioniert, wenn auch nicht völlig unkritisch. Ansonsten scheint oft die Haltung der jeweiligen Mächte den Türken gegenüber, die für ihn das Fremde und Feindliche schlechthin sind, der ausschlaggebende Faktor zu sein. Einem Vorkämpfer gegen die Türken, wie es beispielsweise Matthias Corvinus in seinen Augen ist, kann Unrest auch Feindschaft zu Habsburg und Kärnten vergeben.
Ziel der Dissertation ist es, die von Jakob Unrest wiedergegebenen Fremdwahrnehmungen zu analysieren und in ihrer Beziehung zueinander und zu seinem geistigen Umfeld begreifbar zu machen. Durch den vergleichenden Ansatz soll auch die Wahrnehmung und Darstellung von Fremdheit in der Geisteswelt der Zeit weiter erhellt werden. Es soll untersucht werden, inwieweit die in der zeitgenössischen ‚Öffentlichkeit’ dominierenden Diskurse Unrests Schaffen beeinflussten und inwieweit er diese Tendenzen zu instrumentalisieren und im Sinne seiner eigenen Ziele einzusetzen verstand. Dabei soll insbesondere der Frage nach der Konstruktion von Identität durch die Konstruktion von Alterität nachgegangen werden.
Ausgehend von der These eines bewussten Einsatzes dieser Motive soll die Untersuchung der dabei angewandten Methoden und der angestrebten Ziele der Darstellung ein besseres Verständnis von Unrests Welt- und Geschichtsbild und der Historiographie seiner Zeit ermöglichen.
Im engen Zusammenhang damit soll der Umgang Unrests mit seinen Vorlagen erhellt werden. Die Verarbeitung von Quellen, die eigentlich ursprünglich einem anderen, teilweise wohl gar einem propagandistischen Zweck dienten, ist wesentlicher Teil seines Schaffens.
Das Verhältnis von Reproduktion, Instrumentalisierung und eigenem Schaffen soll zur Erhellung des Verhältnisses von Öffentlichkeit und Historiographie und der Rolle des Geschichtsschreibers im späten Mittelalter beitragen.
[1] Jakob Unrest, Österreichische Chronik (MGH SS rer. Germ. N.S.11), Hannover/ Leipzig 1957, S.1-238.
[2] Vollständige Liste der Handschriften bei Grossmann: Jakob Unrests Österreichische Chronik, S. XIV.
[3] Jakob Unrest, Kärntner Chronik, in: Simon Friedrich Hahn (Hg.): Collectio monumentorum veterum et recentium ineditorum I, Braunschweig 1724, S.479-536.
[4] Jakob Unrest, Ungarische Chronik, in: Armbruster, Adolf, Jakob Unrests Ungarische Chronik, in: Revue Roumaine d’Histoire 13 (3) (1974), S.481-508., vgl. auch Krones, Jakob Unrests Bruchstück, S. 339-355.
[5] Vgl. hierzu insbesondere Moeglin, Jean-Marie, Jakob Unrests Kärntner Chronik als Ausdruck regionaler Identität, in: Peter Moraw (Hg.), Regionale Identität und soziale Gruppen im deutschen Mittelalter (ZHF Beiheft 14). Berlin, 1992, S. 165-191.
Quelle: http://mittelalter.hypotheses.org/1348