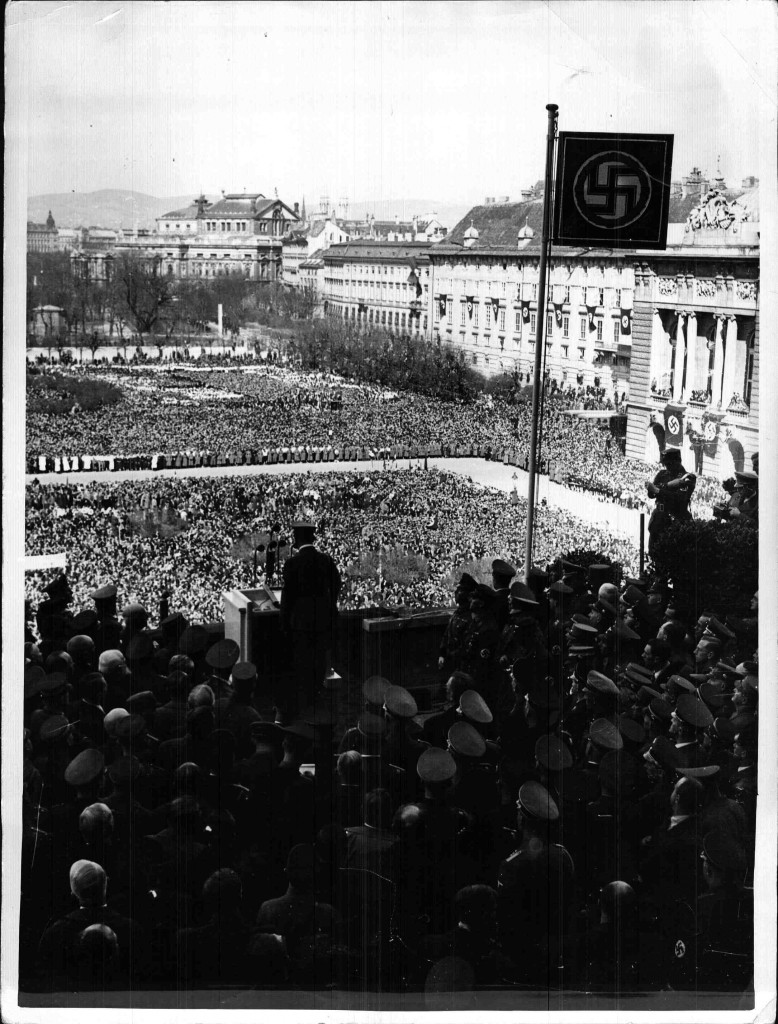Anlässlich des 550. Todestags von Abt Martin von Leibitz am 28. Juli 2014 beschäftigt sich derzeit eine dreimonatige Kleinausstellung im Museum im Schottenstift mit dieser bedeutenden Persönlichkeit.
Martin entstammte einer deutschsprachigen Familie aus der Zips, wo er um 1400 im heutigen Ľubica (Slowakei) geboren wurde. Nach dem Studium an der Universität Wien wurde er zunächst Mönch in Subiaco, trat dann aber noch vor 1431 in das Wiener Schottenstift ein. Von 1446 bis 1460/1461 war er hier Abt. Eine ausführlichere Biographie findet sich im Wikipedia-Artikel „Martin von Leibitz“.
1435 wurde Martin von Leibitz zum Prior des Schottenstifts ernannt. Im gleichen Jahr, am 30. Dezember 1435, erwählten die Konventualen des Schottenstifts in Abwesenheit ihres Abtes Johannes von Ochsenhausen, der sich am Konzil von Basel befand, ihren Prior Martin zu ihrem Bevollmächtigten im Streit mit dem Regensburger Schottenkloster St. Jakob, das immer noch Ansprüche auf das Wiener Kloster geltend machen wollte.

Urk 1435-12-30
Diese Urkunde ziert ein sehr schönes Exemplar des Konventsiegels des Schottenstifts.

Urk 1435-12-30: Konventsiegel
Wenige Jahre nach der Abtwahl Martins im Jahr 1446 bestätigte der Wiener Jurist Johannes Poltzmacher, Propst zu Brünn und Kanonikus zu Olmütz, in einer Urkunde vom 2. August 1449, dass, während er selbst Koadjutor des Propstes zu St. Stephan in Wien gewesen war, auf sein Ansuchen hin der Schottenabt Martin bisweilen an den höchsten Festen bei St. Stephan pontifiziert (mit Stab und Mitra das Hochamt zelebriert) habe, dass Martin hierzu jedoch keineswegs verpflichtet werden könne.

Urk 1449-08-02
Auf Initiative des päpstlichen Legaten Kardinal Nikolaus von Kues visitierte Martin von Leibitz als Vertreter der Melker Reform gemeinsam mit Abt Laurenz Gruber von Klein-Mariazell und dem Melker Professen Johannes Schlitpacher 1451 bis 1452 die Benediktinerklöster der Salzburger Kirchenprovinz.
Die hier zu sehende Sammelhandschrift (Cod. 297 (Hübl 237)) enthält zahlreiche Abschriften von Briefen, die im Zusammenhang mit dieser großen Visitationsreise stehen, so etwa Briefe des Johannes Schlitpacher und des Nikolaus von Kues an Abt Martin und seine Mitvisitatoren.

Cod. 297 (Hübl 237) fol. 141v/142r
Als Abt trieb Martin von Leibitz durch den intensiven Austausch mit der Wiener Universität und dem Stift Melk außerdem den wissenschaftlichen Aufschwung des Schottenstifts voran. Zu diesem Zweck ließ er auch die Stiftsbibliothek ausbauen.
Laut Vermerk wurde dieser 1456 geschriebene deutschsprachige Codex (Cod. 51 (Hübl 212)), der eine Belehrung für Kleriker und Novizen enthält, von Abt Martin zu Ostern 1457 für das Schottenstift angeschafft.

Cod. 51 (Hübl 212) fol. 1r
Auf dem hier zu sehenden Blatt befinden sich außerdem auch nachträgliche Vermerke zu den Abtweihen bei den Schotten. Als Vorsatzblätter dienen Fragmente eines Antiphonars des 14. Jahrhunderts.
Auch diese Handschrift (Cod. 354 (Hübl 354)) mit den beiden Texten „De passione Christi“ und „Ex vitis patrum“ wurde von Abt Martin für das Schottenstift erworben.

Cod. 354 (Hübl 354) fol. 1v/2r
Ärgerlicherweise findet sich heute keines von Martins von Leibitz zahlreichen eigenen Werken in der Handschriftensammlung des Schottenstifts. Überliefert sind sie unter anderem in Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek, des Stiftes Melk und des Stiftes St. Peter in Salzburg, wobei manche dieser Codices ursprünglich aus den Beständen der Schotten stammen.
Immerhin wird aber noch eine Sammelhandschrift mit theologischen Texten (Cod. 217 (Hübl 68)) verwahrt, die großteils von Martin selbst im Schottenstift geschrieben wurde.

Cod. 217 (Hübl 68) fol. 1r
Ende 1460 oder Anfang 1461 resignierte Martin von Leibitz aus unbekannten Gründen als Abt, bis zu seinem Tod war er nur noch schriftstellerisch tätig. Seine Bedeutung wird nicht zuletzt auch anhand der Rezeption seiner Werke deutlich; zu nennen sind etwa „Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (1400–1650)“ von Harald Tersch sowie „Klosterleben im Mittelalter“ von Johannes Bühler, die beide Abschnitte über das „Senatorium“ Martins enthalten.

Harald Tersch: Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (1400–1650). Eine Darstellung in Einzelbeiträgen (Wien/Köln/Weimar 1998).
Johannes Bühler: Klosterleben im Mittelalter (Frankfurt am Main/Leipzig 1989, 1. Aufl. 1923).
Eine im Schottenstift in den 1460er-Jahren geschriebene Sammelhandschrift mit monastischen Texten (Cod. 312 (Hübl 405)) enthält unter anderem ein Nekrolog der verstorbenen Mönche des Stiftes seit 1418. Auf fol. 100r Zeile 4ff. ist vermerkt, dass Abt Martin von Leibitz (de Ungaria de Cypczsch) am Gedenktag der Heiligen und Märtyrer Nazarius, Celsus, Victor und Innozenz im Jahr 1464 verstorben ist, am 28. Juli 1464.

Cod. 312 (Hübl 405)) fol. 100r

Die Kleinausstellung zu Martin von Leibitz ist von Anfang Juli 2014 bis Ende September 2014 im Museum im Schottenstift zu besichtigen.
Die ursprünglich etwas kürzere Fassung dieses Artikels erschien in mehreren Teilen zwischen 3. und 28. Juli 2014 auf der Facebook-Seite des Archivs.
Quelle: http://schotten.hypotheses.org/369