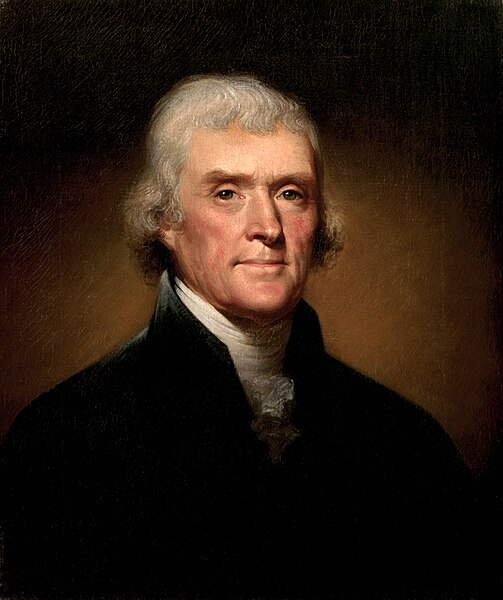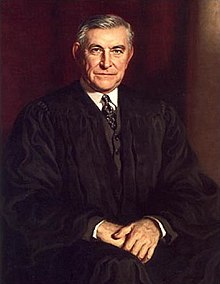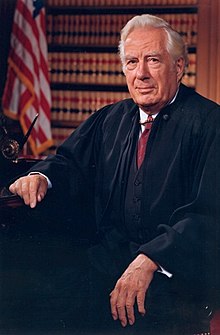Von Stefan Sasse
Dies ist der dritte und letzte Teil einer Serie zum "Supreme Court of the United States". Teil 1 und Teil 2 findet sich hier und hier. Darin wurde skizziert, wie der Supreme Court sich seine eigene Jurisdiktion schuf, die Frage der Sklaverei zu beantworten versuchte und in nie gekannte Tiefen abrutschte, indem er die Rassentrennung legalisierte. Danach verhinderte er lange Jahre eine Sozialgesetzgebung in den USA, ehe er unter Roosevelt mit liberalen Richtern besetzt wurde und die New-Deal-Maßnahmen passieren ließ. In den 1950er und 1960er Jahren wurden zahlreiche Urteile gefällt, die die Bürgerrechtsbewegung entscheidend voranbrachten und die politische Landschaft der USA bis heute prägen. Seit dem Rücktritt Earl Warrens 1969 ist allerdings eine graduelle Rechtsverschiebung wahrnehmbar, die mit Ronald Reagans Regierungsantritt 1981 stark zunehmen sollte.  |
| William Rehnquist |
Der auf Burgers R
ücktritt 1986 folgende Rehnquist-Court war einer der konservativsten Gerichtsh
öfe der letzten Jahrzehnte. Viele seiner Richter wurden von Ronald Reagan ernannt, und einige von ihnen sind heute noch aktiv. Interessanterweise sind einige sehr liberale Entscheidungen in seiner Zeit gefallen
– ein Zeichen daf
ür, dass die Richter tats
ächlich sehr unabh
ängig von den Politikern sind, die sie ernennen. So erlaubte der
Supreme Court explizit das Verbrennen von US-Flaggen unter dem ersten Verfassungszusatz (
„Texas v. Johnson“, was zu einer bis heute bestehenden Bewegung f
ür die Einf
ührung eines Verfassungszusatzes, der Flaggenverbrennungen verbietet, f
ührte), verbot
öffentliche, von Sch
ülern gef
ührte Schulgebete (
„Lee v. Weisman“), legalisierte Abtreibungen auch nach dem dritten Monat, wenn das Leben der Mutter gef
ährdet ist (
„Stenberg v. Cahart“) und erlaubte homosexuellen Geschlechtsverkehr (
„Lawrence v. Texas“). Ebenfalls in diese Reihe geh
ört
„Grutter v. Bollinger“, eine Entscheidung, die die Praxis der
„affirmative action“, also der bevorzugten Einstellung von Schwarzen, legitimierte.
Zwei gänzlich andere, kontroverse Entscheidungen des Supreme Court jener Epoche aber zeigen deutlich seine konservative Ausrichtung. In „United States v. Lopez“ 1995 entschied das Gericht zum ersten Mal seit Roosevelts Tagen über eine deutliche Grenze für das Recht des Bundes, über die „commerce clause“ in die Rechte der Einzelstaaten einzugreifen. Der Anlass war geradezu trivial; ein Schüler ging in Berufung, weil er unter Berufung auf die „commerce clause“ angeklagt worden war, eine Waffe in der Schule verkauft zu haben. Der Supreme Court zog in seinem Urteil deutliche Grenzen und setzte damit einen Präzedenzfall für einen Umschwung hin zu mehr Staatenrechten. Das wohl berühmteste Urteil des Rehnquist-Court aber ist „Bush v. Gore“ von 2000: die damals in vollem Gange befindliche Nachzählung der Stimmenabgabe zur Präsidentschaftswahl in Florida wurde gestoppt, weil sie den Gleichbehandlungsgrundsatz verletze. Als Folge zog George W. Bush ins Weiße Haus ein. Kaum eine Entscheidung war direkt politischer als diese und ist bis heute unter Hardlinern beider Seiten mythenumrankter. Tatsächlich hat diese Entscheidung der politischen Hygiene in den USA schweren Schaden zugefügt und den Supreme Court dem Verdacht der Parteilichkeit ausgesetzt.
 |
| John Roberts |
Seit Rehnquists Tod im Jahr 2005 wird der
Supreme Court von John G. Roberts gef
ührt, einem Konservativen, der j
üngst mit seinem Votum f
ür Obamas Gesundheitsreform Schlagzeilen machte. Bereits vor dieser Entscheidung aber f
ällte er einige wichtige Entscheidungen, die eine Rechtsbewegung der amerikanischen Politik zementierten. So wurde in
„Carvetti v. Ceballos“ bestimmt, dass Staatsbedienstete
über ihre T
ätigkeit nicht unter dem Schutz des ersten Verfassungszusatz reden d
ürfen, best
ätigte in
„Kansas v. Marsh“ die Verfassungsm
äßigkeit der Todesstrafe in Kansas, best
ätigte das Verbot von Abtreibungen nach der 24. Schwangerschaftswoche in
„Gonzales v. Carhart“, schr
änkte das Recht auf Privatsph
äre ein, indem er die Bedingung bei Hausdurchsuchungen, dass Polizisten sich ank
ündigen m
üssen relativierte (aufgefundene Beweise d
ürfen weiterhin verwendet werden,
„Hudson v. Michigan“) und erlaubte explizit den Besitz von Handfeuerwaffen (
„District of Columbia v. Heller“). Die wohl gr
ößte Entscheidung aber ist die
„Citizens United v. Federal Election Commission“-Entscheidung von 2007, die im aktuellen Wahlkampf immer und immer wieder als Beispiel Nr. 1 f
ür die Probleme mit der amerikanischen Demokratie zitiert wurde.
„Citizens United“ ist eine private non-profit-Organisation mit konservativer Stoßrichtung, die Einfluss auf alle möglichen Wahlen zu nehmen versucht – beispielsweise durch Produktion und Ausstrahlung von politischen Werbespots. Die Federal Election Commission versuchte, die Ausstrahlung eines solchen Films zu verhindern, da sie solche Interventionen als unzulässig ansah - direkte Spenden von Organisationen oder Firmen an Kandidaten, die für Bundesämter kandidieren, sind illegal, und die Argumentation war, dass ein solcher Beitrag nichts anderes sei. Der Supreme Court sah das anders und erlaubte Citizens United die Ausstrahlung unter dem Schutz des ersten Verfassungszusatzes, der „freedom of speech“. Die direkte Folge ist der im aktuellen Wahlkampf 2012 oft beklagte gigantische Einfluss der „Super PACs“ (Political Action Committee) auf die Finanzierung und Themensetzung. Problematisch an der Entscheidung ist, dass die „free speech“ eigentlich eingeschränkt wird, denn wer in der Lage ist, seine Meinung mit bezahlten Werbespots im Fernsehen zu verbreiten hat eine völlig andere Ausgangslage als jemand, der kein Geld für solcherlei Dinge hat – eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Der Supreme Court sah das anders. Die Folgen davon erleben wir gerade im Präsidentschaftswahlkampf.
 |
| Präsident Barack Obama |
Die aktuellste und gr
ößte Entscheidung des Supreme Courts unter Roberts aber war die
über Obamas Gesundheitsreform, den
„Patient Reform and Affordable Healthcare Act“, von den Gegnern
„Obamacare
“ getauft. F
ür die meisten Beobachter
überraschend erkl
ärte der Supreme Court, obwohl strukturkonservativ, das Werk f
ür verfassungsgem
äß. Bereits in der Debatte vorher hatten zwei Argumente die Agenda bestimmt, die im Verlauf dieser kleinen Geschichtsschreibung immer wieder eine Rolle gespielt haben: die Teilung des Gerichtshofs in 5:4 entlang ideologischer Scheidelinien und den daraus resultierenden Vorwurf der allzu gro
ßen Einflussnahme nicht gew
ählter Gremien auf den politischen Prozess einerseits und die Rolle der Einzelstaaten in ihrem Verh
ältnis zum Bund
über die
„commerce clause“ andererseits. Roberts erkl
ärte, dass die Zwangsvorschrift (
„individual mandate“) in
„Obamacare
“ keine Verletzung der
„commerce clause“ darstelle, wie die Konservativen argumentiert hatten
– also einen unzul
ässigen Eingriff in die Rechte der Bundesstaaten
– sondern eine Steuer, zu der der Bund prinzipiell berechtigt sei. Gleichzeitig erkl
ärte er, dass die Bundesstaaten dar
über hinaus nicht zur Teilnahme an dem Projekt gezwungen werden k
önnten. Der Vergleich mit Marshalls wegweisender Entscheidung von
„Marbury v. Madison“ dr
ängt sich geradezu auf. Roberts zwang Obama durch seinen Sieg geradezu, sich auf die Seite des
Supreme Court zu stellen und das Urteil zu begr
üßen, st
ärkte aber die Rolle der Einzelstaaten und machte sp
ätere Reformen dieser Art fast unm
öglich, indem er einen Pr
äzedenzfall schuf. Es ist gut m
öglich, dass
„National Federation of Independent Business v. Sebelius“, wie die Entscheidung hei
ßt, eine
ähnliche Bedeutung f
ür die Zukunft erlangt.
Der Supreme Court ist eine sehr amerikanische Institution. Fest eingefügt in das System der „Checks&Balances“, dem wohl bedeutendsten Beitrag der USA zu der Entwicklung politischer Systeme, hat er über mehr als zwei Jahrhunderte die Politik in ihren Schranken gehalten. Dies war beileibe nicht immer zum Besten – wie die Politik auch hat sich der Supreme Court einige Male schwer geirrt, und es hat lange gedauert, diese Irrtümer zu revidieren. Das Vertrauen der amerikanischen Bürger in ihn ist aber nicht ohne Grund. Die Richter haben ihre Unabhängigkeit von der Politik stets verteidigt, und in den Geruch der Parteilichkeit kamen sie äußerst selten. Selbst ihre Angehörigkeit zu einer bestimmten Richtung, etwa den Konservativen oder Liberalen, kann nach ihrer Ernennung auf Lebenszeit kaum als garantiert angenommen werden. Oft genug entschieden die Richter unabhängig von ihrer Einstellung. Auch das, das muss deutlich gesagt werden, hat nicht immer zum Besseren geführt. Es steht aber fest, dass die Amerikaner in ihrem Obersten Gericht eine Stelle haben, in der sie davon ausgehen können, dass sie Entscheidungen unabhängig vom Staat und dem Ansehen der Person fällt – und das ist etwas, das nur sehr wenige Staaten vorweisen können und das nicht unerheblich zur außergewöhnlichen Stabilität des amerikanischen politischen Systems beigetragen hat. Roosevelts gescheiterter Versuch, den Supreme Court auszuhebeln, zeigt dies deutlich auf.
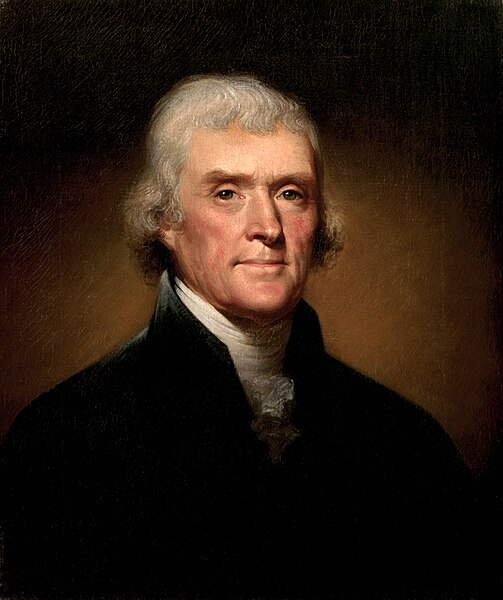 |
| Thomas Jefferson |
Ohne Kritik war das System freilich noch nie. Thomas Jefferson selbst hasste es, weil es verk
örperte, was die USA eigentlich hatten beseitigen wollen
– eine Aristokratie nicht gew
ählter M
änner, die mit fast absoluter Macht dem Volkswillen Schranken aufwiesen. Tats
ächlich ist der Vorwurf, dass der
Supreme Court mit Demokratie nicht besonders viel zu tun hat, kaum von der Hand zu weisen. Seine Mitglieder werden vom Pr
äsidenten ernannt und dienen lebenslang. Sie sind niemandem jemals Rechenschaft schuldig. Warum aber stehen sie h
öher als eine Entscheidung des Volkes, dem die Verfassung selbst in ihrem ersten Satz die volle Souver
änit
ät zubilligt? Zu erkl
ären ist dies nicht demokratisch, sondern nur mit dem System der
„Checks&Balances“. Manchmal kann es n
ötig sein, die Demokratie vor sich selbst zu sch
ützen. Es gab 1954 nicht auch nur im Ansatz eine Mehrheit f
ür die Vorstellung, schwarze Kinder mit wei
ßen auf eine Schule gehen zu lassen. Der
Supreme Court scherte sich nicht darum. Es w
äre m
öglich gewesen, dass der Pr
äsident mit der Billigung des Volkes im R
ücken die Verfassung ignoriert, um eine popul
äre, aber verfassungsfeindliche Ma
ßnahme durchzudr
ücken. 1974 zeigte der
Supreme Court klar, dass das niemals m
öglich sein kann. Er ist ein Korrektiv, nicht mehr, nicht weniger. Die alte Frage, wer die W
ächter
überwacht, kann auch er nicht beantworten.
Viele Länder, die ihre Demokratien am Beispiel der USA aufgebaut haben, versuchten auch, den Supreme Court zu imitieren. Die Einrichtung eines unabhängigen Obersten Gerichts aber ist eine Hürde, an der viele von ihnen scheiterten. Deutschland hat sie genommen, und das Bundesverfassungsgericht genießt in der BRD ein ähnlich hohes Ansehen, obgleich es selten eine solche Bedeutung erlangt wie der Supreme Court (fallen doch schon die Probleme der Staatenrechte hier fast völlig unter den Tisch). Als Gegenbeispiel kann dafür Russland dienen. Nach einigen hoffnungsvollen Ansätzen ist das russische Verfassungsgericht heute eine leere Hülle. Niemand kann in Russland hoffen, einen Prozess gegen den Staat zu gewinnen. Genau diese Aussicht aber ist es, die einen Rechtsstaat erst ausmacht. Die USA hatten das Glück, von Anfang an einen Gerichtshof zu haben, der solche Verfahren ermöglichte. Die Rechte der Bürger werden von seiner Existenz garantiert. Oftmals geht die Bedeutung solcher Institutionen in den Berichten über die Akteure auf der Bühne der großen Politik verloren. Gleichwohl sollte man sie nie unterschätzen – für die Existenz einer lebendigen Demokratie und ihren Erhalt sind sie von essenzieller Bedeutung.
Bildnachweise:
William Rehnquist - United States Department of Justice (gemeinfrei)
Owen Roberts - Steve Petteway (gemeinfrei)
Barack Obama - Pete Souza, The Obama-Biden-Project (gemeinfrei)
Thomas Jefferson - Rembrandt Peale (gemeinfrei)

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2012/08/die-geschichte-des-supreme-court-of.html