Von Daniel Bernsen Allgemein wird unter M-Learning bzw. mobilem Lernen, abgeleitet vom Begriff des E-Learning, das Lernen mit mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones verstanden. Diese Geräte erlauben über einen Internetzugang potentiell überall und zu jeder Zeit Informationen, digitalisieret Artefakte und Dokumente abzurufen (Kulturzugang) sowie eigene Inhalte zu produzieren, zu veröffentlichen und mit anderen zu teilen bzw. zu kommunizieren (Partizipation). Was bedeutet das für historisches Lernen speziell an Gedenkstätten? Aus schulischer Sicht unterscheidet sich Lernen an Gedenkstätten in zwei wesentlichen Punkten vom Unterrichtsgeschehen im […]
Was ist schön? Eine Antwort von den ARTigo-Spielern
 Die Frage „Was ist schön?“ ist alt und wurde vielfach diskutiert. Nicht nur Kunsthistoriker, auch Psychologen, Evolutionsbiologen und Philosophen trugen und ragen dazu bei, eine Antwort zu finden. Obwohl von vielen Disziplinen aus betrachtet – gibt es keine klare Antwort. Dafür viele Argumente aus zahlreichen Perspektiven.
Die Frage „Was ist schön?“ ist alt und wurde vielfach diskutiert. Nicht nur Kunsthistoriker, auch Psychologen, Evolutionsbiologen und Philosophen trugen und ragen dazu bei, eine Antwort zu finden. Obwohl von vielen Disziplinen aus betrachtet – gibt es keine klare Antwort. Dafür viele Argumente aus zahlreichen Perspektiven.
Eine Perspektive kommt nun hinzu: die Tags der ARTigo-Spieler. Somit handelt es sich hier nicht um eine einzelne oder gar meine persönliche Meinung, sondern um ein crowdgescourctes Geschmacksurteil.
Ich habe spezifische Datensätze selektiert, die die Tags von impressionistischen, expressionistischen und klassizistischen Bildern enthalten. Dabei habe ich festgestellt, dass die Tags „schön“ und „schönheit“ nur bei der Berechnung von Korrelationen auf dem Datensatz, der die Tags der Bilder des Klassizismus enthält, vorkommen. Sicher, es ist nichts Neues, wird doch gerade in dieser Epoche die Schönheit idealisiert. Dennoch: Trotz unserer reichen Bilderwelt und der zeitlichen Distanz zum 18. Jahrhundert empfinden ARTigo-Spieler die Bilder immer noch als „schön“. Und anders als bei Laborstudien, bei welchen Probanden Bilder mit expliziten Fragestellungen vorgelegt werden, wird nach Schönheit beim ARTigospielen gar nicht gefragt. Der Spieler entscheidet selbst, welche Tags er eingibt. „Baum“ und „Himmel“ sind sichtbar vorhandene Objekte. „Schön“ jedoch, spiegelt den Eindruck der gesehenen Objekte im Bild wider, was einer höheren Verarbeitungstiefe entspringt. Und abgesehen davon: Auch Bilder aus anderen Epochen sind schön. Aber schon rein rechnerisch die Bilder des Klassizismus besonders.
Digitale Bildquelle: www.artigo.org
Künstler: Louis Sené, Titel: Dame in Liebesaltar, Ort: Celle, Bomann-Museum, Datierung: 1794-1794
Es war das erste Bild, das mir von ARTigo bei der Suche nach "schön" angezeigt wurde
Quelle: http://games.hypotheses.org/1889
“Public History” – Sublation of a German Debate?
The English term “Public History” is, as is so common for borrowed foreign words, discursively relaxing; an argumentative deus ex machina. It appears as an ideal compromise in a long …
English
The English term “Public History” is, as is so common for borrowed foreign words, discursively relaxing; an argumentative deus ex machina. It appears as an ideal compromise in a long-lasting and confusing German debate. There is much to be said in favour of this new approach and also for putting an end to theoretical pseudo-debates.
Concerto vivace
The German debate about how to understand the massive increase in public interest in the past, which started in the late 1970s and was particularly focussed on the individual national histories of Germany, Austria, and Switzerland, has been in progress since the end of the 1980s.[1] This debate appears to be increasingly self-referential—the bibliography could fill a book—and it deals with a wide range of competing concepts. Sometimes they refer to special, limited forms such as, for instance, the terms politics of the past (Vergangenheitspolitik; Frei) or politics of history (Geschichtspolitik; Wolfrum). However, they usually claim to cover the entire spectrum of phenomena related to how the past is dealt with publicly: Lieux de mémoire or memorial sites (Erinnerungsorte; Francois/Schulze, Kreis etc.), collective memory (Kollektives Gedächtnis; Assmann & Assmann and others), culture of remembrance (Erinnerungskultur; Cornelissen and others), historical culture (Geschichtskultur; Rüsen, Schönemann and others) and, recently, also in German-speaking areas: Public History (“Öffentliche Geschichte”; P. Nolte)[2]. Within the historical sciences, a prevailing and lively competition between the concepts of culture of remembrance and historical culture has emerged. This conceptual competition, which has become highly charged with respect to science policy, has become a long-standing obstacle to a constructive, scientific investigation of concrete research problems; it leads to a fragmentation of discourse and also prevents institutions from targeting useful strategies.
Simple Solution
Individuals can, of course, pursue their own valid interests; nevertheless, the relationship between the concepts of a culture of remembrance and historical culture is, in substance, completely clear: the culture of remembrance is contemporary historical culture. In other words, the culture of remembrance is, due to its contemporary character, fluid and volatile. Once the negotiated contents of the culture of remembrance are correctly formatted institutionally and viewed calmly, as well as spelled out academically, they become material for historical culture.
The two terms are by no means mutually exclusive; they are, in fact, complementary. What is needed is a dynamic understanding of contemporary history, based on a generational perspective and that does not rely on the common conventions of epochal fixation.[3] Accordingly, contemporary history is consistently understood as the “epoch of those now alive,”[4] or also, as the continuously changing/moving stage of “communicative memory.”[5] In other words, contemporary history is, here, the epoch of contemporary witnesses who, with the privilege, the anxiety, and the furore of personal experience, create non-professional meanings/interpretations that are able to assert themselves alongside professionally underpinned meanings/interpretations. This mixture creates the culture of remembrance, in its authentic sense without allegorical understanding, since the professionals are also involved biographically.
Cooling down these quarrels transforms, so to speak, the discourse on meaning related to the past into a different state, allowing the emergence of historical culture that is partially, but significantly, negotiated, nurtured, and contested in another manner.[6] Thus, the concepts of a culture of remembrance and historical culture not only can be used complementarily[7] but they definitely should be used in this way. Only then is it possible to gain analytical access to the historical dynamics and volatility of the construction of cultural identity.
It is an Umbrella
What remains, naturally, is the more or less obvious theoretical fuzziness, as well as the incompatibility of the two existing terms.[8] Would it not make sense to leave these as they are and to trust that successively more abstract insights into the dynamics of historical culture will result from individual research projects and the discussion thereof, as well as from concrete empirical evidence? More careful observation reveals that both abstract approaches are already used extensively, in the form of an “umbrella-concept,”[9] in research and educational practice. Individual use may frequently differ, but the goal is always the same. This is fine. And this is why one should not pretend to be using—in terms of the analogy—different devices. But there is already another conceptual approach bringing in this respect everyone and everything adequately under an umbrella[10]:
Public History
And now to Public History. The term makes German-language purists sweat, sure. However, I think that the adoption of the concept into German is a wonderful opportunity to put old differences behind us. It is the best “umbrella” that is currently available. Obviously, it offers the important connection to the very broad debate in English[11]; this alone would be a first important benefit. But there are even more advantages:
- Public History makes the actors involved in the communication of history visible, not only as objects for analysis and evaluation; it also supports their positive self-image. This opens the door to a constructive level of communication between production and analytical criticism, whose absence is symptomatically exemplified by the petty, long-lasting bashing to which Guido Knopp[12] was subjected. The important point here is the challenging blending of discourses and not a schrebergartization (a narrow-minded reduction into fragmented allotments).
- The reinforcing amalgamation of the various approaches and professions makes institutional innovations possible. There is a long overdue need to provide students of history with career perspectives besides academia and school teaching. This is already happening in Berlin (FU), Heidelberg, and Cologne. The demand for such professionals exists.
- The english-speaking Public History discourse doesn’t include the research and practics on history teaching in school. That is a blind spot, mutually. And it is a worthful experience German colleagues could invest in a joined debate.
- Finally, the concept of PUBLIC history makes historians whose work is funded by taxpayers’ money increasingly aware of a professional dimension that has to be learned anew: science must go public, now more than ever.
- This, in turn, leads to the heart of the current challenges: Public History must be analysed, understood, and produced digitally; otherwise, it will barely work out today and not at all tomorrow.[13]
____________________
Literature
- The Public Historian (published for the National Council for Public History), University of Califonia Press, ISSN 0272-3433.
- Popp, Susanne u.a. (Hrsg.): Zeitgeschichte – Medien – Historische Bildung. Göttingen 2010 (Beihefte zur Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, 2).
- Zürndorf, Irmgard: Zeitgeschichte und Public History, Version: 1.0, vgl. Docupedia-Zeitgeschichte, 11.02.2010, http://docupedia.de/zg/Public_History (Letzter Zugriff 22.1.2015)
Web resources
- NCPH Guide to Public History Programs, cf. http://ncph.org/cms/education/graduate-and-undergraduate/guide-to-public-history-programs/ (Last accessed 22.01.2015)
- Public History in a Digital World: The Revolution Reconsidered (conference website). http://publichistory.humanities.uva.nl (Last accessed 22.01.2015)
- Public History Commons – History @ Work. Multi-authored, multi-interest blog for all those with an interest in the practice and study of history in public – See more at: http://publichistorycommons.org (Last accessed 28.01.2015)
____________________
[1] See Rüsen, Jörn: Lebendige Geschichte. Göttingen 1989. / Hardtwig, Wolfgang: Geschichtskultur und Wissenschaft. München 1990.
[2] Nolte, Paul: Öffentliche Geschichte. Die neue Nähe von Fachwissenschaft, Massenmedien und Publikum: Ursachen, Chancen und Grenzen. In: Barricelli, Michele / Hornig, Julia (Hrsg.): Aufklärung, Bildung, «Histotainment»? Zeitgeschichte in Unterricht und Gesellschaft heute. Frankfurt/M. 2008, p. 131-146, here especially p. 143.
[3] For a very consistent differentiation between several contemporary histories, see Hockerts, Hans-Günther: Zugänge zur Zeitgeschichte. Primärerfahrung, Erinnerungskultur, Geschichtswissenschaft. In: APuZ (2001) B28, p. 15-30.
[4] As formulated by Hans Rothfels (1952) whose argumentation in his meanwhile classical essay on the subject is admittedly indecisive, as is well known.
[5] Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München 1992, p. 48-56, following Vansina, Jan: Oral Tradition as History. Nairobi 1985.
[6] It is thus only logical that, particularly in Germany, the concept of a culture of remembrance is used very frequently because, as a negative reference to National Socialism, it represents an important aspect of the raison d’état. Consequently, the transition to another form of producing meaning has numerous political and didactic implications. See Volkhard Knigge: Abschied von der Erinnerung. Anmerkungen zum notwendigen Wandel der Gedenkkultur in Deutschland. In: id./ Frei, Norbert (ed.): Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord. München 2002, p. 423-440.
[7] Korte, Barbara / Paletschek, Sylvia: Geschichte in populären Medien und Genres: Vom Historischen Roman zum Computerspiel. In: id. (ed.): History Goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres. Bielefeld 2009, p. 9-60, here p. 11, FN 6.
[8] See Cornelißen, Christoph: Was heißt Erinnerungskultur? Begriff – Methoden – Perspektiven. In: GWU 54 (2003), 548-563. / Demantowsky, Marko: Geschichtskultur und Erinnerungskultur – zwei Konzeptionen des einen Gegenstandes. In: GPD 33 (2005) 1/2, p. 11-20 (online: https://www.academia.edu/4714387/Geschichtskultur_und_Erinnerungskultur._Zwei_Konzeptionen_des_einen_Gegenstandes_2005_, last accessed 22.1.15). See also, amongst others, the contributions of Wolfgang Hasberg (2004/2006) and Elisabeth Erdmann (2007).
[9] Grever, Maria: Fear of Plurality. Historical Culture and Historiographical Canonization in Western Europe. In: Epple, Angelika / Schaser, Angelika (eds.): Gendering Historiography: Beyond National Canons. Frankfurt/M., New York 2009, p. 45-62, here p. 54f.
[10] Jordanova, Ludmilla: History in Practice. London / New York 2000, S. 149 (tnx to Alix Green for the friendly hint).
[11] Note, for instance, the projects and successes of the International Federation for Public History (IFPH) (URL: http://ifph.hypotheses.org, last accessed 22.1.15) or those of the United States National Council for Public History (NCPH) (URL: http://ncph.org , last accessed 22.1.15). An early German inventory Rauthe, Simone: Public History in den USA und der Bundesrepublik Deutschland. Essen 2001. See also Bösch/Goschler with a specific focus Bösch, Frank/ Goschler, Constantin (eds.): Public History. Öffentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft. Frankfurt/M. 2009. See finally the recent foundation of SIG “Applied History” within the Association of German Historians (VHD): http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-angewandte-geschichte.html.
[12] Guido Knopp is a famous and infamous, but anyhow very successful German TV producer, specialized on history broadcasting for a wide audience. See for more information the wikipedia article (weblink).
[13] Hoffmann, Moritz: Geschichte braucht Öffentlichkeit. Vom Nutzen einer digitalen Public History. In: resonanzboden. Der Blog der Ullstein Buchverlage v. 14.01.2015, URL: http://www.resonanzboden.com/satzbaustelle/geschichte-braucht-oeffentlichkeit-vom-nutzen-einer-digitalen-public-history/ (last accessed 22.1.15)
____________________
Image Credits
Arne Eickenberg (2007): A possible mêchanê model as used in ancient Greek theater, http://en.citizendium.org/wiki/File:Mechane_GreekTheater.jpg (Last accessed 21.1.2015).
Recommended Citation
Demantowsky, Marko: “Public History” – Sublation of a German Debate? In: Public History Weekly 3 (2015) 3, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-3292.
Copyright (c) 2015 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: elise.wintz (at) degruyter.com.
Deutsch
Der englischsprachige Begriff “Public History” ist, wie so häufig entlehnte Fremdwörter, diskursiv spannungslösend, ein argumentativer deus ex machina. Er erscheint als idealer Kompromiss in einer lange und verwirrend geführten deutschsprachigen Debatte. Vieles spricht für diesen Neuansatz, Vieles auch dafür, theoretische Scheindebatten zu beenden.
Concerto vivace
Die deutschsprachige Debatte darüber, wie man das seit Ende der 1970er enorm ansteigende öffentliche Interesse an der Vergangenheit, insbesondere der jeweils eigenen nationalen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, verstehen solle, währt schon seit Ende der 1980er Jahre.[1] Sie erscheint zunehmend selbstreferentiell, und man kann dazu in Buchstärke bibliographieren. In dieser Debatte gibt es einen ganzen Strauß konkurrierender Konzepte. Mal bezeichnen sie abgrenzbare Spezialformen, etwa bei den Begriffen der Vergangenheitspolitik (Frei) oder der Geschichtspolitik (Wolfrum). Meist beanspruchen sie aber, den gesamten Phänomenkomplex des öffentlichen Umgangs mit der Vergangenheit zu erfassen: Lieux de mémoire bzw. Erinnerungsorte (Francois/Schulze, Kreis u.v.a.), Kollektives Gedächtnis (Assmann & Assmann u.a.), Erinnerungskultur (Cornelissen u.v.a.), Geschichtskultur (Rüsen, Schönemann u.v.a.) und neuerdings nun auch im deutschsprachigen Raum: Public History resp. Öffentliche Geschichte (P. Nolte)[2]. In der Geschichtswissenschaft hat sich eine dominierende und rege Konkurrenz der Konzepte Erinnerungskultur und Geschichtskultur ergeben. Diese konzeptuelle Konkurrenz, die sich wissenschaftspolitisch stark aufgeladen hat, behindert längst eine konstruktive wissenschaftliche Auseinandersetzung über konkrete Forschungsprobleme, sie führt zur diskursiven Parzellierung. Sie hindert auch sinnvolle institutionelle Weichenstellungen.
Einfache Lösung
Es mag jeder seine berechtigten Interessen verfolgen, der Sache nach ist es jedoch eigentlich vollkommen klar, wie sich die Konzepte Erinnerungskultur und Geschichtskultur zueinander verhalten: Die Erinnerungskultur ist die zeitgeschichtliche Geschichtskultur. Anders formuliert: Erinnerungskultur ist durch ihre zeitgeschichtliche Prägung in einem flüssigen, volatilen Zustand. Sobald die verhandelten Inhalte der Erinnerungskultur institutionell zurechtformatiert und beruhigt sowie akademisch ausbuchstabiert worden sind, werden sie zu Gegenständen der Geschichtskultur.
Beide Begriffe schließen einander also keinesfalls aus, sondern sie verhalten sich vielmehr komplementär zueinander. Vorausgesetzt wird ein dynamisches, generationenbezogenes Verständnis von Zeitgeschichte, das sich nicht auf die üblichen Konventionen der Epochenfixierung[3] einlässt. Zeitgeschichte wird demnach konsequent als die “Epoche der Mitlebenden” verstanden,[4] oder auch als die stetig wandernde Zeitspanne des “kommunikativen Gedächtnisses”.[5] Mit anderen Worten ist Zeitgeschichte hier die Epoche der Zeitzeugen, die mit dem Recht, der Angst und dem Furor des Erlebthabens non-professionelle Sinnstiftungen produzieren, die sich neben professionell verstärkten Sinnstiftungen zu behaupten vermögen. Dieses Gemenge stellt Erinnerungskultur im eigentlichen, also nicht-allegorischen Sinne her (zumal ja auch die Profis biographisch involviert sind). Die Erkaltung dieser Händel überführt den vergangenheitsbezogenen Sinnstiftungsdiskurs gleichsam in einen anderen Aggregatzustand, lässt Geschichtskultur entstehen, die partiell, aber signifikant auf andere Weise verhandelt, gepflegt und bestritten wird.[6] Die Konzepte Erinnerungskultur und Geschichtskultur können also nicht nur ergänzend verwendet werden,[7] sie sollten es auch unbedingt. Erst dadurch erlangt man nämlich einen analytischen Zugriff auf die historische Dynamik und Volatilität kultureller Identitätskonstruktion.
Es ist ein Schirm
Es bleiben natürlich noch die mehr oder minder ausgeprägten theoretischen Unschärfen und die Inkompatibilitäten beider Konzepte.[8] Wäre es nicht sinnvoll, diese pragmatisch auf sich beruhen zu lassen, und darauf zu vertrauen, dass sich aus einzelnen Forschungsprojekten und ihrer Diskussion, aus der konkreten Empirie, sukzessive abstraktere Einsichten in geschichtskulturelle Dynamiken ergeben? Wenn man genau hinschaut, werden beide abstrakte Ansätze in Forschung und Vermittlungspraxis längst als “Umbrella-Konzepte”[9] verwendet: Jeder benutzt sie immer wieder anders, aber alle zum gleichen Zweck. Gut so. Und deshalb sollte man auch nicht so tun, als ob man – um im Gleichnis zu bleiben – verschiedene Geräte benutzen würde. Es gibt übrigens in dieser Hinsicht ein begriffliches Konzept, dem schon sehr früh und mit grosser Wirkung die Fähigkeit und Aufgabe zugeschrieben worden ist, alle und alles adäquat unter einen Schirm zu bringen[10], und zwar:
Public History
Und jetzt also das, Public History. Allen SprachpuristInnen steht gewiss der Schweiß auf der Stirn. Mir scheint die deutschsprachige Adoption dieses Konzepts aber eine glückliche Gelegenheit zu sein, alte Differenzen hinter sich zu lassen. Es ist der beste “Schirm”, den man derzeit finden kann. Selbstverständlich bietet er den wichtigen Anschluss an die sehr reiche englischsprachige Debatte,[11] das allein wäre ein erstes gewichtiges Plus. Aber es gibt da noch mehr Vorteile:
- Public History macht die AkteurInnen der historischen Vermittlungspraxis nicht nur als Analyse- und Urteilsobjekte sichtbar, sondern eignet sich auch für deren positives Selbstverständnis. Das eröffnet endlich eine konstruktive Kommunikationsebene zwischen “praktischer” Produktion und “theoretischer” Kritik, deren Fehlen sich im jahrelangen billigen Knopp-Bashing symptomatisch exemplifiziert hat. Auch hier kommt es doch auf ein herausforderndes Verbinden von Diskursen an und nicht auf eine spießige Schrebergartisierung.
- Die stärkende Verbindung der unterschiedlichen Ansätze und Professionen macht institutionelle Innovationen möglich. Wie in Berlin (FU), Heidelberg und Köln geschehen, ist es längst nötig, Geschichtsstudierenden neben Wissenschaft und Schule weitere fachberufliche Perspektiven zu erschließen. Die doppelte Nachfrage gibt es. Die Universitäten sollten dieser Verantwortung nachkommen.
- Der englischsprachige Public-History-Diskurs bezieht ausweislich seiner gängigen Definitionen bis heute die Geschichtsdidaktik (“history teaching”) nicht mit ein. Das erzeugt wechselseitig blinde Flecken. Hier hat der deutschsprachige Diskurs etwas Wichtiges zu bieten.
- Schließlich rückt das Konzept der PUBLIC History eine professionelle Dimension aller steuermittelfinanzierter HistorikerInnen ins Bewusstsein, die von vielen erst wieder erlernt werden muss: Wissenschaft muss sich öffentlich machen, mehr denn je.
- Dies führt wiederum zum letzten Kern aktueller Herausforderungen: Public History muss als digitale analysiert, begriffen und produziert werden, oder sie hat kaum heute und kein morgen.[12]
____________________
Literatur
- The Public Historian (published for the National Council for Public History), University of Califonia Press, ISSN 0272-3433.
- Popp, Susanne u.a. (Hrsg.): Zeitgeschichte – Medien – Historische Bildung. Göttingen 2010 (Beihefte zur Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, 2).
- Zürndorf, Irmgard: Zeitgeschichte und Public History, Version: 1.0, vgl. Docupedia-Zeitgeschichte, 11.02.2010, http://docupedia.de/zg/Public_History (Letzter Zugriff 22.1.2015)
Webressourcen
- NCPH Guide to Public History Programs, vgl. http://ncph.org/cms/education/graduate-and-undergraduate/guide-to-public-history-programs/ (zuletzt am 22.01.2015)
- Public History in a Digital World: The Revolution Reconsidered (conference website). http://publichistory.humanities.uva.nl (zuletzt am 22.01.2015)
- Public History Commons – History @ Work. Multi-authored, multi-interest blog for all those with an interest in the practice and study of history in public – See more at: http://publichistorycommons.org (zuletzt am 28.01.2015)
_________________
[1] Siehe Rüsen, Jörn: Lebendige Geschichte. Göttingen 1989. / Hardtwig, Wolfgang: Geschichtskultur und Wissenschaft. München 1990.
[2] Nolte, Paul: Öffentliche Geschichte. Die neue Nähe von Fachwissenschaft, Massenmedien und Publikum: Ursachen, Chancen und Grenzen. In: Barricelli, Michele / Hornig, Julia (Hrsg.): Aufklärung, Bildung, «Histotainment»? Zeitgeschichte in Unterricht und Gesellschaft heute. Frankfurt/M. 2008, S. 131-146, hier v.a. S. 143.
[3] Bis hin zur sehr konsequenten Unterscheidung mehrerer Zeitgeschichten bei Hockerts, Hans-Günther: Zugänge zur Zeitgeschichte. Primärerfahrung, Erinnerungskultur, Geschichtswissenschaft. In: APuZ (2001) B28, S. 15-30.
[4] In einer Formulierung von Hans Rothfels (1952), der in seinem klassisch gewordenen Aufsatz in dieser Sache allerdings bekanntermaßen unentschieden argumentiert.
[5] Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München 1992, S. 48-56, im Anschluss an Vansina, Jan: Oral Tradition as History. Nairobi 1985.
[6] Es ist deshalb nur folgerichtig, dass insbesondere in Deutschland das Konzept Erinnerungskultur sehr häufig verwendet wird, stellt sie hier doch als negativer Bezug auf den Nationalsozialismus einen wichtigen Teil der Staatsräson dar. Deshalb besitzt der Übergang in eine andere Form der Sinnstiftungsproduktion viele politische und didaktische Implikationen. Siehe Knigge, Volkhard: Abschied von der Erinnerung. Anmerkungen zum notwendigen Wandel der Gedenkkultur in Deutschland. In: ders./Frei, Norbert (Hrsg.): Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord. München 2002, 423-440.
[7] Korte, Barbara / Paletschek, Sylvia: Geschichte in populären Medien und Genres: Vom Historischen Roman zum Computerspiel. In: dies. (Hrsg.): History Goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres. Bielefeld 2009, S. 9-60, hier S. 11, FN 6.
[8] Siehe Cornelißen, Christoph: Was heißt Erinnerungskultur? Begriff – Methoden – Perspektiven. In: GWU 54 (2003), 548-563. / Demantowsky, Marko: Geschichtskultur und Erinnerungskultur – zwei Konzeptionen des einen Gegenstandes. In: GPD 33 (2005) 1/2, S. 11-20 (online: https://www.academia.edu/4714387/Geschichtskultur_und_Erinnerungskultur._Zwei_Konzeptionen_des_einen_Gegenstandes_2005_, zuletzt am 22.1.15). Siehe u.a. auch die Beiträge von Wolfgang Hasberg (2004/2006) und Elisabeth Erdmann (2007).
[9] Grever, Maria: Fear of Plurality. Historical Culture and Historiographical Canonization in Western Europe. In: Epple, Angelika / Schaser, Angelika (eds.): Gendering Historiography: Beyond National Canons. Frankfurt/M., New York 2009, S. 45-62, hier S. 54f.
[10] Jordanova, Ludmilla: History in Practice. London / New York 2000, S. 149 (vielen Dank an Alix Green für den Literaturhinweis!).
[11] Man beachte hier beispielhaft nur die Projekte und Erfolge der International Federation for Public History (IFPH) (URL: http://ifph.hypotheses.org, Letzter Zugriff 22.1.15) oder des US-amerikanischen National Council for Public History (NCPH) (URL: http://ncph.org, Letzter Zugriff 22.1.15). Ein frühe Bestandaufnahme bei Simone Rauthe: Public History in den USA und der Bundesrepublik Deutschland. Essen 2001. Siehe auch Bösch/Goschler mit einem spezifischen Untersuchungshorizont Bösch, Frank/ Goschler, Constantin (eds.): Public History. Öffentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft. Frankfurt/M. 2009. Siehe schließlich auch die jüngste Gründung einer AG Angewandte Geschichte im VHD (http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-angewandte-geschichte.html).
[12] Hoffmann, Moritz: Geschichte braucht Öffentlichkeit. Vom Nutzen einer digitalen Public History. In: resonanzboden. Der Blog der Ullstein Buchverlage v. 14.01.2015, URL: http://www.resonanzboden.com/satzbaustelle/geschichte-braucht-oeffentlichkeit-vom-nutzen-einer-digitalen-public-history/ (Letzter Zugriff 22.1.15)
____________________
Abbildungsnachweis
Arne Eickenberg (2007): Visualisierung einer mêchanê, wie sie im Theater des antiken Griechenlands zur Anwendung gelangte, http://en.citizendium.org/wiki/File:Mechane_GreekTheater.jpg (Letzter Zugriff 21.1.2015).
Empfohlene Zitierweise
Demantowsky, Marko: “Public History” – Aufhebung einer deutschsprachigen Debatte? In: Public History Weekly 3 (2015) 3, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-3292.
Copyright (c) 2015 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: elise.wintz (at) degruyter.com.
The post “Public History” – Sublation of a German Debate? appeared first on Public History Weekly.
Quelle: http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/3-2015-2/public-history-sublation-german-debate/
Ab wann sehen Babys dreidimensional?
Die Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung entsteht im ersten Lebensjahr. Dies zeigen zahlreiche Studien mit den unterschiedlichsten experimentellen Anordnungen (z.B. Gibson & Walk, 1960; Kellman & Arterberry, 2006). Wann genau entwickelt sich die Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung? Wir erforschen in unserem Projekt die … Weiterlesen →
Das DX7R1 Friedrich Barbarossas
Ich weiß nicht, was Friedrich Barbarossa am 26. März 1162 auf dem Weg nach Mailand tat. Wenn er sich zugleich bibelfest und christophanisch-anmaßend betätigt hätte, dann wohl Folgendes:
„Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: 'Wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tage, was zu deinem Frieden dient! […] Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen; und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum daß du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.'“1
Vielleicht hatte Mailand die Zeit seiner Heimsuchung nicht erkannt. Vielleicht hatte die stolze Po-Metropole die Entschlossenheit ihres Gegners unterschätzt. Denn der bärtige Staufer aus dem Norden hatte ein Heer bei sich und Krieger, die für ihn kämpften.
Und später gab es Menschen, die wussten, warum die Kämpfer kämpften. Natürlich! Keine Frage! Die Soldaten zogen gegen Papisten und Partikularisten in die Schlacht und riefen „Für die Einheit des Deutschen Reiches! Gegen den Stachel der Stadtherrschaft im Fleisch des Stauferreichs!“ Und die Historiker grinsten zufrieden, denn Barbarossa siegte.
Dann kam Knut Görich und gab den Kämpfern einen neuen Schlachtruf. Heute schreien dieselben Krieger vor Mailand „Für die Ehre des Kaisers!“ Wiederum grinsten die Historiker_innen zufrieden, denn sie hatten abermals einen Sieg über ihre Vorgänger des 19. Jahrhunderts errungen.
Aber während wir den „Ehre, Ehre!“-Rufen lauschen, sollten wir unser Grinsen gegen einen skeptischen Gesichtsausdruck eintauschen und uns fragen, ob Mitbrüllen hier ratsam ist. Oder anders gefragt: Wenn wir „Ehre“ sagen – wie nahe sind wir dann an den „Ehre! Ehre“ schreienden Rittern des Rotbarts? Und: Wollten wir da eigentlich hin? Sollten wir so nah überhaupt sein?
Vor einigen Wochen fand in Tübingen ein Workshop zu „Ehre und Hof“ statt. Arrivierte und Nachwachsende diskutierten unterschiedliche Quellen aus unterschiedlichen Zeiten, in denen es um „Ehre“ gehen sollte. Auch der Verfasser war zugegen und verspürte bald das berühmte diffuse Unbehagen. Natürlich verhandelte man – und zuweilen heftig – Kleinfragen wie die nach der Zusammensetzung des Straßburger Aufgebots für den Italienzug 1401. Davor, danach und darüber jedoch schwebte etwas Diffuses über den Geistern. Und das Diffuse blieb namenlos.
Die „Ehre“ war allgegenwärtig und in jedem Satz. Weil man mit einem Wort allein keine Wissenschaft betreiben kann, bemühten sich alle, die Sache durch weitere Abstrakta konkreter zu machen. Die Vokabeln, die immer wieder zu hören waren -- in alphabetischer Reihenfolge:
Ansehen
Autorität
Gesichtswahrung
Prestige
Rang, Ranganspruch
Ruf
soziales Kapital
Status
Stellung
Stolz
Würde
Je mehr Ausdrücke fielen, desto weniger wusste ich, worüber eigentlich geredet wurde. Heute meine ich: All diese Ausdrücke zielen auf einen Kern.
Beginnen wir mit einer Kopfreise. Wenn wir uns aufmachen und Köpfe sezieren, bei Fackelschein und Neonlicht nachschauen, was in so einem mittelalterlichen Kopf eigentlich drin war – was würden wir finden? Bei Lateinkundigen fänden wir in der Vokabelschatztruhe sicherlich den honor. Kämen wir in einen mittelalterlichen Adelskopf, sähen wir sicherlich ein wohlgehegtes und gut gegärtnertes Pflänzchen namens „Ehre“. Ich bin sicher, dass es an zentraler Stelle wäre. Das „Ehre“-Pflänzchen aber wäre errichtet auf einem großen Haufen. Einem Sammelbecken mit Zuflüssen aus Bewusstem und Unbewusstem. Mit großen Brocken aus antrainierten Verhaltensweisen und Gruppendynamiken. Das alles in steter Umwälzung. Manchmal blitzten darin Dinge auf, denen wir Namen geben könnten: „Beleidigte Leberwurst!“, „Gerne-im-Mittelpunkt-Stehen“, „Wichtig-sein-Wollen“, „Anerkennung-haben-Wollen“. Aber das große Ganze betrachten wir ratlos. Im mittelalterlichen Kopf hat dieser Haufen kein Schild und wir haben kein Wort dafür. Beenden wir die Kopfreise an dieser Stelle, indem wir zugeben, dass sie zum einen nicht möglich ist und uns zum anderen in jedem Kopf mit anderen Dingen konfrontieren würde.
Tatsache aber ist – und darum geht es hier –, dass wir in Quellen etwas sehen, was uns zur Annahme berechtigt, dass das, was ich versucht habe, mit „Haufen“ zu beschreiben, in mehreren (und wichtigen) Köpfen vorhanden gewesen sein könnte. Es ist das Verdienst Knut Görichs, auf diesen Haufen im Mittelalterkopf aufmerksam gemacht zu haben. Viel zu lange haben Forschergenerationen den Haufen übersehen oder beiseite geräumt und nach Dingen wie „dem politischen Konzept“, den „verfassungsmäßigen Überzeugungen“ gesucht. Der Haufen ist wichtig und wir sollten ihn im Blick behalten. Aber es war wenig sinnvoll, diesen Haufen „Ehre“ zu nennen.
„Ehre“ heißt nämlich schon das Pflänzchen. Über Ehre stritten schon die Zeitgenossen. Man darf sich vorstellen, dass die Erzieher junger Adliger zugleich Ehrzieher waren und den kleinen Blaublütigen einbläuten, dass sie auf ihre Ehre zu achten hätten wie auf stets blitzende Waffen. Man sprach im 12. Jahrhundert von êre. (Natürlich, liebe Pedant_innen, nicht in dieser normalisierten Form, sondern in der jeweiligen Aussprache und Schreibweise des jeweiligen Dialekts des Mittelhochdeutschen.) Der Begriff „Ehre“ war da. Aber gemeint war damit nicht der ganze Haufen, nicht all das Diffuse, Unbewusste, das Chaos ohne Schild. Gemeint war das Pflänzchen. Der Haufen hatte keinen Namen. Und das ist ein Problem für uns.
Denn wir wissen viel zu selten, worüber wir eigentlich reden: Sprechen wir vom Pflänzchen, vom damaligen Ehr-Konzept, von der Ehr-Idee, von dessen Etikett, dem honor? Oder reden wir von dem diffusen Haufen aus Bewusstem und Unbewusstem, aus Gedanken, Vorstellungen, Debatten und antrainiertem Sozialverhalten, den wir in mittelalterlichen Köpfen sehen und dessen Kenntnis uns hilft, besser zu verstehen, was damals eigentlich vor sich ging?
Die Lösung des Problems ist einfach: Ein Ausdruck für den Haufen muss her, ein völlig unschuldiger. Kein Wort, das in irgendeiner Weise belastet wäre. Am besten international.
Und warum sich die Mühe machen, selbst etwas zu finden, wenn wir doch Elektroknechte haben, die das für uns tun können? Flugs einen String-Generator zur Hand, so lange, auf „generate“ gedrückt, bis etwas Schönes, Unvergebenes herauskam. Und geboren war das „DX7R1“.
Heißt das etwa, ich fordere Sätze wie „DX7R1 spielte im Elitengefüge und der sozialen Interaktion des 12. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle.“? Ja, genau das heißt das.
Vermieden ist damit zunächst das Waffen-SS-Problem. „Meine Ehre heißt Treue“ trugen sie auf dem Koppelschloss und das wirkte nach. 2004 schloss Herbert Maeger, ein ehemaliger Leibstandarten-Rottenführer, seine Kriegserinnerungen mit den Worten: „Am Ende verloren sie [die Angehörigen der Waffen-SS], die Überlebenden wie die Toten, ihre Ehre; ihre Treue war schon Jahre vorher von einer gewissenlosen Führung schamlos verraten worden.“2 Die „Ehre“ steckt mithin mittendrin im Vergangenheitsbewältigungsschlamassel. Ich weiß nicht, ob sie schon Versöhnungstreffen organisiert und Museen eröffnet hat, aber vollständig entnazifiziert ist sie nicht.
Für DX7R1 ist noch niemand in den Krieg gezogen, kein Blut vergossen worden und auch keins in Wallung geraten.
Ich weiß nicht, ob andere Ähnliches bereits machen oder vorgeschlagen haben.3 Durchgesetzt hat es sich – zumindest in der Mediävistik – bislang nicht. (Und was die Soziologen tun, ist mir zumeist herzlich egal.) Auch wenn dieser kleine Beitrag sicherlich nicht das Läuten aller Paradigmenwechsel-Glocken bewirkt, meine ich doch, dass Anregungen zu einer besseren methodischen Welt nötig sind.
Von der These, man dürfte Geschichte nicht mit modernen Begriffen schreiben, habe selbst ich schon gehört. Sie ist aber – zumindest in dieser meiner Zuspitzung – falsch und ein Denkfehler. Nicht in Quellenbegriffen zu sprechen ist ein Vorteil, kein Nachteil. Quellenbegriffe sind wie klammernde Mütter: Man fühlt sich bei ihnen zu Hause, geborgen, man hat es schön warm bei ihnen, sie hegen und pflegen uns. Aber sie lassen uns nicht gehen und nicht frei die Welt mit unseren Augen sehen. Man muss oft den berühmten Schritt hinaus in die Kälte machen, um Übersicht und Vogelperspektive zu gewinnen. Wir müssen uns dann und wann vom Quellenwortlaut lösen. Tun wir das, ziehen wir uns selbst aus dem Modemorast.
Das häufigste Substantiv in Regierungserklärungen Angela Merkels ist „Europa“. – Käme jemand auf die Idee, aus diesem Befund ihre Regierungspolitik zu verstehen? Ist jemals von einem seriösen Analysten dieser Satz zu erwarten: „Je öfter die Kanzlerin Europa sagt, desto mehr Kompetenzen will sie von Berlin nach Brüssel verlagern“? Politische Modewörter sind am Ende nur eines: Modewörter. Sie sagen zwar Einiges, aber nicht alles. Das war vor 1000 Jahren nicht anders. Manchmal sollten wir unseren Quellen – gerade den Urkunden – getrost zurufen: „Ihr redet in einem fort von honor? Ok, haben wir zur Kenntnis genommen und durchschaut. Das war eben euer 'Europa' und euer Modewort.“
Jedoch: Mit DX7R1 entkommen wir nicht nur, wir kommen auch weiter.
Noch einmal: Wenn wir von „Ehre“ reden, behaupten wir damit, dem zeitgenössischen Begriff davon zumindest nahezukommen. Wenn wir von DX7R1 reden, meinen wir den diffusen Haufen, der den zeitgenössischen Ehrbegriff umschließt, aber nicht darauf beschränkt ist. Diese Unterscheidung hilft uns, weiter zu fragen, genauere Fragen zu stellen.
Dass für Friedrich Barbarossa „Ehre“ wichtig war, wissen wir spätestens seit Görichs Habilitationsschrift von 2000. Die Frage aber, was das DX7R1 Barbarossas ausmachte, ist – bei allem Respekt vor der Leistung Görichs und anderer – noch ungeklärt. Von „Ehre“ redeten alle -- wo jedoch ist das speziell Königliche, das individuelle Friedrich'sche? Wie viel „Ich bin der König, ihr alle nicht und das muss ich euch allen ständig beweisen“, wie viel „Ich mach hier nur das, was alle Adligen machen“ und wie viel „beleidigte Leberwurst“ machte Barbarossas DX7R1-Mischung aus? Was machte sie aus handverlesenen Zutaten einzigartig im Geschmack? Antworten kommen wir nicht näher, wenn wir weiter nur über „Ehre“ sprechen.
Spannend wird es – das ist schon lange erkannt worden – im Angriffsfall. Wenn man einen anderen beleidigt, seine Position infrage stellt oder schmäht – dann kommt der Spannungsfall, dann kommt der Konflikt. Worin aber fühlten sich die Eliten des 12. Jahrhunderts dann und wann gekränkt? In ihrer „Ehre“ oder ihrem DX7R1? Natürlich kann man sich in etwas getroffen fühlen, für das man gar keinen Begriff hat. Ein vierjähriges Kind, das sich von seinen Eltern missachtet fühlt, kann sehr wohl in seinem DX7R1 beleidigt sein, in seiner „Ehre“ wohl kaum. Diese Unterscheidung hilft uns weiter. Fühlte man sich im 12. Jahrhundert im Konfliktfall hinsichtlich einer klar artikulierten Idee, eines klar umrissenen und anerzogenen Konzepts „Ehre“ getroffen – oder in einem diffusen Etwas, für das man keinen Begriff hatte? Antworten werden schwer zu finden sein, aber Fragen müssen gestellt werden.
Eng damit verbunden ist ein ätiologisches Problem: Warum fing man überhaupt an, von „Ehre“ zu sprechen? Auch hier hilft klare Begriffsscheidung: Vielleicht war der namenlose Haufen schuld. Vielleicht bekam man Angst vor ihm und seinen Abgründen. Man mag den diffusen Haufen, das DX7R1, gefühlt haben, man mag gesehen haben, zu welchen Reaktionen dieses wabernde Ding die Menschen trieb – und vielleicht begann man, sich zu fürchten und den Haufen einzuhegen. Man mag begonnen haben, den Abgrund mit einem Begriff zu begrünen, man erfand Regeln für den Haufen, man sperrte den Haufen in einen Diskurs und stülpte dem Abgrund ein Sicherungsnetz über, das man „Ehre“ nannte. Das ist gewiss Fiktion. Aber: Selbst wenn es diese Prozesse gegeben haben sollte und selbst wenn sie sich in Quellen niedergeschlagen haben sollten – solange wir DX7R1 nicht vom zeitgenössischen „Ehrbegriff“ trennen, bleiben wir blind für diese Fragen.
Schließlich können wir die leidige Frage – so sie denn überhaupt eine ist – ob „Ehre“ etwas „typisch Mittelalterliches“ sei, getrost im Recycling-Hof der Geschichte abgeben. Sie müsste jetzt nämlich lauten „Sagt es etwas über das Mittelalter, charakterisiert es gar diese Epoche, dass heutige Forscher das DX7R1 der Menschen zwischen 500 und 1500 gerne als 'Ehre' bezeichnen?“ – und führte damit ins Nichts. Aber: Was unterscheidet unser DX7R1 von dem Barbarossas? Darüber sollten wir reden!
In der politischen Berichterstattung der BRD des frühen 21. Jahrhunderts ist recht wenig von „Ehre“ die Rede, dafür aber viel von „Beschädigten“: „Nach Rücktritt Schavans: Merkel beschädigt“4 – Was genau an Merkel ist hier „beschädigt“? Wohl kaum ihr honor, aber mit Sicherheit ihr DX7R1! Nach den feinen Unterschieden und den grundsätzlichen Gemeinsamkeiten können wir jetzt endlich fragen.
Vielleicht kommen wir mit DX7R1 von einem allgemeinen Alteritätsgefühl zu speziellen Alteritätserkenntnissen.
[1] Lukas 19,41-44, Übersetzung: Elberfelder 1905
[2] Herbert Maeger, Verlorene Ehre - Verratene Treue. Zeitzeugenbericht eines Soldaten (Rosenheim 2005) S. 399
[3] Damit soll keineswegs gesagt werden, dass das Problem von Begriffsbildung und -nutzung noch nie thematisiert wurde. Das Gegenteil ist der Fall. Etwa Peter von Moos, Das Öffentliche und das Private im Mittelalter. Für einen kontrollierten Anachronismus, in: Das Öffentliche und das Private in der Vormoderne, hg. von Gert Melville und dems. ( Köln 1998) S. 3-83, hier bes. S. 10-11
[4] Frankfurter Rundschau vom 10. Februar 2013 http://www.fr-online.de/der-fall-schavan/nach-ruecktritt-schavans-merkel-beschaedigt-,21666736,21710698.html
Ein Hinweis in eigener Sache: Man mag mir vorwerfen, ich predige etwas Anderes, als ich tue. Ich habe an dieser Stelle vor wenigen Monaten eine neue Darstellungsart vorgeschlagen (die sich bislang nicht flächendeckend durchgesetzt hat). Ich habe seither für knochentrocken Quellenkritisches nichts Besseres entdeckt. Aber ein Essay wie das vorliegende will Leser_innen eher unterhalten und irritieren als kleinteilig argumentativ überzeugen. Es ist in diesem Sinne eher Kriminalroman als wissenschaftlicher Aufsatz.
C’est le sens de la vie! / #wbhyp
Vor wenigen Tagen nahm dieser Blog an der Blogparade #wbhyp bereits teil. Meine Kollegin Angelika Schoder schrieb dazu den Beitrag „Wissenschaftliches Bloggen mit Motny Python“. Was Sie gerade lesen, ist nun der Versuch meine – sehr subjektive – Meinung zu ihrem Artikel zu äußern. Darum habe ich es betitelt mit einer Zeile aus dem Monty Python Lied „The Meaning of Life“ – aus dem gleichnamigen Film. Es wurde von Anne Baillot in ihrem Beitrag zur Blogparade festgestellt, dass Bloggen in wissenschaftlichen / akademischen Kreisen kaum […]
Marxistische Kunstgeschichte zwischen Möglichkeit und Notwendigkeit, Wien, 27. und 28. November 2015
Symposium „Aber etwas fehlt. But something’s missing.“ Marxistische Kunstgeschichte zwischen Möglichkeit und Notwendigkeit
27. und 28. November 2015, Wien, mumok Museum moderner Kunst
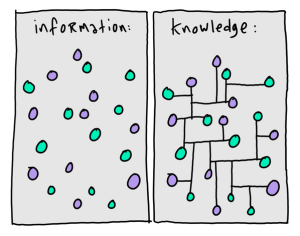 „Aber etwas fehlt!“, insistiert Paul Ackermann, eine der Zentralfiguren von Bert Brechts Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (1930), gegenüber seinen das Leben feiernden FreundInnen. Inmitten dieser Hochburg des Vergnügens, der „Netzestadt“ Mahagonny, die die Arbeit abgeschafft hat und in der für Geld jeder Spaß zu kaufen ist, verspürt Paul Ackermann einen Phantomschmerz. Heute scheint die Situation, die Brechts Mahagonny ausmalt, durchaus realistisch: die Existenz einer Welt, in der Arbeit nicht mehr den Kern der gesellschaftlichen Synthese bildet und in der es dennoch keinen Grund zum Feiern gibt.
„Aber etwas fehlt!“, insistiert Paul Ackermann, eine der Zentralfiguren von Bert Brechts Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (1930), gegenüber seinen das Leben feiernden FreundInnen. Inmitten dieser Hochburg des Vergnügens, der „Netzestadt“ Mahagonny, die die Arbeit abgeschafft hat und in der für Geld jeder Spaß zu kaufen ist, verspürt Paul Ackermann einen Phantomschmerz. Heute scheint die Situation, die Brechts Mahagonny ausmalt, durchaus realistisch: die Existenz einer Welt, in der Arbeit nicht mehr den Kern der gesellschaftlichen Synthese bildet und in der es dennoch keinen Grund zum Feiern gibt.
Über weite Strecken des 20. Jahrhunderts waren VertreterInnen der marxistischen Kunstgeschichte wie Lu Märten, Arnold Hauser, Meyer Schapiro, T. J. Clark, Carol Duncan oder Linda Nochlin entscheidende ImpulsgeberInnen für die Verknüpfung gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen mit der Frage nach der Relevanz der Kunst. Es war die marxistische Kritik, die das Produktionsumfeld der Werke und ihrer ErzeugerInnen in die Kunst hineinzog und damit die Kunst aus der gesellschaftlichen Isolation der repräsentativen Exzellenz herausführte.
Die globale Krise, die seit 2008 anhält, hat die Ausgangslage verändert: Sie ist keine Krise der Arbeit, sondern eine ihrer Finanzialisierung; menschliche Arbeitskraft scheint darin nur mehr ein sekundärer Faktor zu sein. Wie lässt sich unter diesen Vorzeichen eine materialistische Kunstgeschichte praktizieren, deren Methodologien doch immer zentral auf die synthetische Kraft der Arbeit aufbauten? Gilt es, die Arbeit wieder ins Zentrum der gesellschaftlichen Wahrnehmung zurückzubringen?
Oder lässt sich ein Materialismus denken, der Kunst jenseits der Arbeit diskutiert? „Aber etwas fehlt. But something’s missing.“ will die Produktivität einer aktualisierten materialistischen Kunstgeschichte für die Gegenwartskunst behaupten und sich deshalb im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen explizit jenen Kunstgeschichten widmen, die seit den 1960er-Jahren materialistische Ansätze zum Ausgangspunkt ihres Kunstverständnisses gemacht haben. Die Befragung der Geschichte(n) der marxistischen Kunstgeschichte – ihrer politischen und ästhetischen Parameter – soll mögliche Wege in die Gegenwart aufzeigen. Dabei wird das aktuelle Verhältnis zwischen „marxistisch“ und „politisch“ ebenso zur
Diskussion stehen wie die Frage, wie sich eine Institution wie das mumok innerhalb einer solchen Auseinandersetzung verorten kann.
Konzept: Kerstin Stakemeier und Manuela Ammer
Quelle: Presseinformation – mumok-Jahresprogramm 2015 – 15. Jänner 2015
mumok Museum moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien
Museumsplatz 1, 1070 Wien
www.mumok.at
Einsortiert unter:Ausstellung, Erfahrungen, Historiker, Interna, Methodik, Museum
Forschungsgeschichte der Aktenkunde I: Wegbereiter im frühen 20. Jh. #wbhyp
Wer sich aktenkundliches Rüstzeug für eigene Archivstudien zulegen will, wird mit einer hochspezialisierten Forschung konfrontiert, deren Wege nicht immer geradlinig waren. Die Serie "Forschungsgeschichte der Aktenkunde" soll diese Wege abschreiten. Parallel entsteht eine aktenkundliche Basisbibliografie, die die besprochenen Werke systematisch nachweist.
Ich verstehe diese Serie auch als Exempel zur Blogparade "Wissenschaftsbloggen: zurück in die Zukunft" (#wbhyp). Hier verwerte ich Material aus einem Buchprojekt, das aufgrund der bekannten Krise des wissenschaftlichen Buchmarkts nicht zustande gekommen ist. Ganz abgesehen davon, dass die Darstellung im Blog-Format nicht mehr an physische Grenzen stößt: Umfang, Links usw. – in diesem Format
- kann eine Wissenschaftsgeschichte einer Spezialdisziplin überhaupt erscheinen,
- kann sie das angestrebte Publikum am besten erreichen und
- kann sie fortgeführt und ergänzt werden.
Auf Frau Königs Aufruf, herauszufinden warum sich das Bloggen "trotzdem" lohnt, kann ich für mein Exempel nach der Umstellung von Papier auf digital nur mit eigener Überraschung entgegnen: So etwas lohnt sich eigentlich nur im Wissenschaftsblog! Wer sich seiner Sache sicher ist, kann sich auch dem Medium anvertrauen. Wo Blogs weiße Flecken füllen, die das Papier auf seinem Rückzug hinterlässt, werden sie rezipiert werden.
Nun aber zur Sache!
* * *
Die Aktenkunde ist eine praktische Wissenschaft. Aus der praktischen Beschäftigung mit Akten in Archiven ist sie auch entstanden: einerseits aus der Ordnung und Verzeichnung von Archivgut, andererseits aus kritischen Editionen von Aktenstücken. Den Anstoß gab die Bewältigung frühneuzeitlichen Materials im charakteristischen Kanzleistil des Ancien Régime, der nach den Reformen des 19. Jhs. der aktiven Generation von Historikern und Archivaren fremd geworden war und deshalb mit wissenschaftlicher Methodik durchdrungen werden musste.
Wurzeln in der Urkundenforschung
Die Methodenlehre des Fachs ist freilich nicht vom Himmel gefallen. Den Boden hat die Diplomatik bereitet, die zur selben Zeit vom Werkzeug der Quellenkritik hoch- und frühmittelalterlicher Urkunden zu einer umfassenderen Lehre von urkundlicher Schriftlichkeit auch im Spätmittelalter weiterentwickelt wurde. Methodisch rückte dabei der Entstehungszusammenhang der Schriftstücke in den Fokus.
Als Zentralorgan der neuen Diplomatik wurde 1908 das Archiv für Urkundenforschung (AUF, heute: Archiv für Diplomatik) begründet. Die neue Zeitschrift sollte auch Raum für Studien bieten, "die sich mit dem Register-, Akten- und Behördenwesen im Übergang zur Neuzeit beschäftigen" und sich neben Urkunden im engeren Sinne auch mit "Entwürfen und Konzepten, [...] Briefen, Akten und Büchern der gleichen Behörden oder Schreibstuben" befassen sollte. Für die Herausgeber, die dieses Programm in der Einleitung zum ersten Band des AUF aufstellten, war außerdem klar, dass "mit den Urkunden und Akten stets auch die Geschichte der entsprechenden Behördenorganisation erforscht [...] werden soll" (Brandi/Bresslau/Tangl 1908: 2 f.).
Michael Tangl (1861–1921), einer der Herausgeber, trug als akademischer Lehrer zur Verbreitung dieses Ansatzes bei, der (wie Henning 1999: 110 bemerkt) seine eigentliche Verwirklichung in der Aktenkunde fand, auch wenn aufseiten der Diplomatik noch hervorragende, auch aktenkundlich einschlägige Studien wie Spangenbergs Arbeit zu den Kanzleivermerken (1928) erschienen. Tangl war aus dem österreichischen Archivdienst hervorgegangen und lehrte zunächst in Marburg und dann in Berlin mittelalterliche Geschichte.
Marburg und Berlin sind die beiden Orte, mit denen die Forschungsgeschichte der Aktenkunde vielfach verknüpft ist. Maßgeblich, aber nicht ausschließlich, hängt dies mit der Ansiedlung der Ausbildungseinrichtungen für Archivare in Preußen, der DDR und der Bundesrepublik zusammen. Wichtig ist, dass diese Orte im Laufe der Zeit auch begannen, für unterschiedliche Denkschulen zu stehen.
Friedrich Küch: Aktenkunde in der Archivarbeit
Zum 400. Geburtstag Landgraf Philipps des Großmütigen von Hessen legte Friedrich Küch (1863–1935), Archivar am preußischen Staatsarchiv Marburg, den ersten Band von dessen "Politischen Archiv" vor. Küch hatte aus einer zersplitterten archivalischen Überlieferung den Zustand auf dem Papier rekonstruiert, den der Aktenbestand des Landgrafen zu außenpolitischen Angelegenheiten zu seinen Lebzeiten hatte. Die Aktenstücke hatte Küch, nach Vorgängen zusammengefasst, durch ausführliche Regesten in einer heute kaum noch vorstellbaren Tiefe erschlossen. Dennoch handelt es sich beim "Politischen Archiv" noch um ein archivisches Findmittel, nicht schon um eine Edition (Kretzschmar 2013: 93).
Küch legte die zeitgenössische Behördenorganisation zugrunde. Eine besondere Schwierigkeit ergab sich daraus, dass Akten zu derselben Angelegenheit sowohl in der Kasseler Zentrale als auch bei den hessischen Gesandten an anderen Höfen angefallen sein konnten – klassische Spiegelakten also: Was in Kassel als Konzept zu den Akten ging, liegt in denen des Gesandten als Ausfertigung vor, usw. Küch schreibt (1904: XXIV):
"Eine notwendige und wohltätige Folge der gewählten Anordnung war der Zwang jedes [...] Schriftstück [...] an dem Orte unterzubringen, wohin es seiner kanzleimäßigen Entstehung nach gehörte".
Somit war "die möglichst scharfe Feststellung des kanzleimäßigen Zustandes, in dem das betreffende Stück überliefert ist" (ebd. XXX) die Voraussetzung für die sachgerechte Verzeichnung des Bestands. Indem Küch über die dazu berücksichtigten Grundsätze Rechenschaft ablegte, führte er bis heute zentrale Forschungsbegriffe zu Entstehungsstufen und Überlieferungsformen von Schriftstücken ein: Schreiben in Akten können als Konzept, als Mundum (Ausfertigung) oder in Abschrift vorliegen; zentrale Bearbeitungsschritte waren die Revision des Konzepts und der Vollzug der Ausfertigung.
Auch gebührt Küch das Verdienst, als erster konsequent den neutralen Begriff Schreiben für Korrespondenzen in Akten benutzt zu haben. Seine Terminologie ist noch nicht trennscharf, seine Ausführungen sollten aber auch keine Methodologie begründen, sondern nur vor den Benutzern des Repertoriums Rechenschaft über die Arbeitspraxis ablegen (ebd. XII).
In der Summe ist genau das, eine Methodologie zu begründen, Küch unbeabsichtigt aber dennoch gelungen. Schon Haß und Meyer, den nächsten Pionieren der Aktenkunde, dienten seine Erkenntnisse zur kanzleimäßigen Entstehung von Schriftstücken als Leitfaden und Kontrastfolie für andere Epochen der Kanzleigeschichte.
Martin Haß: Aktenkunde als Editionsmethode
Um die Edition der politischen Korrespondenz eines anderen wirkungsmächtigen Herrschers, Friedrichs des Großen, zu ergänzen, wurden 1887 die Acta Borussica begründet, eine momumentale Editionsreihe von Aktenstücken zur inneren Entwicklung Preußens. Das umfasste auch die Verwaltungsgeschichte, deren Erforschung zudem die Grundlage für das Verständnis anderer Zweige der inneren Entwicklung war. Die Acta Borussica waren Grundlagenforschung, die in die Hände erfahrener Editoren gelegt war.
Einer dieser Editoren – und verantwortlich für die Editionsgrundsätze v war der Tangl-Schüler Martin Haß (1883–1911). Er veröffentlichte 1909 eine Studie "über das Aktenwesen und den Kanzleistil im alten Preußen", die in ihrer Verbindung von verwaltungsgeschichtlicher und hilfswissenschaftlicher Betrachtung wegweisend für die Aktenkunde war. Haß stand auf diesem Feld nicht allein: Auch Granier (1902), Klinkenborg (1915) und andere befassten sich mit dem, was zum brandenburgisch-preußischen Referenzmodell der Aktenkunde werden sollte; dieser Berliner Urgrund der Aktenkunde wird von Henning (1999) genau untersucht. Haß' Studie sticht durch ihren Umfang und den Versuch, Neuland zu kartieren, heraus:
"Die historische Aktenkunde ist ein weites, schier unübersichtliches Feld, das fast noch in seiner ganzen Ausdehnung wüst liegt und nur erst von ein paar Hauptwegen durchzogen ist."
(Haß 1909: 521 - zitiert nach der durchgehenden Seitenzählung des Bandes.)
Die Studie konzentriert sich auf die "Formalien in den Schriftsätzen" (ebd. 522), also auf innere Merkmale, und erklärt sie als Spuren der dahinter abgelaufenen Verwaltungsvorgänge. Im Grunde ging es Haß um ein Spezialproblem: Welche im Namen des Fürsten ergangenen Weisungen stammten wirklich von ihm und welche ergingen in seinem Namen von Behörden? Damit war die Rekonstruktion von Entscheidungsprozessen und die Zuschreibung von Verantwortung als ein Hauptzweck der Aktenkunde formuliert worden.
"Es konnte vorkommen, daß Friedrich Wilhelm als Kammer eine Verfügung ergehen ließ, die Friedrich Wilhelm als Generaldirektorium tadelte, und daß dann Friedrich Wilhelm als König, wenn die Sache an ihn gelangte, womöglich noch eine andere Entscheidung fällte."
(Haß 1909: 541.)
In einem aktenkundlichen locus classicus wies Haß (1909: 531 f.) nach, dass der auf Schriftstücken häufig anzutreffende Vermerk "Auf Seiner Majestät allergnädigsten Specialbefehl" oder "ad mandatum speciale regis", entgegen dem Wortsinn gerade keinen speziellen Befehl des Königs, sondern eine selbständige Behördenweisung anzeigte.
Richtungsweisend verknüpfte er die verwaltungsgeschichtliche Rekonstruktion der Behördenorganisation mit der Analyse normativer Texte wie Kanzleiordnungen und dem empirischen Befunde der Schriftstücke. Sein besonderes Interesse galt dem Kanzleistil als "Staatsgrammatik" (ebd. 522).
Die Forschung kann ihm dankbar dafür sein, dass er seiner eigentlichen Argumentation Anhänge beigab, die von den 55 Seiten allein 24 einnehmen. Ohne verfrühte Systematisierung stellte Haß darin seine gesammelten Beobachtungen an Aktenstücken zur Verfügung. Herausragend ist der Exkurs "über die Entstehung eines Aktenstücks" (ebd. 554–559), der die Entstehungsstufen unter den Bedingungen des voll entwickelten kollegialen Verwaltungstyps nachvollzieht und sich dazu bereits mit Küchs Befund aus dem 16. Jahrhundert auseinandersetzt. Der Anhang "Musterbeispiele" (ebd. 568–575) bringt eine Zusammenstellung der für einzelne Schriftstücktypen charakteristischen Formularbestandteile.
Man würde Haß Unrecht tun, ihn nur als überholten Vorgänger Heinrich Otto Meißners zu sehen. Hier wurde nicht nur reiches Material für die nachfolgende Forschung ausgebreitet und vieles angedeutet, was Meißner später ausführen sollte, sondern Haß demonstrierte am Beispiel des Spezialbefehls auch, dass die Aktenkunde zu allgemeinen historischen Fragen, wie eben der Verantwortlichkeit des frühneuzeitlichen Fürsten, einen originären Beitrag leisten konnte – wozu also der ganze Aufwand gut war.
Hermann Meyer: Aktenkunde aus der Verwaltungspraxis
Hermann Meyer (1883–1943) war mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Im Auftrag der Reichsregierung wurde 1919 eine vierbändige kritische Edition der "deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch" 1914 veröffentlicht. Zur archivtechnischen Unterstützung des Vorhabens wurde der Archivar Meyer von der preußischen Archivverwaltung an das Auswärtige Amt abgeordnet.
Obwohl Meyer nicht zu den Editoren zählte, hoben diese doch hervor, dass "dessen fachmännische Spuren der Leser überall wahrnehmen wird" (Montgelas/Schücking 1919: VII). In erster Linie wird man dazu die saubere Bestimmung der Entstehungsstufen, die Zuweisung von oft schwer leserlichen Randbemerkungen und die zeitliche Einordnung, wer wann wovon Kenntnis hatte, verstehen können. Auch hier ging es also um das Problem der Feststellung von Verantwortlichkeit nach Aktenlage, das Haß beschäftigt hatte - nur eben nicht am grünen Tisch, sondern im Rahmen der heißen Kriegsschulddebatte. Selten fanden Akteneditionen eine derart weite Verbreitung. Meyers schmale Monografie von 1920 über "das politische Schriftwesen" des Auswärtigen Amts wandte sich als Hilfe zur Lektüre der edierten Dokumente ebenfalls an ein breites Publikum.
Das Problem, die pragmatische Schriftlichkeit einer vergangenen Epoche zu rekonstruieren, stellte sich Meyer, der jederzeit die Registratoren und Sekretäre des Amts befragen konnte, nicht. Die Herausforderung der zeitgeschichtlichen Edition lag in der Masse und Verschiedenheit der Überlieferungsformen, an der moderne technische Verfahren mitschuldig waren. Meyer bleibt bis heute maßgeblich zu Bereichen, die der Mainstream der Aktenkunde nicht im Blick hat, insbesondere zur Übermittlung per Telegraf oder Fernschreiber und zu Chiffrierverfahren (1920: 83–97).
Aus der Praxis schreibend, gelang Meyer das vielleicht plastischste und prägnanteste Buch zur Aktenkunde überhaupt. Die Leser erhalten einen umfassenden Überblick, wie Schriftstücke im Auswärtigen Amt entstanden, versandt und bearbeitet wurden, wie der Kaiser eingebunden war, wie Staatsverträge abgeschlossen wurden und wie der ganze Betrieb organisiert war. Der Zeitdruck bei der Erstellung des im Dezember 1919 abgeschlossenen Manuskripts und die Nähe der Praxis forderten aber ihren Tribut, indem sie Meyer die systematische Durchdringung des Stoffs verboten.
Bei der Behandlung der Entstehungsstufen konnte er noch, mit Küchs Terminologie gewappnet, die wirren Begriffe der Kanzleipraxis bändigen:
"In der modernen Registratur und Kanzlei ist die Terminologie des Schriftverkehrs nicht immer unbedingt feststehend. So werden Ausdrücke wie Original, Entwurf, Konzept, Ausfertigung, Minüte und Grosse, zumal in den verschiedenen Ländern, in sehr verschiedener Bedeutung angewandt. Um so wichtiger ist es, hier klar zu sehen."
(Meyer 1920: 38.)
Bei der Beschreibung der Schriftstücktypen hatte Meyer darauf, wie er selbst beklagt (ebd. 3 f.) verzichten müssen:
"Andererseits bedeutete es eine wirkliche Entsagung, auf die Darstellung der historischen Entwicklung der […] Schriftstücke zu verzichten, also etwa von Noten oder Handschreiben zu sprechen, ohne deren Geschichte und nicht zuletzt die ihrer äußern [sic] Form zu behandeln."
(Meyer 1920: 3.)
Die dazu angekündigten Spezialstudien kamen nicht mehr zustande, nachdem er 1920 zum ersten Leiter des Politischen Archivs des Auswärtigen Amts berufen wurde; 1926 wechselte er in den diplomatischen Dienst. So scheiterte Meyer schon daran, die Entstehung und Behandlung der telegrafischen und schriftlichen Korrespondenz zwischen den Auslandsvertretungen an die Berliner Zentrale in ein logisches Verhältnis zu setzen, und behandelte beides an entgegengesetzten Enden der Darstellung. Vor lauter Bäumen verschwindet ein wenig der Wald.
Methodisch hat Meyer die Aktenkunde also nicht vorangebracht, aber es war sein Verdienst, die erste zeitgeschichtliche Aktenkunde geschrieben und den Ansatz Küchs auf frühe Verfahren der elektronischen Kommunikation angewandt zu haben.
Literatur
Außer den mit * gekennzeichneten werden alle Titel auch in der Basisbibliografie zur Aktenkunde nachgewiesen
Besprochene Werke
Brandi, Michael/Bresslau, Harry/Tangl, Michael 1908. Einführung. In: Archiv für Urkundenforschung 1. S. 1–4.
Online
Granier, Hermann 1902. Ein Reformversuch des preußischen Kanzleistils im Jahre 1800. In: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 15. S. 168–180.
Online
Haß, Martin 1909. Über das Aktenwesen und den Kanzleistil im alten Preußen. In: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 22. S. 521–575.
Online
Klinkenborg, Melle 1915. Die Stellung des Königlichen Kabinetts in der preußischen Behördenorganisation. In: Hohenzollern-Jahrbuch 19. S. 47–51.
Online
Küch, Friedrich 1904. Politisches Archiv des Landgrafen Philipp des Großmütigen von Hessen: Inventar der Bestände. Bd. 1. Publikationen aus den Preußischen Staatsarchive 78. Leipzig.
Online
Meyer, Hermann 1920. Das politische Schriftwesen im deutschen auswärtigen Dienst. Ein Leitfaden zum Verständnis diplomatischer Dokumente. Tübingen.
Online
Spangenberg, Heinrich 1928. Die Kanzleivermerke als Quelle verwaltungsgeschichtlicher Forschung. In: Archiv für Urkundenforschung 10. S. 469–525.
Weitere Literatur
Henning, Eckart 1999. Wie die Aktenkunde entstand. Zur Disziplingenese einer Historischen Hilfswissenschaft und ihrer weiteren Entwicklung im 20. Jahrhundert. In: Ders. 2004. Auxilia Historica. Beiträge zu den historischen Hilfswissenschaften und ihren Wechselbeziehungen. 2. Aufl. Köln. S. 105–127.
Kretzschmar, Robert 2013. Akten- und Archivkunde im Tübinger Netzwerk Landesgeschichte: Ein Plädoyer für eine zeitgemäße Archivalienkunde. In: Bauer, Dieter R. u. a., Hg. 2013. Netzwerk Landesgeschichte. Gedenkschrift für Sönke Lorenz. Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte 21. Ostfildern. S. 91–109.
*Montgelas, Max Graf/Schücking, Walter, Hg. 1919. Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch. Bd. 1. Charlottenburg 1919.
Online
*Neugebauer, Wolfgang 1998. Martin Hass 1883–1911. Beiträge zur Biographie eines preußischen Historikers und Wegbereiters der Aktenkunde als Historischer Hilfswissenschaft. In: Herold-Jahrbuch, Neue Folge 3. S. 53–71.
Tagung: Möglichkeiten der automatischen Mustererkennung und Analyse historischer Dokumente
Am 19. und 20. Februar 2015 wird im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes eCodicology die zweite internationale Tagung zum Themenfeld “Maschinen und Manuskripte” stattfinden. Ort der Veranstaltung ist das Karlsruher Institut für Technologie. Der technisch orientierte Workshop bietet eine Plattform für den Austausch zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, die mit Methoden der automatischen Mustererkennung arbeiten.
Das Programm (darunter auch die Abstracts der Vorträge) ist ab sofort auf der Website des Projekts zu finden.
Anmeldungen sind nicht erforderlich, aber erwünscht. Schreiben Sie hierzu bitte möglichst bis zum 17. Februar an swati.chandna(at)kit.edu oder an danah.tonne(at)kit.edu
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4633
St. Pauli: „Hilldegarden“ startet den „Ideenbunker“
Das Projekt “Hilldegarden” plant einen Stadtgarten auf dem Dach des geschichtsträchtigen Bunkers am Heiligengeistfeld. Am Sonntag öffnete das Team um Tobias Boeing einen “Ideenbunker” als zentrale Anlaufstelle für interessierte Hamburger Bürger. – Von Max Bahne
Am Sonntag öffnete der „Ideenbunker“ am großen Flakbunker an der Feldstraße zum zweiten Mal seine Tür. Der kleine Baucontainer soll eine Anlaufstelle für interessierte Hamburger sein. Dort kamen sie mit den Mitgliedern des Projekts „Hilldegarden“ ins Gespräch. In dem Container, der im Stil des großen Bunkers aufgebaut wurde, nahm das „Hilldegarden“-Team Anregungen und Kritik entgegen. Vom „Ideenbunker“ aus startete Projektleiter Tobias Boeing mit Besuchern zu Führungen auf das Dach des Flakbunkers.
Der geplante Stadtgarten soll auf einem der geschichtsträchtigsten Gebäude Hamburgs entstehen. Der Flakbunker auf dem Heiligengeistfeld wurde kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs unter der Mitarbeit von Zwangsarbeitern fertiggestellt. Bis heute nutzen zivile Mieter den Bunker. Mit regelmäßigen Ausstellungen im Stadtgarten möchte „Hilldegarden“ an die bewegte Geschichte des Bunkers erinnern.
Wie das Projekt „Hilldegarden“ entstand
Seinen Anfang nahm das Projekt im Frühjahr 2014. Damals hatten einige Anwohner die Idee, das Dach des grauen Flakbunkers zu einem grünen Stadtgarten umzubauen. Sie hofften, eine neue öffentliche Grün- und Gartenfläche zu erschließen, die sich zur generationsübergreifenden Nutzung eignet. Es gelang den Anwohnern, Thomas Matzen, den Pächter des Bunkers am Heiligengeistfeld, vom Stadtgarten auf dem Dach des Bunkers zu überzeugen. Schnell bildete sich die Projektgruppe „Hilldegarden“. Sie erarbeitete ein Konzept für den Garten über den Dächern Hamburgs. Auf den Bunker soll ein 20 Meter hoher, begrünter Aufbau gesetzt werden, der den Hamburgern zur Erholung und als eigener Garten dienen soll. Ein zentrales Element des Konzepts, das in Zusammenarbeit mit Architekten des Büros Interpol+-Architecture entstand, ist das sogenannte „Urban Gardening“.
Was bedeutet „Urban Gardening“?
Die Geschichte dieser Anbauform geht weit ins 19. Jahrhundert zurück. „Urban Gardening“ beschreibt den Lebensmittel-Anbau in der Stadt. Gerade leicht verderbliche Lebensmittel mussten im 19. Jahrhundert wegen der weiten Transportwege dort angebaut werden, wo sie auch verbraucht wurden – in der Stadt. Ein bekanntes Beispiel für „Urban Gardening“ sind die Stadtgärten des Pariser Bezirks Le Marais, wo auf einer Fläche von 1400 Hektar, also fast 2000 Fußballfeldern, Lebensmittel angebaut wurden. So groß soll der Garten auf dem Bunker aber nicht werden: „Laut unserem Entwurf würden 8000 Quadratmeter Fläche entstehen, von denen wir 5500 Quadratmeter öffentlich nutzbar machen wollen“, sagte Boeing beim Rundgang auf dem Dach des Bunkers. Die Hamburger müssten sich also mit nur einem Fußballfeld Platz für ihren Salat genügen.
Neben den Vorzügen eines schnell zu erreichenden Stadtgartens soll der Aufbau auf dem Flakbunker auch kulturelle Angebote schaffen. Boeing stellte auch einen Plan für ein kleines Amphitheater vor, das in einem der Flakstellungen auf dem Dach des Bunkers entstehen soll. Dort sollen nach Bauende bis zu 150 Zuschauer Theater-Aufführungen bestaunen können.
Droht Hamburg ein neues Kostengrab wie die Elbphilharmonie?
Die Kostenfrage für den Bau des Gartens ist noch nicht abschließend geklärt. Boeing sagte, Pächter Matzen sei bereit, die Baukosten für den Garten und die laufenden Kosten für den Bunker bis zum Pachtende 2053 zu übernehmen. Im Gegenzug bot ihm die Hamburger Kulturbehörde an, die Pachtkosten von rund 2,56 Millionen Euro zu erlassen, wenn sich Matzen dazu entscheide, die Pacht bis 2093 zu verlängern. Bei dieser Lösung müssten die Hamburger Steuerzahler kein neues Kostengrab wie die Elbphilharmonie fürchten. Die endgültige Entscheidung zur Kostenfrage soll noch in diesem Jahr fallen.
Boeing: „Hamburger sollen am Planungsprozess teilhaben“
Wichtig für Boeing und das „Hilldegarden“-Team ist die bürgernahe Planung des Stadtgartens. „Wir wollen die Anwohner und andere interessierte Hamburger am Planungsprozess teilhaben lassen. Dazu haben wir den Container am Flakbunker aufgestellt, um mit den Menschen sprechen und uns Anregungen und Kritik anhören zu können“, sagte er. Der Container ist dienstags von 10 bis 15 Uhr besetzt, mittwochs von 15 bis 20 Uhr. Zusätzlich liegt dort ein Infoblatt aus, auf dem Ideen und Kritik notiert werden können. Bis August können engagierte Hamburger an monatlich stattfindenden Workshops teilnehmen oder dem „Hilldegarden“-Team ihre Wünsche für das Projekt mitzuteilen. Erst Ende August soll das finale Konzept zum Stadtgarten stehen.
Das Projekt “Hilldegarden” sucht noch geschichtsbegeisterte Menschen, die im Workshop “Bunkergeschichte” mitarbeiten möchten. Dort soll die Frage erörtert werden, wie man mit der schwierigen Geschichte des Flakbunkers umgeht. Ansprechpartner ist Tobias Boeing (tobias@hilldegarden.org).
In Kürze erscheint hier ein Feature, das sich mit der Geschichte des Bunkers näher befasst.











