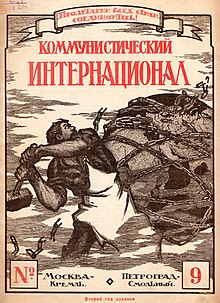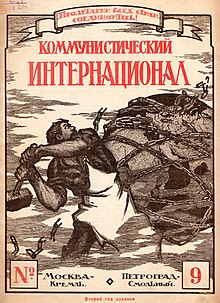Von Stefan Sasse
Sowjetunion und Kommunismus
 |
| Emblem der KPdSU |
Anfang der 1920er Jahre wurden die „Kommunistische Partei der Sowjetunion“ und die Sowjetunion gegründet. Sehr schnell wurden dabei besonders in der westlichen Welt eine durch Lenin und die KPdSU durchaus gewollte Assoziation en vogue, nach der Kommunismus gleichbedeutend mit Terror und Diktatur ist. Diese Entwicklung wurde in Europa überwiegend negativ rezipiert. Ab 1924 begann die KPD in einen moskauzentrierten Sog zu geraten. Auf der III. Internationale der Kommunistischen Internationalen, die von 1929-1943 bestand, dominierte Moskau die KPs Deutschlands und Frankreichs, später auch der anderen europäischen Länder. Die KPs der europäischen Länder fungierten nun mehr als reine Sektionen der Moskauer Parteizentrale. Der Kommunismus wurde zur Staatsidee, in der Marx nur noch als Stichwortgeber fungierte – diese Entwicklung begann jedoch bereits mit Lenin. Der verbreitete Antikommunismus richtete sich gegen Ende der 1920er Jahre nicht mehr nur gegen die KPs, sondern auch gegen die Sowjetunion selbst. Im Rahmen des Fortschritts des Faschismus’ in den 1920er Jahren gewann auch der Kommunismus an Einfluss. Warum er in den 1930er Jahren nicht weiter an Einfluss gewann, sondern verlor, liegt an den großen Säuberungen und dem Nichtangriffspakt mit Hitler. Die bolschewistisch-kommunistischen Intellektuellen kamen nun in die Situation, ihre theoretische Überzeugung widerrufen müssen. Sie wandten sich dem New-Deal-Liberalismus zu, der sozialdemokratische Elemente enthielt und der zu dieser Zeit von Roosevelt betrieben wurde. Diese Leute wird man 1944 in den USA und um 1950 in Westdeutschland als energische Antikommunisten wieder finden.
KPD
Die KPD entstand in der so genannten Gründungskrise der Weimarer Republik. Diese Phase reicht von der Gründung der KPD Anfang 1919 über 1920, als sie mit dem linken Teil der USPD fusionierte, bis zum kurzfristigen Verbot 1923. In einer zweiten Phase von 1924 bis 1928 wurde die KPD nach bolschewistischem Vorbild stalinisiert und spätestens ab 1925 willenloses Organ der Komintern, die wiederum willenloses Organ der KPdSU war. Seit 1925 war Ernst Thälmann der Vorsitzende der KPD. Die dritte Phase reichte von 1928 bis 1933 und war ideologisch von der Theorie des Sozialfaschismus geprägt. Diese Ideologie besagt, dass der eigentliche Feind der Kommunisten nicht der Faschismus, sondern die Sozialdemokratie sei. Diese These führte letztlich zum Untergang des Kommunismus in Deutschland, da die KPD sich strikt weigerte, mit der SPD gegen den Faschismus und Nationalsozialismus zusammenzuarbeiten, was bereits 1925 zur Wahl Hindenburgs und 1932 in einem Streik zur Zusammenarbeit der KPD und NSDAP führt, mit denen diese eine SPD-geführte Regierung zu stürzen hoffen. Unter umgekehrten Vorzeichen ereignete sich dies 1949 wieder, als Schuhmann die Koalition mit der KPD kategorisch ausschloss.
 |
| Karl-Liebknecht-Haus in Berlin |
Die Gründung der KPD erfolgte in der Novemberrevolution 1918/19. Es gab den Rat der Volksbeauftragten, der aus MSPD und USPD bestand und der von Friedrich Ebert geleitet wurde. Selbiger wollte einen Waffenstillstandsvertrag schließen und die Demobilisierung organisieren. Zu diesem Zweck suchte Ebert den Schulterschluss mit dem Militär und damit den alten Eliten des Kaiserreichs. Dadurch wurden die Bestrebungen der Radikalen von der Revolutionsregierung unterdrückt. Die Radikalen der USPD, die sich mit den Namen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verbinden und im Spartakusbund organisiert sind, sind von der SPD-Linie abgespalten. Sie rebellierten gegen Ebert und den Rat, in dem die USPD die MSPD unterstützte. Auf einer Konferenz dieser Radikalen entstand (in Rückdeutung) die KPD. Sie hatte kein Programm, sondern nur eine vage politische Orientierung, die noch überhaupt nicht auf die Kader der Bolschewiki hin gerichtet und auf Eigenständigkeit bedacht war. Die KPD war dabei entgegen der SPD nicht bereit, mit „bürgerlichen“ Parteien zu koalieren. Dass die KPD von Arbeiter- und Soldatenräten sprach bedeutet dezidiert nicht, dass ein bolschewistisches System übernommen werden sollte.
In der ersten Januarhälfte 1919 kam es zum so genannten „Spartakusaufstand“ - ein polemischer Begriff, den die MSPD prägte. Es handelt sich um einen Versuch der Radikalen, ihre Position zu stärken. Die Spartakisten verloren und wurden zum Teil umgebracht. Luxemburg und Liebknecht wurden in diesen Tagen von Freikorpssoldaten erschossen. Der Tod Luxemburgs war für die Entwicklung des radialen demokratischen Sozialismus’ eine Tragödie, denn mit Luxemburg starb der demokratische Kommunismus. Damit konnten sich die bolschewistischen, auf Diktatur der Räte (statt Rätedemokratie) gerichteten Kräfte durchsetzen. Im März 1919 trat die KPD der III. Internationalen als erste ausländische Partei bei. Die Taktik der Kommunisten zwischen 1920 und 1923 schwankte zwischen den Bemühungen um eine Arbeitsfront mit den Sozialdemokraten und an deren Ausschluss. Bis 1923 dominiert die Vorstellung der Arbeitsfront nicht zuletzt wegen der auf diese Vorstellung gerichteten EKKI (Exekutivorgan der Komintern). In der Situation des Ruhrstreiks 1923 stellt sich die KPD auf die Seite der Streikenden und versagt sich so gesehen der Internationalisierung und steuerte einen nationalbolschewistischen Kurs, während sie mit den rechtsradikalen Kräften zusammenarbeitete. Das hängt damit zusammen, dass die EKKI und Komintern die Interessen der sowjetischen Außenpolitik vertraten. Deren Interesse bestand zu jener Zeit in der Vereitelung jeder Chance eines Ausgleichs zwischen Deutschland und Frankreich, um die Entstehung einer geeinten Front gegen die SU zu verhindern. Generell war die Komintern bis zum Zusammenbruch des Ostblocks eine Interessensorganisation der sowjetischen Außenpolitik. Die Parole der Arbeiter aller Länder, sich zu vereinigen, wurde damit aus der Ideologie des Kommunismus entfernt. Wegen des Agierens im Ruhrkampf wurde die KPD bis April 1924 auch verboten, während das Reich unter extremistischen Regierungen in den Ländern auseinanderzubrechen drohte.
 |
| Ernst Thälmann 1932 |
Der Vorsitzende der KPD, Ernst Thälmann, wurde von der SU unterstützt, obwohl die deutschen Kommunisten ihn für unfähig hielten, weil Thälmann die Ideologie des „Sozialismus in einem Lande“ unterstützte und damit die KPD der KPdSU unterordnete. Das begann 1925 und wurde 1928 zum Prinzip erhoben. 1929 trat die KPD in ihre „ultralinke“ Phase ein. Damit grenzt sich die KPD entschieden gegenüber der SPD ab und nahm weitere, aber nicht so entschiedene Abgrenzungen gegen die NSDAP und die bürgerlichen Parteien vor. Damit kapselte sie sich ein und isolierte sich im Weimarer Parteiensystem, das zu jener Zeit noch immer ein Mehrparteiensystem war. Ab 1929 wurde mit der Keule des „Faschismus“-Begriffs auf alles propagandistisch eingeschlagen, was man vorfand: den „Sozialfaschismus“ der SPD, der „Nationalfaschismus“ der NSDAP, der „Brühning-Faschismus“ der Regierung Brüning und des Zentrums.
Am so genannten „Blutmai“ des Jahres 1929 (1.5.1929) werden unbewaffnete kommunistische Demonstranten von der Polizei mit Gummiknüppeln und –geschossen auseinandergetrieben. Wichtig ist dabei, dass Preußen, zu dem Berlin gehört, eine Bastion der Sozialdemokraten war. Diese gingen also gewalttätig gegen die kommunistischen Demonstranten vor. Man handelte nach dem Prinzip, um jeden Preis die parlamentarische Stabilität zu verteidigen und so die „sozialistisch-demokratischen Reformen“ nicht zu gefährden. Deswegen konnte es von Seiten der SPD keine Kooperation mit den Kommunisten geben. Vielmehr mussten Kommunisten, seit der Begriff des „Sozialfaschismus“ in der KPD dominierte, von der SPD als Gegner betrachtet werden. Seit diesem 1. Mai 1929 gab es keine Möglichkeit mehr zur Kooperation der SPD, KPD und der Gewerkschaften gegen den realen Faschismus. Diese Chance wurde damit bereits vor der Ausbreitung der NSDAP vertan, die dann auch erst diese Wirkung entfalten konnte. Diese Gegnerschaft hielt sich auch in die Nachkriegszeit und bis heute in der Gegnerschaft der West-SPD gegenüber der Ost-SPD und der KPD bzw. deren Erbin, der Linkspartei.
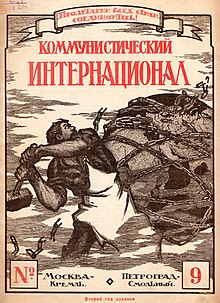 |
| Magazin der Internationale |
Als nächsten Schritt verbietot die SPD in Preußen den kommunistischen Rotkämpferbund, was die KPD in ihrer Position nur berstärkte. Die KPD und SPD bekämpften sich bald in den Betriebsräten und Gewerkschaften. Die KPD prägte das Credo: „Ohne im Kampf gegen die Sozialdemokratie zu siegen, können wir den Faschismus nicht besiegen.“ Das EKKI sprach von einer Verflechtung von Sozialdemokratie und NSDAP im Dienste des Finanzkapitals. Ab 1931 gab es zwischen der KPD und ihren Gliederungen auf der einen und der NSDAP und ihren Gliederungen auf der anderen Seite gab es zunehmend Mitgliederfluktuationen. Eine der Parolen, die das ermöglichten, war Thälmanns Wort von 1928, jeden Tag in den Dienst der Revolution zu stellen – was gleichzeitig den Kampf gegen den Parlamentarismus beinhaltete und die NSDAP für Aussteiger aus dem kommunistischen Umfeld zur Option machte.
1932 kam es zu einem spontanen Streik in den BVG (Berliner Verkehrsbetriebe), zwei Tage vor den Reichstagswahlen. Der Anlass war die Entscheidung der BVG, den Stundenlohn abzusenken, da die BVG im Zuge der Wirtschaftskrise immer größere Defizite einfuhr – die Löhne waren jedoch seit 1929 bereits um ein Drittel gesunken. Zudem sollte die Absenkung nur vier Wochen gelten, was nach einem Monat eine weitere Senkung wahrscheinlich machte. Die SPD und Gewerkschaften sprachen sich für diese Senkung aus, um den Radikalen keinen Anlass für Krawall und Demonstration geben wollten. Es war abzusehen, dass der Aufruf zum Streik für Krawalle sorgen würde. Doch die SPD unterschätzte, wie weit die Arbeiterschaft durch Wirtschafts- und Staatskrise bereits der SPD entfremdet und radikaleren Argumenten zugänglich geworden war. Gegen das Votum von Gewerkschaften und SPD traten die Arbeiter der BVG auf Aufruf der KPD und NSDAP in den Streik. Diese Situation führte dazu, dass gegen die NSDAP eingestellte rechte Bürgerliche mit fassungslosem Entsetzen die Geschehnisse beobachteten: die SA arbeitete mit dem „Todfeind“ KPD zusammen. Sie bekamen für einen Moment die Ahnung, dass ihre Schicht nicht nur von der KPD, sondern auch der NSDAP bedroht war. Wer aus dieser Schicht das politische Verständnis hatte, konnte in diesem Spätherbst 1932 erkennen, dass eine Machtübernahme der Nationalsozialisten nur zwei Möglichkeiten lassen würde: Anpassung oder Flucht. Der Streik dauerte nur vier Tage, aber er hatte hohen Symbolcharakter.
 |
| Stalin 1945 |
Bereits unter Lenin stellte sich das Dilemma, dass Kommunismus in der Theorie eine Ideologie der Befreiung von der durch die Produktionsverhältnisse aufgezwungen Entfremdung und Entmündigung war. Nun aber wurde Kommunismus mit den Interessen eines bestimmten Staates gekoppelt – in der Doktrin der KPdSU. Diese Doktrin war primär auf das staatliche Eigeninteresse der SU ausgerichtet. In der SU wurde zu dieser Zeit eine forcierte Industrialisierung betrieben, die mit gigantischen Kosten verbunden war – aber auch großen Erfolg hatte. Diese Kommandoindustrialisierung führte zu Zentralisierung und Bürokratisierung, da die gesamte Struktur erst aufgebaut werden - und nicht bestehende Strukturen umstrukturiert werden – mussten. In der Phase des zu Ende gehenden Stalinismus wurde eine zweite Phase gestartet, vor allem mit dem Versuch der Gewinnung von Energie durch Wasserkraft ab Mitte der 1950er Jahre. Zu dieser Kommandoindustrialisierung kam die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft hinzu, die effektiv eine Enteignung der mittelständischen und großbäuerlichen Güter war.
Stalin war dabei ein Autokrat von ausgesuchter Rücksichts- und Skrupellosigkeit. Die SU war in dieser Zeit von vier Faktoren gekennzeichnet:
1) Eine aufgeblähte Bürokratie
2) Ein eklatanter Mangel an Flexibilität
3) Der Glaube, dass ein Fortschritt gegenüber dem Lebensstandard des Zarenreichs erreicht war – eine Sicherung des Minimalstandards
4) Der Glaube, dass man über diesen Lebensstandard hinauskam und ihn steigerte
Die europäischen Volksbewegungen der Linken beriefen sich auf zwei Traditionen: die parlamentarische Demokratie oder direkte Demokratie und die zentralistisch-aktivistischen revolutionären Bestrebungen im Sinne der jakobinischen Phase des französischen Revolution. Die Arbeiterbewegungen vor der Jahrhundertwende waren allesamt in ihrer Ausrichtung konsequent demokratisch. Die kommunistische Bewegung brach unter Lenin, systematisiert unter Stalin, radikal mit dieser Tradition, wiewohl man sich weiterhin darauf berief. 1922 wurden demokratische Ideen und Diskussionen aus der KPD verbannt. Stalinisierung bedeutet also Entfremdung von den Ideen des Kommunismus von vor 1917.
Es gibt zwei Faktoren, die die SU zum faszinierenden Anschauungsbeispiel für Fortschritt machen als auch zum gesuchten Bündnispartner:
1) Der Fortschritt als Ideologie bot in der SU ein Beispiel von faszinierender Effizienz. Deswegen kam es geradezu zu Pilgerreisen aus England.
2) Gleichzeitig wurde die SU als Bündnispartner für die Staaten des europäischen und atlantischen Westens attraktiv, als ab 1922 der Faschismus in Europa seinen Siegeszug antritt. Besonders mit dem Machtantritt der Nazis 1933 avancierte die SU in der Sicht der Westeuropäer zum wichtigsten Gegner des Faschismus’.
Dieser Artikel basiert auf der Vorlesung "Politisch-Ideologische Hauptströmungen des 20. Jahrhunderts" von Prof. Dr. Anselm-Doering Manteuffel.
Bildnachweise:
Pin KPdSU - Pekkos (gemeinfrei)
KPD Zentrale - Carl Weinrither (CC-BY-SA 3.0)
Thälmann - unbekannt (CC-BY-SA 3.0)
Magazin - Carrite (gemeinfrei)
Stalin - US Army Signal Corps (gemeinfrei)

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2012/02/eine-kurze-geschichte-des-kommunismus_17.html