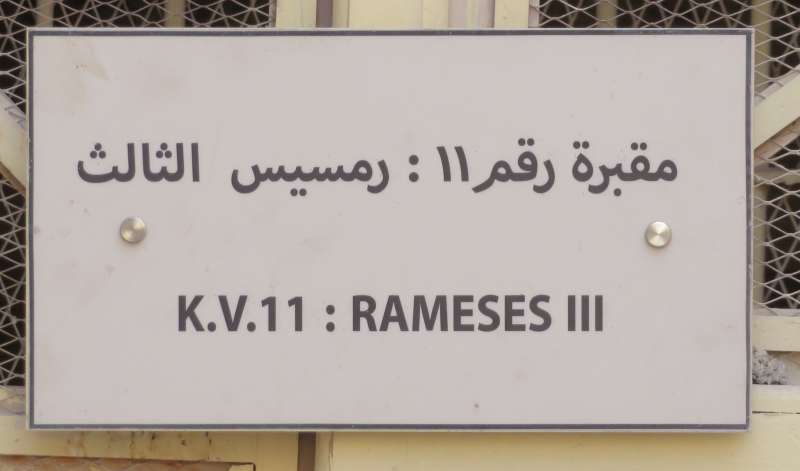Herzliche Einladung zu meinem Vortrag:
Die Nummern der Bilder: Identifizierungspraktiken in der kaiserlichen Gemäldegalerie 16501800, speziell - aber nicht nur - für Nummern-Nerds und Inventarisierungsaficionados, Zahlenfreaks und ListenliebhaberInnen!
Zeit: Mittwoch, 17.10.2018, 18:30 Uhr s.t.
Ort: 1010 Wien, Hauptgebäude der Universität Wien, Universitätsring 1, Hörsaal 30 (linker Flügel, 1. Stock)
Moderation: Li Gerhalter
Abstract:
Zwei Jahre nachdem in der Habsburgermonarchie die Häuser nummeriert wurden, wurde 1772 eine weitere Kategorie von Gegenständen dieser unscheinbaren Kulturtechnik unterzogen: Diesmal waren es die Gemälde der kaiserlichen Sammlungen, die unter der Ägide des eben erst neu bestellten Galeriedirektors Joseph Rosa mit Inventarnummern bedacht wurden. Die entsprechenden Zahlen wurden in weißer Deckfarbe auf der Vorderseite der Bilder angebracht, manche davon sind heute noch bei einem Besuch des Kunsthistorischen Museums am Ring sichtbar.
Der Vortrag spürt den verschlungenen Wegen des Einsatzes von Nummern zur Identifizierung der habsburgischen Gemälde nach, von den die Sammlungen Erzherzog Leopold Wilhelms feiernden Galeriebildern David Teniers des Jüngeren Mitte des 17. Jahrhunderts und dessen Theatrum pictorium über das prächtige Bildinventar Ferdinand Storffers (1720-1733) bis hin zu der genannten Inventarisierungstätigkeit unter Rosa und schließlich der im Belvedere erfolgten Neuaufstellung der Gemälde unter Christian von Mechel.
[...]
Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022657705/