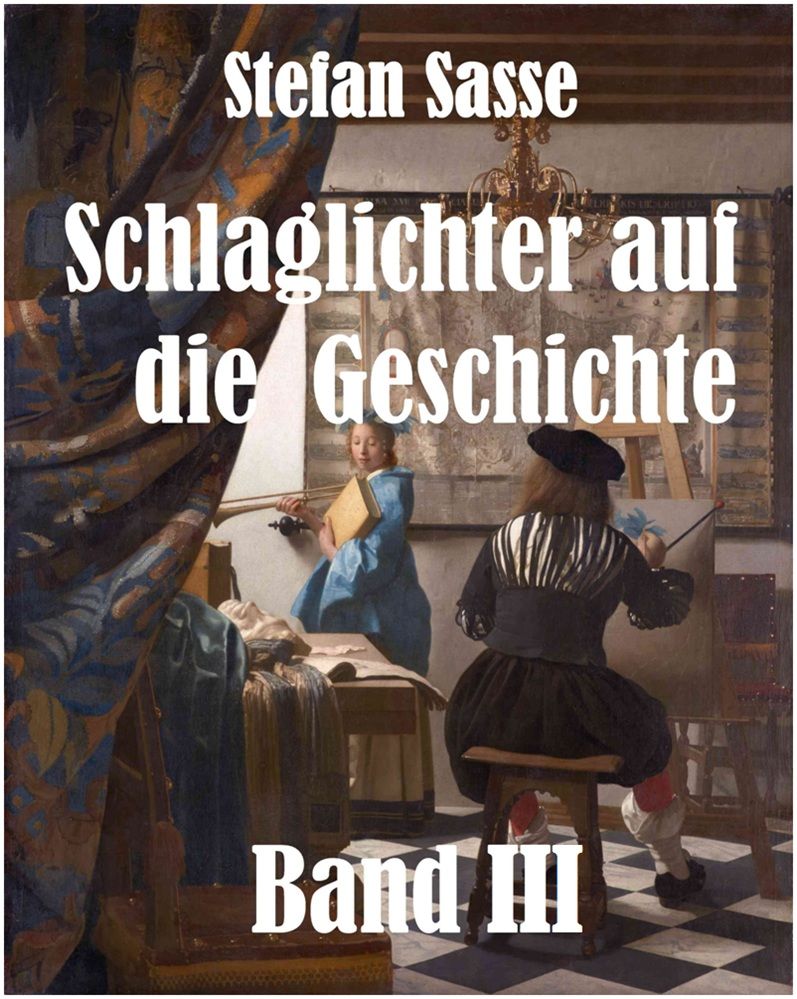In der globalisierten Moderne werden Probleme wie Terrorismus, Krieg, organisierte Kriminalität, Umwelt- und Wirtschaftsdelikte zu grenzübergreifenden Gefahren und machen daher eine internationale Zusammenarbeit im Polizeiwesen zunehmend erforderlich. Dass in der Umsetzung von internationaler Polizeiarbeit zahlreiche Schwierigkeiten, auch ethischer Art auftreten, ist nicht von der Hand zu weisen. Bereits bei oberflächlicher Betrachtung der Einsätze in Afghanistan-Einsatz oder im Kosovo wird auf der Suche nach auftretenden Schwierigkeiten schnell fündig. Im kriminalpolizeilichen Bereich bestehen mit Interpol und Europol bereits feste zwischenstaatliche Institutionen – in ihren Aufgabenbereich fallen u. a. die Bearbeitung internationaler Strafsachen, die Koordination internationaler Fahndungen oder die operative und strategische Analyse von Akten internationaler Kriminalität. Interpol und Europol haben allerdings keine Exekutivbefugnisse.
Darüber hinaus führen insbesondere die Vereinten Nationen (UN) eine Vielzahl weiterer internationaler Polizeieinsätze durch. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts setzte ein Wandel der Kriegsformen ein. Der Abnahme zwischenstaatlicher Kriege steht eine Zunahme innerstaatlicher, bürgerkriegsähnlicher Konflikte mit oft komplexen Ursachen gegenüber. Entsprechend hat die Zahl von UN-Einsätzen zur Friedenskonsolidierung („Peacebuilding“) zugenommen. Nach der Entmilitarisierung der Konfliktparteien sind dabei auch zivile Experten für humanitäre Hilfe und den (Wieder-)Aufbau eines funktionierenden Staatsapparates gefragt. In diesem Rahmen haben die von den UN entsandten Polizeikräfte – je nach Reichweite des UN-Mandats – meist folgende Aufgaben: Beobachtung, Überwachung, Beratung und Ausbildung der örtlichen Polizei sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Da die Polizei die Verkörperung des staatlichen Gewaltmonopols und zugleich Exekutivorgan zur Durchsetzung des Rechtsstaats ist, gilt sie als wichtiges Bindeglied zwischen militärischer Sicherheit und zivilem Staatsaufbau.
Im Jahre 2011 unterstützte die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise die UN und die EU in neun Missionen mit insgesamt mehr als 300 Polizisten. Eine dieser Missionen war in 2011 der Einsatz in Afghanistan. Die deutschen Polizeikräfte haben hier keine exekutiven Befugnisse. Das Ziel ist vielmehr der Aufbau effektiver Polizeistrukturen unter afghanischer Eigenverantwortung. Dies soll durch Ausbildung, Betreuung, Beobachtung und Beratung afghanischer Polizisten erreicht werden. Dabei zeigt sich jedoch, dass in Westeuropa funktionierende Konzepte nicht ohne Weiteres auf andere Kulturen übertragen werden können. Tatsächlich ist die afghanische Polizei für die einheimische Bevölkerung eher eine Quelle der Angst als ein Garant für Sicherheit. Zudem bestehen Probleme bei der Personalrekrutierung und der Materialausstattung, bei der Kooperation mit der afghanischen Regierung und der Einigung mit den anderen UN-Nationen über die inhaltliche Gestaltung der Sicherheitsreform. Letzteres liegt auch daran, dass verschiedene Nationen für die unterschiedlichen Bereiche des Sicherheitssektors wie Polizei (Deutschland), Militär (USA), Justiz (Italien) oder Demobilisierung (Japan) verantwortlich sind, sodass kein einheitliches Reformkonzept besteht.
Eine weitere internationale Polizeimission mit deutscher Beteiligung findet im Kosovo statt, wo ebenfalls u. a. ein Polizeiwesen aufgebaut werden soll. An dieser Aufgabe sind hier allerdings 44 Nationen beteiligt. Neben Kommunikations- und Koordinationsschwierigkeiten bestehen dabei auch unterschiedliche Auffassungen über das Selbstverständnis der Polizei. Vertrauensverlust der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen, Korruption, steigende Kriminalitätsraten und Etablierung von Mafiabanden sind die Folge.
„Culture clash“ beim sogenannten Wiederaufbau
Intervenieren westliche Mächte im Ausland und versuchen anschließend den Staat, in dem interveniert wurde, neu aufzubauen, dann legen sie dabei meist ihr eigenes Verständnis von Fortschritt und Entwicklung als Maßstab für das Gelingen des Wiederaufbaus an. Freie Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie setzen sie als anzustrebende Ziele. Die Herstellung von Sicherheit gilt dabei als Voraussetzung zum Erreichen dieser Ziele. Um Sicherheit herzustellen, werden Herrschaftsinstitutionen wie die Polizei etabliert, die über die Legalität und Illegalität von Verhaltensweisen urteilen. In nicht-westlichen Kulturen sind aber teilweise ganz andere Werte und Normen verankert. Das westliche Verständnis einer demokratisch legitimierten, „für Recht und Ordnung sorgenden“ Polizei setzt sich daher nur schwer durch. Eine stärkere Einbeziehung der einheimischen Kultur und lokaler Akteure wäre nötig sowie ein intensives Vertrautmachen mit den sozialen, ethnischen und geschichtlichen Hintergründen einer Gesellschaft und Region, um bessere Zugänge zu den Menschen zu finden. Allerdings kann man als von der UN gesandter Polizist an die Grenzen seines Selbstverständnisses geraten, wenn die einheimische Kultur soweit berücksichtigt wird, dass von Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gesprochen werden kann.
Im Bereich des Polizeiwesens ist aber festzuhalten, dass die Demokratisierung des Staates auch gar nicht das Erfolgskriterium ist. Vielmehr soll die Polizei für eine Stabilisierung und Befriedung der Region sorgen, für die Herstellung öffentlicher Sicherheit. Welches Staatsverständnis dabei durchgesetzt werden soll, ist auf einer anderen Ebene zu klären.
Die Absicht, die eigenen Werte und Normen in fremden Kulturen zu etablieren, führt zu der Frage, ob es sich bei solchen Interventionen um Neo-Kolonialismus handelt. Insbesondere beim Afghanistan-Einsatz ist diese Frage zu stellen, da hier im Gegensatz zu vielen anderen Missionen nicht die Intention war, Menschenrechtsverletzungen durch den Staat an der Bevölkerung zu unterbinden. Vielmehr war Terrorprävention die Rechtfertigung. Afghanistan wurde als Unterschlupf für Terroristen und somit als Gefahrenquelle betrachtet. Die Intervention sollte also für mehr Sicherheit für die westliche Welt sorgen. Während Kolonialisierungen aber in aller Regel wirtschaftlich intendiert und auf Dauer angelegt sind, ist die Intervention in Afghanistan ihrer Natur nach sicherheitspräventiv und vorläufig. Kolonialistisch ist sie somit nicht, imperial dagegen allemal.
Das zunehmende Zusammenwachsen Europas lässt vermuten, dass es irgendwann eine EU-weite Exekutive geben wird.
Geltung ohne Bedeutung?
In vielen Diskussionen wird immer wieder der Kritikpunkt genannt, dass „westliche” Traditionen und Normen nicht einfach zu implementieren wären. Dass heißt, es reicht nicht, die Polizei im Ausland so auszubilden, wie man es „zu Hause“ tut. Man muss sich mit den Werten und Normen des Landes auseinandersetzen. Ansonsten droht die Niederlage des eigenen Handelns.
Der italienische Philosoph und Politikwissenschaftler Giorgio Agamben schildert einen ähnlichen Fall, in dem der Staat versucht ein Regelsystem aufrechtzuerhalten, das kulturell vielleicht nicht überholt ist, aber kein Zusammenleben zwischen Gesetz und Mensch ermöglicht und damit ein bedeutungsloses Regelsystem schafft. Agamben beschreibt es folgendermaßen:
„Was ist ein Staat, der die Geschichte überlebt, eine staatliche Souveränität, die sich über das Erreichen des historischen telos hinaus erhält, wenn nicht ein Gesetz, das gilt, ohne zu bedeuten?”
In Diskussionen, in denen es um Polizeiaufgabenhilfe im Ausland geht, fallen oftmals Begriffe wie „Weltpolizei“ oder die „Indoktrination“ westlicher Werte. Dabei wird kritisiert, dass westliche Werte als Naturrechte dargestellt werden. Dabei seien Werte wie Freiheit und Demokratie nur Erfindungen, und auch Menschenrechte wären nur aus der westlichen Philosophie entstanden, aber würden keine objektiven ‚Ur-Werte‘ darstellen; und so wie auch McDonalds eine Erfindung ist, haben sie einen gewissen Erfolg im Ausland, aber sind sie nicht imstande Traditionen zu brechen.
Franz Kafka beschreibt in seinem Buch “Der Process” die Beziehung mit dem Gesetz als ein „Nichts der Offenbarung”. Darin beschreibt er einen Stand, in dem das Gesetz sich noch behauptet, d.h., dass das Gesetz gilt, aber nichts bedeutet. Auch bei Auslandseinsätzen der Polizei, insbesondere wenn es um den Aufbau einer Polizei bzw. eines Rechtsstaates geht, trifft dieses zu – dem Recht obliegt eine Geltung aber keine Bedeutung.
In seinem Werk „Homo Sacer“ stellt Giorgio Agamben das Gesetz vor, das keine Bedeutung hat. Er bezieht sich auch auf Kafka, auf den Mann „Vor dem Gesetz”, der das offene Tor versucht zu öffnen. So sei auch das Gesetz ein offenes Tor, welches zu öffnen versucht wird. Aber was offen ist, kann nicht geöffnet werden. Daraus ergibt sich nach Agamben ein aktuelles Problem: „Alle Gesellschaften und Kulturen (…) sind heute in eine Krise der Legitimation geraten, in der das Gesetz (…) als reines ‘Nichts der Offenbarung’ gilt.
Auch Immanuel Kant spricht von der „bloßen Form” des Gesetzes, also der alleinigen Geltung: „Nun bleibt von einem Gesetz, wenn man alle Materie, d.i. Jeden Gegenstand des Willens (als Bestimmungsgrund) davon absondert, nichts übrig, als die bloße Form einer allgemeinen Gesetzgebung.”
Aus der Bedeutung des Gesetzes heraus entsteht also auch die Vorrausetzung für die Legitimation und die Sinnhaftigkeit einer staatlichen Handlung. In Afghanistan scheint das „westliche“ Gesetz keine Bedeutung zu haben. Daraus ergibt sich für den Afghanistan-Einsatz die Fragestellung: Kann man mit der Bedeutungslosigkeit des Gesetzes das Scheitern in der Polizeiaufgabe in Afghanistan erklären?
Für die Ausbildung der Polizei in Afghanistan ist Deutschland seit 2002 als internationaler Chefausbilder zuständig. Die Aufgabenstellung der deutschen Polizeibeamten in Afghanistan definiert sich wie folgt:
„Neben der im ersten Schritt dringend benötigten Ausstattung in nahezu allen Bereichen polizeilicher Arbeit hat das Team vor allem die Aufgabe, bei der Reformierung der Ausbildung und Organisation der zukünftigen afghanischen Polizei sowie bei der Drogenbekämpfung als Berater für die jeweiligen afghanischen Verantwortungsträger zur Verfügung zu stehen.”
Insgesamt wurde die Polizeiarbeit von der Polizei Nordrhein-Westfalens als positiv bewertet:
„Die afghanischen Kollegen seien zum ganz überwiegenden Teil durchaus gut qualifizierte Polizisten, die lediglich während der letzten 20 Jahre schlummern mussten [...). Vieles von dieser guten polizeilichen Ausbildung ist auch das Resultat ehemaliger enger Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland in den 60er und 70er Jahren sowie zur DDR zu Zeiten des kommunistischen Machteinflusses nach 1979. Wie gut diese damaligen Beziehungen gewesen sind, können wir noch heute in Gesprächen vor allem mit den älteren afghanischen Kollegen erfahren, die immer wieder von ihren Erlebnissen während dieser Zeit berichten, die bis zur kompletten Teilnahme an Ausbildungen des gehobenen und auch höheren Dienstes reichen.”
Allerdings zeichnen die Medien ein anderes Bild. Die Polizeiarbeit wird doch als „kläglich gescheitert" angesehen, „Die Regeln westlicher Zivilisationen seien außer Kraft" gesetzt worden und die „Schaffung eines Rechtsstaates in Afghanistan [sei] eine Illusion”. Deutschland habe sich in der Rolle des Ausbilders blamiert. „Zu viel Bürokratie, zu wenig Investitionen, dazu Lehrstoffe, die eher ins Schwabenland passen als nach Kabul”, und als „ausgebildet gilt dabei jeder, der mal ein Klassenzimmer gesehen hat und sei es für eine Woche.“
Des Weiteren erreichen auch die Anwärter für die Polizeischule nicht das erforderliche Qualitätsniveau. Die Auszubildenden seien weder „körperlich noch geistig” für den Polizeidienst geeignet und bewürben sich „meistens nur aus Not, nicht aus Überzeugung”. Zudem seien 90 Prozent Analphabeten und könnten sich nicht länger als 30 Minuten konzentrieren. Viele Unterrichtsstunden bestünden allein aus Übersetzungsarbeit. Insgesamt hätte sich „die auf acht Wochen reduzierte Ausbildung der Polizeianwärter nicht bewährt.”
Damit hätte Deutschland die afghanische Wirklichkeit nicht anerkannt und könne auch nicht davon ausgehen, dass die vorgelebten Normen oder Werten aus der westlichen Welt auf fruchtbaren Boden stoßen: „Wir erkennen die afghanische Wirklichkeit nicht an und deshalb werden wir dort scheitern”. Deswegen werde „das Land (…) niemals nach den Regeln westlicher Zivilisation funktionieren” können.
Hierbei ist deutlich zu sehen, dass die Gesetze, Normen und Überzeugungen der westlichen Welt keine Frucht in Afghanistan tragen. Allerdings ist es auch zu bezweifeln, dass niemand den Normen und Werten Bedeutung zumessen möchte. Sicherlich haben westliche Werte nicht den gleichen gesellschaftlichen Stand wie zum Beispiel in Europa, dennoch kann alleine die Bedeutungslosigkeit nicht das Problem der fehlenden Akzeptanz der Entwicklungsprogramme erklären.
Insgesamt zeichnet sich zwar ein fatales Bild der Polizeiausbildungshilfe in Afghanistan ab. Allerdings wäre es zu simpel, das nur auf eine Bedeutungslosigkeit der Gesetze für die afghanische Bevölkerung zu schieben. Denn auch wenn eine Implementierung der Gesetze und Ordnungen nicht immer einfach zu sein scheint, gewisse Tendenzen und Erfolge zeichnen sie ab – auch in Afghanistan. Aber die strukturellen Probleme machen auch eine erfolgreiche Polizeiarbeit zunichte.
Hierbei könnte man auch bei Johan Galtung anknüpfen, der strukturelle Gewalt als eine Form der Ungleichheit sieht. Also ungleiche Behandlung wie auch Verteilung von Einkommen, Bildungschancen und Lebenserwartungen oder auch das Wohlstandsgefälle zwischen der Ersten und der Dritten Welt. Zudem nehme man diese Ungleichheit nur unbewusst wahr – zu sehr ist man in „alten“ Traditionen und Werten gefangen – dennoch „lebt” man sie. Und auch wenn man bei solch einer Hilfe von Seiten der Deutschen nicht von Kolonialismus die Rede sein kann, ist dennoch nicht auszuschließen, dass die Afghanen sich diesem „Machtgefüge“ eigentlich nicht fügen wollen.
Insgesamt muss man feststellen, dass Gesetze keinen Sinn ergeben, wenn Strukturen nicht erschaffen werden, die den Gesetzen eine Bedeutung zumessen können. Ungebildete Menschen in acht Wochen zu gebildeten und voll ausgebildeten Menschen zu machen, ist schier unmöglich. Vor allem, wenn dabei die Hälfte der Zeit für Übersetzungen gebraucht wird und das Einkommen zu gering ist, um eine Familie zu ernähren. Eine Struktur zu schaffen, würde bedeuten, bei den Menschen vor Ort die Struktur zu verändern und Möglichkeiten zu schaffen, die eigene Lebenslage wahrzunehmen und zu verbessern. Das zeigt sich auch dort, wo diejenigen zur Polizei gehen, die keine andere Chance haben und nicht die, die vielleicht „etwas bewegen“ wollen. Das lässt zumeist großen Spielraum für Korruption, welches auch ein großes Problem bei der Polizei in Afghanistan darstellt. Insofern gelten nicht nur andere Normen und andere Traditionen. Sondern auch die Suche nach Lebensverbesserung durch zum Beispiel ökonomische Vorteile gilt auch für die Bewohner.
„Damit die alten Sitten nicht gleich wieder einreißen, bleiben deutsche Mentoren für zehn Monate vor Ort. Doch, so bisher die Erfahrung der Amerikaner, nach zwei Jahren ist die Hälfte der Polizeihelden wieder weg. Manche sterben im Einsatz; die meisten gehen zu Sicherheitsfirmen oder Warlords.” Und die „Norm” nach wirtschaftlichen Vorteilen ist in der westlichen Welt nicht anders.
Polizei auf dem Weg in die Souveränität?
Einen weiteren Kritikpunkt bei Polizeiinterventionen sieht Giorgio Agamben in der wachsenden Zahl von Interventionen, die als Polizeiaktionen „verkauft“ werden, dabei aber eigentlich militärische Missionen darstellen. Dabei, so Agamben, würde die Polizei eine Souveränität erlangen, die ihr eigentlich in der Demokratie nicht zustehe. Agamben bezieht sich darauf auf den Zweiten Golfkrieg, der 1990 anfing und dem das „unscheinbare Gewand einer ‘Polizeioperation’ gegeben“ wurde. Hierbei hätte es sich eigentlich um eine militärische Intervention gehandelt, die dann als Polizeioperation getarnt war. Diese Polizeioperationen haben nach Agamben eine schwerwiegende Konsequenz:
„Tatsache ist, dass die Polizei (…) vielleicht der Ort ist, an dem sich mit größter Deutlichkeit die Nähe, ja fast die konstitutive Vertauschung von Gewalt [violenza] und Recht entblößt, die die Figur des Souverän kennzeichnet.“
Zudem würde die Polizei sich in einem Ausnahmezustand bewegen. Ihre Rolle ist also kein Regelfall. Der Ausnahmezustand wird vom Souverän ausgerufen, welches Agamben nach auch die Polizei ist, und diese kann des Weiteren die Gesetze aufheben. Dieser Ausnahmezustand sei aber auch ein Ort, in dem zwischen Recht und Gewalt keine Unterschiede mehr bestehen. Denn die Ausnahme ist ein Schwellwert der existierenden Rechtsordnung:
„In Wahrheit steht der Ausnahmezustand weder außerhalb der Rechtsordnung, noch ist er ihr immanent, und das Problem seiner Definition betrifft genau eine Schwelle oder eine Zone der Unbestimmtheit, in der innen und außen einander nicht ausschließen, sondern sich un-bestimmen. Die Suspendierung der Norm bedeutet nicht ihre Abschaffung, und die Zone der Anomie, die sie einrichtet, ist nicht ohne Bezug zur Rechtsordnung.“
Der Ausnahmezustand ist insoweit gefährlich, als dass in diesem Augenblick das Recht praktisch aufgehoben wird. In diesem Beispiel wäre die Polizei wirklich souverän und müsste sich nicht rechtfertigen. Prinzipien und Werte gelten dann auf einmal nicht einmal mehr. Die Polizei muss sich also keinem Kontrollmechanismus mehr verantworten und hat grenzenlose Macht. Agamben geht mittlerweile davon aus, dass der Ausnahmezustand zur Regel geworden ist. Dabei bezieht er sich auf Walter Benjamin, der das Recht der Polizei „als den Punkt bezeichnet, an welchem „der Staat (…) jede Rechtsordnung, die er um jeden Preis zu erreichen wünscht, nicht mehr durch die Rechtsordnung garantieren kann.“
Um dieses zu verdeutlichen, führt Agamben die Judenverfolgung während des Dritten Reiches an, die seiner Meinung nach ausschließlich als Polizeioperation konzipiert wurde. Dieses unterstreicht er mit der Wannenseekonferenz im Januar 1942, in der die Polizeifunktionäre die „Endlösung der Judenfrage“ beschlossen haben. Doch diese vermeintlichen Polizeioperationen hätten laut Agamben noch weitere Konsequenzen gehabt. Durch diese Polizeiaktion müsste der Gegner erst mal kriminalisiert werden, um im Nachfolgenden vernichtet werden zu können. Allerdings würden die Staatsoberhäupter vergessen, dass sich die Kriminalisierung auch irgendwann gegen sie selbst richten kann. Zwar nahmen an der Wannseekonferenz sechs führende Polizeifunktionäre teil, aber auch Staatssekretäre verschiedener Ministerien, sowie leitende Funktionäre der Gestapo und SS. Und auch die endgültige Vernichtung der Juden war kein Novum. Der Holocaust wurde schon längst beschlossen und teilweise auch ausgeführt. Es ging hierbei nur noch um eine Systematisierung und bessere Koordinierung sowie Organisation der Deportationen. Zudem sollte die Zusammenarbeit bei dem Genozid sichergestellt werden. Insofern kann nicht davon gesprochen werden, dass “die Endlösung der Judenfrage” eine Polizeioperation war. Zumal das Dritte Reich mit seinen rechtlichen und staatlichen Form eine einmalige Form der “Regierung” darstellt. Insofern ist es schwer, dass auf andere Regierungsformen, wie zum Beispiel die Demokratie, zu beziehen.
Die Polizei der Zukunft?
Keine Frage. Die sogenannte „souveräne Polizei“ wird zu Kontroversen führen, wenn es keine nationale, sondern eine internationale Polizei mit Exekutivrechten geben wird. Fragen nach der Handelslegitimierung sowie nach dem Souverän nach der Definition von Agamben müssten erst mal geklärt werden. Wer darf über Polizeioperationen entscheiden und inwieweit wird das Souveränitätsprinzip aufgehoben?
Empfohlene Zitierweise: Goździelewska, Agnieszka (2013): Aktuelle Problematiken bei der Globalisierung von Polizeiarbeit. In: JBSHistoryBlog.de. URL: http://jbshistoryblog.de [Zugriff: DD:MM:YYYY]
Bibliographie:
Quelle: http://jbshistoryblog.de/2013/01/aktuelle-problematiken-bei-der-globalisierung-von-polizeiarbeit-und-internationalen-polizeimissionen/