In den letzten Jahren wurden die 386 liturgischen Fragmente, die sich hauptsächlich an den Amtsrechnungen der ehemaligen preußischen Ämter befanden, wissenschaftlich bearbeitet.[1] Ein weiterer Band soll nun die nicht-liturgischen Fragmente erschließen, so dass der gesamte Fragmentbestand aus dem Historischen Staatsarchiv in Königsberg dann der Forschung vorliegt. Die meisten der in diesem Bestand vorhandenen deutschsprachigen Fragmente wurden von Ralf Päsler bereits aufgearbeitet.[2] Gleichwohl sollen diese deutschen Fragmente und die neu aufgetauchten in dem abschließenden Katalog erneut aufgeführt werden.

Recto-Seite 2 mit Beschriftung des Trägerbandes
GStA Berlin, vorläufige Signatur XX. HA, Hs 86, Nr. 21
(Bild: Anette Löffler)
In diesem Fundus befindet sich ein Doppelblatt aus Pergament, das als Kopert zur Jahresrechnung des Amts Neuhaus in den Jahren 1600/1601 gedient hatte, wie die Kopert-Beschriftung aus dem frühen 17. Jahrhundert ausweist.[3] Die Bindungslöcher der Jahresrechnung sind noch sichtbar, ebenso der Platz des ehemaligen Signaturschildchens. Das für die Sekundärverwendung als Kopert an den Rändern umgeknickte Pergament wurde inzwischen in der Restaurierungsabteilung des GStA geglättet. Die 1. Seite des Doppelblatts wurde am Rand beschnitten, was einen Textverlust von ca. 20% nach sich zog. Mit einem Schriftraum von 370 x 230 mm und einem Außenmaß der kompletten Seite von 400 x 260 mm besaß der ehemalige Codex eine stattliche Größe im Großfolio-Format.
Die Ausstattung ist vergleichsweise unspektakulär. Die Überschriften sind in roten Majuskeln gehalten. Neben einzeiligen schwarzen Lombarden existiert zu Beginn einer neuen Homilie eine vierzeilige rote Lombarde mit ornamentaler Verzierung. Bei der Schrift handelt es sich um eine spätkarolingische Minuskel. Die Datierung dieser Minuskel sowie die Provenienzbestimmung gestaltet sich hingegen schwieriger als erwartet.
Das Schriftbild der Minuskel ist sehr einheitlich und weist einen gleichmäßigen Duktus auf. Die einzelnen Buchstaben sind wenig geneigt. Ober- und Unterlängen sind vergleichsweise kurz, lediglich beim x sind sie weiter nach unten ausladend. Abbreviaturen werden außerordentlich zurückhaltend verwendet. Der Schreiber benutzt sie lediglich bei Worten wie dni/dno/dns (domini/domino/dominus), xpo/xpm/xpi (Christo/Christum/Christi), apli/aplis (apostoli/apostolis), usq (usque), ee (esse), spu (spiritu), frs (fratres), nros (nostros), kmi (karissimi), nob (nobis), oma (omnia), sci (sancti), dm/ds/do (deum/deus/deo). Pro wird selten abgekürzt (z. B. proposita: Verso-Seite 2, rechte Spalte, Z. 23), dasselbe gilt für per (z. B. semper: Recto-Seite 1, rechte Spalte, 5, Z. von unten). Generell verwendet der Schreiber den gängigen Abkürzungsstrich für m und n. Eine spezifische Ausprägung findet sich bei e caudata, also etwa in den Wörtern nre (nostre) oder ecce (ecclesie). Hier führt der Schreiber von der unteren Rundung des e einen keilförmigen Strich von rechts oben nach links unten.
Aufgrund der Schriftmerkmale ergibt sich eine Datierung in die 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts. Allerdings weist das äußere Erscheinungsbild auf die Abschrift von einer wesentlich älteren Vorlage. Darauf weist bspw. auch der Schriftmodus auf der Verso-Seite 1 hin, wo eine neue Homilie beginnt. Sowohl die Schrift als auch die Anlage dieser Textstellen verweisen auf einen älteren Text. Die Rubriken führen wie im Homéliaire bavarois folgenden Text [vi]gilia sancti Petri [et Pauli] euangelium secundum Iohannem, gefolgt von dem Text aus Iohannes 21,15-19. Im Anschluss findet sich die Rubrik Omelia [venera]bilis Bede presbiteri [de eode]m lectione.[4] Auch die Schrift ist einer älteren Quelle nachempfunden, indem die Rubriken in Majuskeln ausgeführt werden und zudem auch die Schrift der Vorlage imitiert wird. Dies zeigt sich bspw. an dem Majuskel-M, das durch seine Bögen ganz eindeutig auf entsprechende alte Quellen hinweist.
Ein Vergleich mit anderen Texten ergibt bezüglich der Datierung ein gewissermaßen leicht diffuses Bild. Eine Datierung in die 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts erscheint deshalb angebracht.[5] In Verbindung mit einer möglichen Provenienz gestaltet sich das Bild allerdings nicht einheitlicher. Zwar sind die meisten der von der Schrift vergleichbaren Handschriften im weitestgehend süddeutschen Raum einzuordnen, dennoch dürfte das hier vorliegende Fragment nicht zwangsläufig ebenfalls in dieser Gegend zu verorten sein. Ähnliche Schriftelemente finden sich bspw. in einem möglicherweise aus Köln stammenden Psalter Hs 45, der um 993/996 geschrieben wurde, wobei diese Datierung für die hier vorliegenden Fragmente nicht in Frage kommen.[6] Gleiches gilt für die ähnliche Schriftausprägung in dem Homiliar Cod. Aug. perg. XVI von der Reichenau, das in das 2. Drittel des 10. Jahrhunderts datiert wird.[7] Zwei weitere liturgische Handschriften bzw. Fragmente aus der Mitte des 11. Jahrhunderts sind von der Schrift noch vergleichbar. Dies ist einmal ein Pontifikale aus Südost-Deutschland, welches sich heute in der Stadtbibliothek Schaffhausen befindet,[8] sowie ein wahrscheinlich aus England stammende Psalterfragment aus dem Bestand des Schlossmuseums Sondershausen.[9]
Die in diesem Fall statthaft erscheinende Datierung in die 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts ist eben auch der uneinheitlichen Überlieferung sowie der alten Vorlage geschuldet. Damit ist aber auch wahrscheinlich, dass das vorliegende Homiliar-Fragment nur ganz allgemein aus dem deutschen Überlieferungsbereich stammt. Eine Entstehung in Preussenland scheidet aufgrund des Alters somit vollständig aus.
Auf welchen Wegen diese Handschrift nach Preussenland gelangte, ist nicht mehr rekonstruierbar. Im Ordensland müssten selbstverständlich eine erhebliche Anzahl derartiger Handschriften in Benutzung gewesen sein. Allein schon für das Stundengebet waren derartige Bücher notwendig. Allerdings sind kaum Hinweise auf die Existenz von Homiliaren im Ordensland zu finden. In den Statuten des Deutschen Ordens finden sich weder in der Regel noch in den Gesetzen oder in den Gewohnheiten entsprechende Indizien für eine Verwendung von Homiliaren.[10] Im Großen Ämterbuch des Deutschen Ordens, in dem auch der Buchbesitz in den einzelnen Komtureien, Pfarren und Kirchen wenn auch sehr plakativ und lediglich in quantitativem Maßstab aufgeführt wird, kommt nur zum Jahr 1405 für die Pfarrei Thorn ein omelia de sanctis vor.[11] Nicht von der Hand zu weisen ist natürlich auch die Vermutung, dass die Handschriften, die wir heute als Homiliare bezeichnen in den mittelalterlichen Quellen anderweitig bezeichnet werden, etwa als Lectionarium, Sermonarium o.ä.[12] Auch Arno Mentzel-Reuters konnte in seiner Habilitation über den Buchbesitz im Deutschen Orden keine expliziten Homiliare erkennen.[13] Im Großen Ämterbuch finden sich unter den Begriffen buch mit sermones oder predigbucher wenigstens einige wenige Nachweise.[14] Auch ein buch dorinne lectiones kommt in den Jahre 1507 und 1508 für Preussisch Mark vor.[15]
Dennoch befanden sich im Ordensbesitz mit Sicherheit Homiliare. Nach der Reformation und der Umwandlung des preußischen Ordensstaates in ein weltliches Herzogtum wurde ein Teil der ehemaligen Buchbestände der Ordenskonvente in der Ordensliberei Tapiau aufbewahrt.[16] Diese Bestände wurden 1541-1543 in die Schlossbibliothek nach Königsberg überführt. Von dieser Überführung existiert ein heute im GStA Berlin aufbewahrtes Verzeichnis.[17] Dort finden sich zwar mehrfach Predigtsammlungen sowie einige liturgischen Handschriften, unter den knapp 340 Büchern ist jedoch kein Homiliar genannt oder umschrieben.
Wie die meisten Jahresrechnungen der preußischen Ämter sind auch die des Amtes Neuhaus nahezu lückenlos überliefert. Weitere Fragmente wurden für einige Neuhauser Jahresrechnungen „verarbeitet“. So sind auch die Jahre 1593/94, 1601/02, 1605/06, 1607/08, 1614/15, 1615/16, 1617/18 sowie 1619/20 mit liturgischer Makulatur versehen.[18] In diesen Zeitraum fügt sich das vorliegende Fragmente den Rechnungsjahren 1600/01 perfekt ein. Außerdem legt dies den Gedanken nahe, dass diese Amtsrechnungen offensichtlich von demselben Buchbinder in einer Art konzertierter Aktion eingebunden wurden. Ihre Zugehörigkeit zu einer Konventsbibliothek des Deutschen Ordens gewinnt dadurch an Gewicht, dass es sich bei der liturgischen Makulatur um Handschriften handelt, die der Liturgie des Deutschen Ordens folgten.[19]

Beginn der Homilie zu Vigilia Petri et Pauli
GStA Berlin, vorläufige Signatur XX. HA, Hs 86, Nr. 21
(Bild: Anette Löffler)
Inhaltlich gesehen handelt es sich um Teile der Homilien 20 und 22 des Beda Venerabilis.[20] Aus den fehlenden Textteilen ergibt sich, dass es sich bei diesem Doppelblatt um das zweitinnerste einer Lage handeln muss. Beide Homilien entstammen dem Sanktorale. Homilia 20 birgt Teile zu dem Fest der Geburt Johannes des Täufers (24. Juni), Homilia 22 mit dem Initium Virtutem nobis perfectae dilectionis den Beginn zur Vigil von Petrus und Paulus (28. Juni). Diese beiden Homilien finden sich außer im Homéliaire bavarois noch im Homiliar von Mondsee, im Homiliar des Hrabanus Maurus sowie in der Sammlung des Smaragdus.[21] Ihren Stammplatz besitzen diese beiden Homilien allerdings im Homeliar des Paulus Diaconus, wo sie auch direkt aufeinander folgen.[22] In der genannten Reihenfolge erscheinen die beiden Homilien auch im Homeliar von Mont Saint-Michel, einer Handschrift des 12. Jahrhunderts.[23] Die Homilie zur vigilia von Petrus und Paulus ist allerdings nicht mit der im Fragment vorliegenden identisch, obwohl das Initium gleich beginnt, dann aber wie schon aus der Überschrift im Codex kenntlich sich als Omelia Claudii presb. de eodem lectione, also einem Auslegungsteil des Alcuin zum Johannes-Evangelium, erweist.[24]
Die textliche Überlieferung orientiert sich überwiegend an der Handschriftenfamilie, die in der Edition der Classis I B (Codices deteriores) zugehörig sind.[25] Lediglich mit der Handschrift L der Classis II A (Codices meliores) weist das Fragment weitere Gemeinsamkeit in der Textüberlieferung auf.[26]Alle vier Textzeugen stammen aus dem 10. bis 11. Jahrhundert. Allerdings sind im vorliegenden Fragment weitere, in der Edition nicht berücksichtigte, Textvarianten vorhanden. In Homilia 20 wird das Wort autem durch ein enim ersetzt.[27] Und zu Beginn der Homilia 22 heißt es im Fragment totiens statt toties und wenige Zeilen darunter in dominum statt in deum.[28] Noch eine weitere Abweichung taucht in Homilia 22 auf, nämlich die Einfügung von et gegen Ende des Textes.[29]
[1] Anette Löffler: Fragmente liturgischer Handschriften des Deutschen Ordens im Historischen Staatsarchiv Königsberg (Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 18, hg. von Udo Arnold), Lüneburg 2001; dies.: Fragmente liturgischer Handschriften des Deutschen Ordens aus dem Historischen Staatsarchiv Königsberg/Preußen II (Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 24, hg. von Udo Arnold), Marburg 2004; dies.: Fragmente liturgischer Handschriften des Deutschen Ordens im Historischen Staatsarchiv Königsberg/Preußen III (Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 28, hg. von Udo Arnold), Marburg 2009.
[2] Ralf Päsler: Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte 15, hg. von Uwe Meves), Oldenburg 2000, hier S. 154-179. Dazu auch ders.: Deutschsprachige Sachliteratur im Preußenland bis 1500. Untersuchungen zu ihrer Überlieferung (Aus Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- und Osteuropas 2, hg. von Klaus Garber und Axel E. Walter), Köln 2003.
[3] Signatur des Trägerbandes: GStA Berlin, XX. HA., Ostpr. Fol. 7662. Das Fragment trägt die vorläufige Signatur Hs 86, Nr. 21.
[4] Henri Barré: Les Homéliares carolingiens de l’École d’Auxerre. Authenticité – Inventaire – Tableaux comparatifs – Initia (Studi e Testi 225), Città del Vaticano 1962, S. 25-26 und 218.
[5] Für kollegialen Rat danke ich einmal mehr Prof: Dr. Herrad Spilling, Stuttgart.
[6] Glaube und Wissen im Mittelalter. Die Kölner Dombibliothek, Köln 1998, S. 219-224, mit weiterer Literatur.
[7] Vor dem Jahr 1000. Abendländische Buchkunst zur Zeit der Kaiserin Theophanu, Köln 1991, S. 116-117, mit weiterer Literatur.
[8] Europas Mitte um 1000, hg. von Alfried Wieczorek / Hans-Martin Hinz, 3 Bde., Stuttgart 2000, hier Bd. 3, S. 434-435.
[9] Bestandskatalog zur Sammlung Handschriften- und Inkunabelfragmente des Schloßmuseums Sondershausen, hg. von Gerlinde Huber-Rebenich / Christa Hirschler (Sondershäuser Kataloge III), bearb. von Matthias Eifler, Almuth Märker und Katrin Wenzel, Jena 2004, S. 119.
[10] Max Perlbach (Hg.): Die Statuten des Deutschen Ordens, Halle 1890, ND Hildesheim 1975.
[11] Walther Ziesemer (Hg.): Das Größe Ämterbuch des Deutschen Ordens, Danzig 1921, S. 462, Z. 7.
[12] Ein mitteldeutsches Lektionarfragment aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts befindet sich bspw. unter den deutschen Königsberger Fragmenten, s. Ralf Päsler: Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg, hg. von Uwe Meves (Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte 15), München 2000, S. 173.
[13] Arno Mentzel-Reuters: Arma spiritualia. Bibliotheken, Bücher und Bildung im Deutschen Orden (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 47, hg. von Michael Knoche), Wiesbaden 2003.
[14] Ziesemer (wie Anm. 11) für den obersten Marschall in der Komturei Königsberg in den Jahren 1431-1438 16 predigebucher, S. 29, Z. 15; S. 32, Z. 13; S. 34, Z. 35; S. 39, Z. 6; S. 40, Z.21 oder für die Sakristei der Komturei Osterrode 1449 5 bucher sermonen S. 337, Z. 31 und 35.
[15] Ziesemer (wie Anm. 11), S. 146, Z. 27 und S. 147, Z. 37.
[16] Hans-Georg Malz: Das Bibliothekswesen des Deutschen Ordens in Preußen unter besonderer Berücksichtigung des Verzeichnisses der Ordensliberei Tapiau, ungedruckte Diplomarbeit, Köln 1970, hier S. 55 ff.
[17] GStA Berlin, EM, Tit. 71,1, Nr. 43. Ein weiterer Abdruck auch bei Eckhard Grunewald: Das Register der Ordensliberei Tapiau aus den Jahren 1541-1543, in: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte 1 (1993), S. 55-91.
[18] Löffler I (wie Anm. 1), Nr. 128, S. 157-158; Nr. 133-137, S. 162-169; Nr. 139, S. 170-172.
[19] Nr. 128, 135, 137, 139 und 140: Missale OT;Nr. 133 und 134: Antiphonarium OT;
[20] Beda Venerabilis Opera, Pars III: Opera homiletica, Pars IV: Opera rhytmica (Corpus Christianorum, Series Latina 122), Turnhout 1965, S. 333-334, 342, 344 und. 346-348. Patrologiae cursus completus, series Latina (künftig: PL), hg. von Jacques-Paul Migne, Paris 1844 ff., 94, Sp. 210-214 und 214-219.
[21] Barré (wie Anm. 4), S. 25-26 und 218.
[22] Reginald Grégoire: Homéliaires liturgiques médiévaux. Analyse de mansucrtits (Biblioteca della „Studi medievali“ 12), Spoleto 1980, S. 461, Nr. 44-45, in der Überlieferung der Karlsruher Handschrift Hs. Augiensis 15 aus dem 9. Jahrhundert..
[23] Raymond Étaix: Homéliaries patristiques latins. Recueil d’études de manuscrits médiévaux (Collection des études Augustiniennes, Série moyen âge et temps modernes 29), Paris 1994, S. 281, Nr. 129, zu Beginn des Sommerteils des Sanktorale.
[24] Étaix (wie Anm. 23), S. 281; PL 100, Sp. 1000D-1003B.
[25] CCSL 122 (wie Anm. 20), S. XVII-XVIII.
[26] CC SL 122 (wie Anm. 20), S. XVIII.
[27] CCSL 122, (wie Anm. 20), S. 333, Z. 178.
[28] CC SL 122 (wie Anm. 20), S. 344, Z. 7 und 10.
[29] CC SL 122, (wie Anm. 20), S. 347, Z. 206, zwischen erant und ceteri.
Über die Autorin: Dr. Anette Löffler M.A. promovierte zu einem Thema der spätmittelalterlichen hessischen Landesgeschichte. Nach der Promotion war sie in verschiedenen Handschriftenabteilungen, in Bibliotheken und Archiven als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Liturgie des Deutschen Ordens, Fragmentforschung sowie die Erforschung mittelalterlicher Buch- und Bibliotheksbestände.
Sie können den gesamten Beitrag auch als pdf-Datei herunterladen: download
Quelle: http://mittelalter.hypotheses.org/889
_-_1875.jpg/433px-Jebens,_Adolf_-_Leopold_von_Ranke_(detail)_-_1875.jpg)

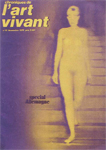
![Plan du Tien-tang ou temple dedié à Chang-ti ou souverain seigneur du ciel / [tirée du P. Duhalde]](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1105/files/2013/04/tiantan-192x300.jpg)



