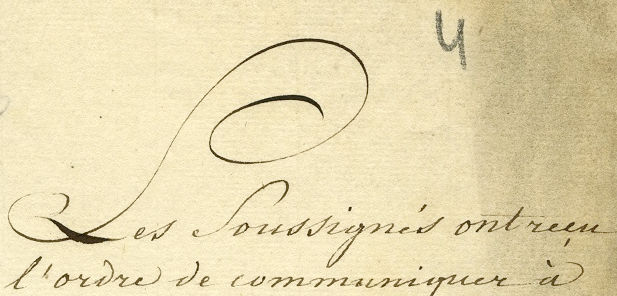Historiker, die im Archiv forschen, sind sich oft unsicher, wie sie Aktenschriftstücke zitiert werden sollen. Jedenfalls wurde ich mehrfach darauf angesprochen, seit ich dieses Blog betreibe. Hier also Faustregeln eines Historiker-Archivars zum guten Zitieren:
- Nenne den Typ des Schriftstücks!
- Gib Entstehungsstufe und Überlieferungsform an, wenn sie von der Norm abweichen.
- Übergehe kanzleitechnisches Beiwerk.
Was ist darunter zu verstehen?
Das Problem
Ich schreibe bewusst "gut" statt "richtig zitieren", denn den einzig wahren Weg gibt es meiner Auffassung nach nicht. Was anzugeben ist und was nicht, sollte sich nach den Eigenheiten des zitierten Schriftstücks und dem Argumentationszusammenhang in der zitierenden Arbeit richten. Eine Zitation würde ich als gut bezeichnen, wenn ihr Informationsgehalt in diesen beiden Bezügen angemessen ist.
Normalerweise wird zu Zitaten aus Archivalien nur die Fundstelle angegeben, also eine mehr oder weniger komplizierte Sigle, die es erlaubt, den zitierten Text im Archiv exakt wiederzufinden. Dazu braucht es neben der meist dreiteiligen Archivaliensignatur (Archiv, Bestand, Bestellnummer) die Blattzahl (fol. oder Bl.). Manche Zeitschriften untersagen in ihren Manuskriptrichtlinien sogar weitergehende Beschreibungen als zur Wiederauffindung unnötig. Kostet im Druck eben Platz.
Das ist etwa so, als würde man eine Online-Veröffentlichung nur mit ihrem URN zitieren.
Und man kommt schon in Schwierigkeiten, wenn die Archivalien-Einheit, aus der zitiert wird, nicht foliiert ist. Das Schriftstück dann durch das Datum näher zu bezeichnen, wie ich das in meinem Erstling auch getan habe (Berwinkel 1999 - um mit schlechtem Beispiel voranzugehen), hilft nur bei weniger dichten Serien, bei denen dies ein eindeutiges Merkmal ist, und setzt für die nicht triviale Datierung unübersichtlicher Entwürfe selbst aktenkundliche Expertise voraus. Weit kommt man damit also nicht.
Der Schriftstücktyp
Es liegt nahe und ist verbreitet, Verfasser und Adressat plus Datum zu nennen: X an Y, 1. 1. 1900 (oder 1900 Januar 1 oder wie auch immer). Aber was tun, wenn es sich nicht um Korrespondenz mit Y handelt, sondern um Aufzeichnungen für die eigenen Akten des X? In diesem Fall führt schon rein sprachlich kein Weg daran vorbei, das Schriftstück näher zu charakterisieren.
Aus dieser praktischen Not sollte man eine methodische Tugend machen. Durch die Suche nach der treffenden Bezeichnung für ein Schriftstück vergewissert man sich des richtigen Verständnisses von dessen Form und Funktion, die als Kontext der Textinformation für die Quellenkritik entscheidend sind, und gibt seinen Lesern ein Hilfsmittel zur Falsifizierung der eigenen Schlüsse an die Hand. Gutes Zitieren zwingt zur Stellungnahme.
Bei der Benennung des Typs geht es um die Identifizierung des Zwecks einer verschriftlichten Information (Mitteilungen an Entfernte, Stütze des eigenen Gedächtnisses usw. - siehe Papritz 1959) und, bei Korrespondenzen, der aktenkundlich so genannten Schreibrichtung. Die Schreibrichtung ist ein elementares quellenkritisches Merkmal. Aktenstücke in öffentlichen Archiven stammen zumeist aus hierarchischen Institutionen, die das Verhältnis der korrespondierenden Personen bestimmten. Es wird von unten nach oben berichtet, von oben nach unten verfügt oder auf gleicher Ebene mitgeteilt.
X schreibt an Y mit einem bestimmten Inhalt - gut. Aber berichtet er seinem Vorgesetzten Y oder weist er seinen Untergebenen Y an? Die Bedeutung dieses Kontexts für die Interpretation des Texts liegt auf der Hand. Also zitiert man besser:
X an Y, Bericht, 1. 1. 1900, oder:
Behördenreskript der Kriegs- und Domänenkammer X an den Bergbaubeflissenen Y, 31. 12. 1770.
Entsprechend bei immobilem Memorienschreibwerk, wie man es aktenkundlich nennt:
X, Aktenvermerk, 30. 9. 1965, oder:
Abrechnung des Amtmanns X, 12. 12. 1701.
Ich bevorzuge die Stichwortform ohne Genitive. Man muss die Umständlichkeit der Quellensprache nicht emulieren.
Zweck und Form haben im Laufe der Jahrhunderte sehr unterschiedliche Typen von Schriftstücken hervorgebracht. Die Aktenkunde hat die zeitgenössischen Bezeichnungen vereinheitlicht und systematisiert. Im Ergebnis liegt ein sehr fein differenziertes Instrumentarium vor, das für die "klassische" Zeit bis 1918 bei Kloosterhuis (1999) mustergültig und handhabbar zusammengestellt ist. Dieser Begriffsapparat kann beim Erstkontakt abschreckend wirken. Am Gebrauch der aktenkundlichen Verabredungsbegriffe führt aber kein Weg vorbei, weil nur über diese eine wissenschaftliche Verständigung möglich ist. Man sollte sich nicht, wie es oft geschieht, eine private Terminologie aus zeitgenössischen Selbstbezeichnungen der Stücke und heutiger Umgangssprache stricken.
Die Bestimmung des Schriftstücktyps (Klassifizierung im Sinne der Systematischen Aktenkunde) betrachte ich als unverzichtbar, um ein Schriftstück als physischen Informationsträger angemessen zu zitieren.
Entstehungsstufe und Überlieferungsform
Bei Entstehungsstufe und Überlieferungsform halte ich es aber für ausreichend, Abweichungen von der Norm anzugeben. Dazu muss man diese beiden Kriterien aber zunächst vom Schriftstücktyp unterscheiden. Zur Illustration des Problems hier einige Beispiele aus der inhaltlich vorzüglichen Arbeit von Simone Derix (2009), die ich zufällig in den Händen hatte:
"Abschrift BM Lehr an StS BKAmt" (40 Anm. 63) - eine Abschrift wovon? Doch wohl von einem Mitteilungsschreiben unter praktisch gleich Gestellten (Bundesminister - Amtschef des Bundeskanzlers).
"Paper prepared in the Department oft State, Washington" (259 Anm. 240) - das ist ein Zitat aus dem Inhalt (Überschrift?), aber keine Charakterisierung.
"Funkübermittlung, BKA" (293 Anm. 49) - Was wird übermittelt, ein Bericht? Und in welcher Form liegt das Stück in den Akten vor? Schließlich musste die drahtlose Übermittlung verschriftlicht werden.
Korrespondenz liegt in Behördenakten in der Regel in zwei Entstehungsstufen vor:
- Eigene ausgehende Schreiben im Entwurf, der von allen zuständigen Instanzen genehmigt wurde und infolge dessen eine Reihe von Vermerken zum Urtext trägt.
- Fremde eingehende Schreiben als Ausfertigung, wie sie in der Kanzlei des Absenders als Reinschrift von dessen Entwurf hergestellt wurde.
Wenn nun in den Akten einer Behörde ein Bericht an das Ministerium als Entwurf vorliegt und dessen darauf folgender Erlass als Ausfertigung, dann ist das normal und muss beim Zitieren nicht beachtet werden.
Hoch relevant sind dagegen die Abweichungen von der Norm: Warum ist die Ausfertigung des eigenen Berichts bei den Akten? Ist er niemals abgegangen, wurde er im letzten Moment kassiert? Warum zeigt der Entwurf keine Spuren des Genehmigungsverfahrens? Im Zitat kann dies so ausgedrückt werden:
X an Y, Bericht, nicht genehmigter Entwurf, 15. 5. 1925.
Kabinettsordre Herzog Xs an den Amtmann zu Y in nicht vollzogener Ausfertigung, 1781 März 18.
Die Überlieferungsform ist etwas anderes. Ihre Kategorien sind Original - Abschrift/Kopie - Durchschlag usw. Hier findet man sich am ehesten instinktiv zurecht, dennoch drohen schwere Fehler: Ausfertigung und Original sind nicht identisch; auch von einem Entwurf gibt es ein Original (und beliebig viele Doppelstücke als Durchschläge oder Kopien). Auch "Abschrift" sagt nichts über den Typ des Schriftstücks aus.
Gleichwohl ist die Angabe der Überlieferungsform essentiell, sofern es sich nicht um das Original handelt. Es ist leicht einzusehen, dass es einen Unterschied macht, ob z. B. ein Schreiben des späten Mittelalters vom Original (der Ausfertigung oder des Entwurfs) oder von der Abschrift in einem Briefbuch zitiert wird.
Es geht um den Nachweis, die Quelle in ihrer maßgeblichen Form benutzt zu haben. Daran erweist sich auch das handwerkliche Können bei der Archivrecherche: Es war z. B. normal, einen Bericht der vorgesetzten Behörde mit einer bestimmten Zahl von Durchschlägen (der Ausfertigung) einzureichen, die an die zuständigen Stellen im Hause verteilt wurden. Das Original blieb dabei das Arbeitsexemplar, auf dem die Entscheidungsfindung (wie soll auf den Bericht reagiert werden?) durch Vermerke dokumentiert ist. Auf diese Bearbeitungsspuren richtet sich das historische Interesse manchmal mehr als auf den Urtext. Wer zufällig auf einen Durchschlag stößt und es dabei bewenden lässt, zitiert nicht die maßgebliche Überlieferung und begeht damit einen schweren methodischen Fehler.
Wenn nun das Arbeitsexemplar verloren oder nach Ausschöpfung aller Mittel nicht aufzufinden ist, muss ausgewiesen werden, dass ausnahmsweise nach einer sekundären Überlieferungsform zitiert wird:
X an Y, Bericht, Durchschlag, 23. 5. 1949.
Kopie der Ausfertigung des Erlasses des Ministerialrats X an das Finanzamt Y-Innenstadt, 3. 6. 1980.
Konzentration auf das Wesentliche
In der Archivarbeit führt Unsicherheit zum Drang nach Vollständigkeit: Ein normales Behördenschriftstück enthält eine große Menge von Bearbeitungsspuren, vom Eingangsstempel bis zum Grünstift des Chefs. Aus Furcht, etwas wichtiges zu unterschlagen, bringen viele Wissenschaftler eine methodisch unreflektierte Auswahl aus den formalen Merkmalen des Schriftstücks, die das Wesentliche eher verschleiert.
Hier ein Beispiel aus einem ausgezeichneten Aufsatz, dem wegen seiner tagespolitischen Aktualität breite Rezeption zu wünschen ist (Spohr 2010: 30 Anm. 89):
"Drahterlass, Telko Nr. 1374 an BM Delegation, D2, Dr Kastrup; Betr: Gespräch mit AM Schewardnadze (10.2.1990 im Kreml)—Fortsetzung zu Plurez 1373, 11 February 1990"
Hier sind überflüssig:
- der Betreff,
- der Bezug zum Vorgänger-Erlass,
- die fernmeldetechnische Kontrollnummer.
Nicht optimal ist die unverarbeitete Angabe des Adressaten in Form eines Zitat (und das auf Deutsch, mit nicht aufgelösten Abkürzungen, in einem englischen Text).
Als Zitation reicht: Auswärtiges Amt an Kastrup, Drahterlass, 11. 2. 1990.
Rein kanzlei- und registraturtechnische Vermerke, bei modernen Schriftstücken auch Angaben zum Beglaubigungsmittel und dergleichen haben nur in Ausnahmefällen eine Bedeutung. Diese Fälle sind wichtig, aber aktenkundliche Forensik lässt sich in einer Zitation aber nicht mehr unterbringen, sondern verlangt Erläuterungen im Text.
Dass sie in der Zitation übergangen werden können, bedeutet keineswegs, dass diese technischen Spuren als Bestimmungsfaktoren ignoriert werden können! Schließlich ergeben sich der Schriftstücktyp, die Entstehungsstufe und die Überlieferungsform aus ihren Kombinationen. Aber wenn das Haus gebaut ist, soll das Gerüst verschwinden.
Über Kommentare zu zitiertechnischen Spezialproblemen würde ich mich freuen.
Literatur
Berwinkel, Holger 1999. Münzpolizei in geteilter Landesherrschaft. Beobachtungen aus der Ganerbschaft Treffurt 1601-1622. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 49. S. 67-86.
Derix, Simone 2009. Bebilderte Politik. Staatsbesuche in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1990. Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 184. Göttingen.
Kloosterhuis, Jürgen 1999. Amtliche Aktenkunde der Neuzeit. Ein hilfswissenschaftliches Kompendium. Archiv für Diplomatik 45. S.465–563. (Preprint online)
Papritz, Johannes 1959. Die Motive der Entstehung archivischen Schriftgutes. In: Mélanges offerts par ses confrères étrangers à Charles Braibant. Brüssel. S. 337–448.
Spohr, Kristina 2012. Precluded or Precedent-Setting?: The "NATO Enlargement Question" in the Triangular Bonn-Washington-Moscow Diplomacy of 1990-1991. In: Journal of Cold War Studies 14. S. 4-54.
Quelle: http://aktenkunde.hypotheses.org/289