Frühneuzeit-Blog der RWTH – Willkommen!
Wir machen weiter, nicht mehr als Blog der AGFNZ, sondern mit den importierten Inhalten des AGFNZ-Blogs als Frühneuzeit-Blog der RWTH, verantwortet von dem Lehr- und Forschungsgebiet Frühe Neuzeit an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, Professur Christine Roll. Ausführlicher dazu in Kürze!
Stellungnahme zum Feldversuch Gesichtserkennung in Karlsruhe
Wir haben im September bereits über die Absage eines Feldversuches für ein Verfahren zur Gesichtswiedererkennung (face recognition) im Karlsruher Fußballstadion Wildpark berichtet (Feldversuch Gesichtserkennung im Fußballstadion Wildpark gestoppt).
Seit 04. Oktober 2011 gibt es in dieser Angelegenheit vom Innenministerium des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg eine Antwort auf eine sog. “Kleine Anfrage” der Grünen Landtagsabgeordneten Alexander Salomon und Wilhelm Halder. Die gesamte Kleine Anfrage und Antwort kann hier eingesehen werden.
Bei Dursicht der Antwort kommt u.a. heraus, dass bisher noch nicht geklärt sei, wie es im mit 1,2 Millionen Euro vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im KMU-innovativ-Programm gefördertem Forschungsprojekt „Parallele Gesichtserkennung in Videoströmen“, an welchem maßgeblich die öffentliche Einrichtung Karslruher Institut für Technologie (KIT) beteiligt ist, weitergehen soll. Die beteiligten Projektpartner würden derzeit Alternativen für das weitere Vorgehen im Rahmen des Projektes prüfen, insbesondere unter welchen Rahmenbedingungen entsprechende Videoaufnahmen durchgeführt werden können. Möglicherweise solle auch gänzlich auf Feldversuche verzichtet werden, ohne dadurch den Projekterfolg zu gefährden.
Gerade dieser letzte Punkt erscheint mir vollkommen rätselhaft, die Innovation dieses Projekts würde ich aus technischer Sicht gerade darin sehen, dass ein solches Verfahren in der Praxis getestet wird. Unter kontrollierten und standardisierten Laborbedingungen mag Gesichtswiedererkennung teilweise ja funktionieren, aber unter realen Feldbedingungen gibt es doch erhebliche Mängel. Deshalb finde ich es auch unverständlich, dass das Innenministerium von BaWü die Frage, wie sie den Einsatz von Gesichtserkennungstechniken im Zusammenhang mit “halböffentlichen” Orten wie Fußballstadien bewerte, folgendermaßen beantwortet:
Die Kombination von Videotechnik und automatisierter Gesichtserkennung eignet sich in besonderer Weise zur Identifizierung von Personen.
Markant ist, dass jegliche Begründung, wieso sich automatisierte Gesichtserkennung in besonderer Weise zur Identifizierung von Personen eignet, gänzlich fehlt. Auf wen oder was beruft sich hier das Innenministerium? Das Funktionieren der Technik Gesichtswiedererkennung wird ohne Hinterfragen vorausgesetzt, obwohl erst geklärt werden müsste, ob es überhaupt ein geeignetes Instrumentarium darstellen würde. Immerhin wird in der Beantwortung angeführt, dass es beim Einsatz solcher Techniken einer (bisher im Polizeigesetz fehlenden) Rechtsgrundlage und der Einwilligung der Betroffenen bedarf.
Interessant wären desweiteren Einblicke in ein Rechtsgutachten, welches scheinbar zu Beginn des Projektes zur datenschutzrechtlichen Bewertung der geplanten Aufzeichnung durch einen Projektpartner erfolgte.
Ralf Hoffrogge: Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland. Von den Anfangen bis 1914.
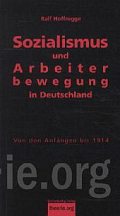 Marion Liebhold vom Buchladenkollektiv Schwarze Risse (Berlin) hat reingeblättert.
Marion Liebhold vom Buchladenkollektiv Schwarze Risse (Berlin) hat reingeblättert.
Die Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung in Deutschland wurde lange dominiert von der Sozialdemokratie und dem orthodoxen Marxismus. Sie hat an den Niederlagen der Bewegung selbst, bis hin zu ihrer Zerschlagung 1933, gelitten. Eine Folge davon ist, dass, wie Ralf Hoffrogge in der Einführung zu diesem Buch schreibt, ein Großteil der linken „Gruppen und Bewegungen abseits von Linkspartei und Gewerkschaften in ihrer politischen Aktivität keinen Bezug mehr zur Geschichte des Sozialismus hat.“ Weil aber die „Klassenfrage“ heute aktueller denn je ist, sind es auch die Erfahrungen und Lehren, die sich aus der Geschichte der Klassenkämpfe und ihrer Organisationen ziehen lassen.
Da eine Sozialgeschichte der modernen Arbeiterbewegung den Rahmen einer theorie.org-Einführung sprengen würde, konzentriert sich Hoffrogge vor allem auf ihre politische Geschichte. Er stellt die Organisationen, ihre Entstehungsbedingungen und LeiterInnen vor und zeichnet die richtungweisenden Debatten und Entscheidungen nach.Die erste wichtige Organisation der Arbeiterbewegung in Deutschland war der ‚Bund der Geächteten‘, zu dem sich 1834 wandernde Gesellen und exilierte Intellektuelle in Paris zusammenschlossen – und zum ersten Mal Arbeiterkämpfe mit der politisch-philosophischen Perspektive eines Sozialismus bzw. (damals noch gleichbedeutend:) Kommunismus verbanden, also mit der Vision einer den Kapitalismus überwindenden Gesellschaft. Die Entwicklung von dort bis zur SDAP bzw. SPD als erster Massenpartei der Arbeiterbewegung und zur Verbreitung der Gewerkschaften war geprägt vom Kampf gegen Repression und um Anerkennung als politischer Akteur.
Dass am Ende dieser Entwicklung die Partei ihre Erfolge nicht mehr an der Revolution, sondern nur noch an Wählerstimmen maß und im arbeitsteiligen Verbund mit den Gewerkschaften an der Verdrängung des politischen Klassenkampfes arbeitete, war auch internen Verwerfungen geschuldet. Die Konflikte zwischen unterschiedlichen Fraktionen, an der Basis der Bewegung und an den Rändern der Organisationen sind die interessantesten Momente der Geschichte.
Hoffrogge gibt den marginalisierten Stimmen und Strömungen viel Raum und rezipiert ‚andere‘ Historiker der Arbeiterbewegung wie Karl Heinz Roth, Ahlrich Meyer und Erhard Lucas. Seine eigene Darstellung politischer Geschichte zeichnet aus, dass in ihr meist nicht einfach ‚eins zum anderen’ führt, sondern die historischen Zusammenhänge komplex und bisweilen paradox sind. Hoffrogge gelingt es, viele Schwächen und Beschränkungen in der geschichtlichen Theorie und Praxis der organisierten Arbeiterbewegung kritisieren, ohne sich von ihr zu verabschieden.
Schmetterling Verlag [theorie.org], Stuttgardt 2011, ISBN 978-3-89657-655-0, Paperback, 216 Seiten, 10,- €
Einsortiert unter:Arbeiterbewegung, Literatur
Tagung in Basel: «Öffentliche Informationen und offene Daten»
Walter Benjamins Hausnummer

Paris, 10 Rue Dombasle (übrigens eine Einbahnstraße): Hier wohnte Walter Benjamin von Jänner 1938 bis Juni 1940.
TV-Serie: Person of Interest
Heute mal ein TV-Tipp für alle, die sich für mediale Repräsentationen von Überwachtungstechniken interessieren. Person of Interest ist eine CBS-Serie und läuft seit September 2011.
Der Trailer fasst die Rahmenhandlung ganz gut zusammen:
Protagonist Harold Finch hat eine gigantische Überwachungsmaschine gebaut, die terroristische Anschläge vorhersagen soll, um ein zweites 9/11 zu verhindern. Die Maschine spuckt allerdings nicht nur terroristische Vorhaben aus, sondern jegliche Art von Straftaten. Da die Regierung an der Verhinderung nicht-terroristischer Straftaten aber kein Interesse hat, verfolgt Finch diese mit seinem Partner John Reese selbst. Die Serie macht ständig Überwachungstechniken zum Thema und spielt dabei mit Utopien und Visionen.
Folgender Dialog aus Episode 2 soll das verdeutlichen. Finch zeigt einem Partner das große Netzwerk an Servern, die die Daten sammeln; der fragt noch einmal nach, ob es sich hier nicht um ein “Orwellian Nightmare” handelt:
Finch: That´s every e-mail, every phone call, surveillance cameras …
Partner: In the country?
Finch: No, that’s just New York. I’m starting with the basics here. I’m trying to teach it to track people using cell phone location data, facial recognition. I’m almost ready to move on to the next problem.
Partner: What’s the next problem?
Finch: Sorting them all out. Terrorists don’t exactly stand out on street corners, you know? You have to teach the machine to sift through the e-mails, wire-tapped phones, bank transactions …
Occupy History
Announcing Formation of Occupy History
Inspired by the creativity and strength of Occupy Wall Street and the Occupy movement around the world, Occupy History seeks to add its voice in support of those speaking out against and demanding solutions to growing injustice and inequality, both economic and social. We encourage historians to work to build the discussion beyond inequality and injustice to include the history of the struggle for equality and justice and the changes needed in our countries' governments.
In addition to showing our support for the Occupy Movement, Occupy History plans to provide resources to the Occupiers. Locally we would like to be a resource Occupiers can go to for speakers and discussion leaders. On our website we plan to provide resource pages with book and film recommendations Occupiers can use for educational purposes.
We hope to develop a list of films, or perhaps the films themselves, that could comprise a film festival of the history of progressive political movements in America and around the world.
To learn more about Occupy History, including how you can participate, please visit our website at occupyhistoryna.wordpress.com.