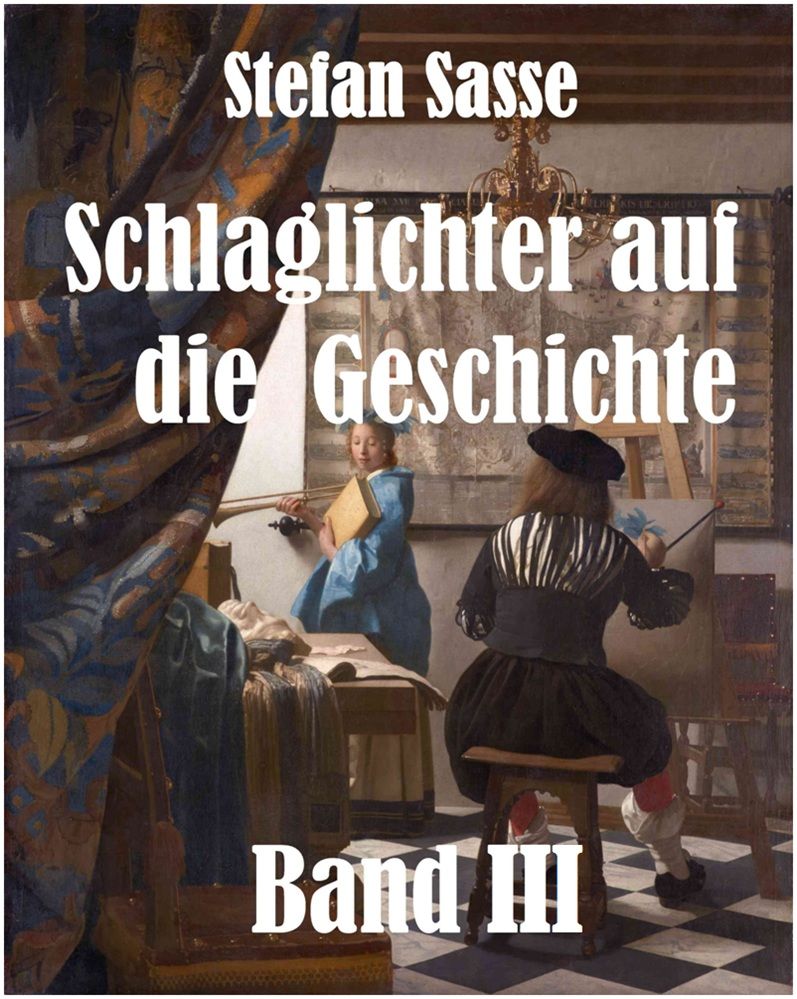Während meines letzten Besuchs im dänischen Nationalarchiv, dem Rigsarkivet, in Kopenhagen bin ich auf verschärfte Sicherheitskontrollen und verkürzte Arbeitszeiten gestoßen. Der Grund hierfür war mir zunächst schleierhaft, bis ich auf diese Nachrichten stieß: „Stort tyveri fra Rigsarkivet“ [Großer Diebstahl aus dem Rigsarkivet, Übersetzung RZ], Berlinske, 25. Oktober 2012. Was ist passiert? Über die letzten 10 Jahre haben zwei Männer (46, 53 Jahre) insgesamt zwei Regalmeter Archivbestände aus dem Rigsarkivet, dem Kopenhagener Landsarkivet und dem Archiv des Ordenswesen im Schloss Amalienborg gestohlen. Der Raub fiel [...]
Reproduzierbar Wissen schaffen
 Die Bandbreite der Reaktionen macht deutlich, dass sich die einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen (natürlich) nicht über einen Kamm scheren lassen und das Problem der (nicht-)Reproduzierbarkeit von Ergebnissen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Gleichwohl lässt sich der Tenor wahrnehmen, dass das gegenwärtige wissenschaftliche System vor allem spektakuläre und dadurch manchmal auch spekulative Studien durch Veröffentlichung belohnt, während dröge Überprüfungen von Ergebnissen anderer kaum Beachtung in den angesehenen Zeitschriften finden. Veröffentlichungen in namhaften Journals sind aber weiterhin der wichtigste Treibstoff wissenschaftlicher Karrieren. Diese Konstellation verhindert momentan noch eine wissenschaftliche Kultur, in der die Überprüfung anderer Forscher Studien zum täglichen Geschäft gehört.
Abgesehen von diesem allgemeinen Konflikt ergeben sich je nach Gegenstandsbereich spezifischere Probleme, was die Reproduzierbarkeit von Studien bzw. derer Ergebnisse angeht. In der Atom- und der Astrophysik steht es damit offenbar ganz gut, weil die untersuchten Stoffe bzw. beobachteten Weltraumphänomene entweder öffentlich zugänglich oder einfach beschaffbar sind. In der organischen Chemie ist die Reproduktion von Synthesen offensichtlich gang und gäbe, es hapert aber daran, die exakten Bedingungen für Synthesen auf eine nachvollziehbare Art weiterzugeben. Größere Schwierigkeiten machen da Forschungen auf dem Gebieten Psychologie und Medizin, ist doch die Wiederholung von Studien, in denen man viele menschliche Probanden benötigt, mit hohen Kosten verbunden.
Die Strategien, dem Problem nicht-reproduzierbarer Studien zu begegen, weisen in zwei Richtungen: Auf der einen Seite werden Plattformen geschaffen, auf denen wiederholte Studien veröffentlicht werden können. Das engagierteste Projekt in dieser Richtung ist sicherlich die Reproducibility Initiative, die Autoren von Studien quasi ein rundum-Sorglos-Paket anbietet, indem sie die Wiederholung der Experimente durch unabhängige Wissenschaftler organisiert. Das kostet natürlich und wird im gegenwärtigen Umfeld sicherlich noch nicht allzu stark nachgefragt werden. Wenn sich aber die wissenschaftliche Kultur ändern sollte (was sie wohl v.a. durch Druck von außen – hier von den großen Förderinstitutionen – tun dürfte), denke ich, dass einem solchen Modell die Zukunft gehört.
Die andere Stoßrichtung, das Problem in den Griff zu bekommen, ist die Änderung der Veröffentlichungskultur. In Artikeln sind die durchgeführten Experimente und die zugrundeliegenden Daten meist nicht vollständig beschrieben. Solche Artikel würde wohl auch niemand lesen wollen. Es lässt sich aber im besten Fall einrichten, dass man die verwendeten Daten und die eingesetzte Software als Supplemente zu den eigentlichen Artikeln veröffentlicht. Eine solche Kultur der Transparenz würde der Überprüfung, aber auch der Weiterentwicklung der vorgestellten Methoden immens dienen. Sehr interessant ist das Virtual Observatory aus dem Bereich der Astronomie, welches in gleich zwei Artikeln des Bloggewitters thematisiert wird.
Letzteres entspricht auch ungefähr dem Ansatz, den wir im Bereich der Textprozessierung mit unserem Text Engineering Software Laboratory (kurz Tesla) verfolgen. Grob kann man sich dieses virtuelle Labor als Verpackungsmaschine für Experimente vorstellen, die auf textuellen Daten operieren. Mit Texten sind dabei nicht nur natürlichsprachliche gemeint, sondern prinzipiell alles, was sich in Sequenzen diskreter Einheiten darstellen lässt – das gilt mit Einschränkungen ja auch für Proteine und Nucleinsäureketten sowie Partituren von Musikstücken. Der Ansatz ist der, dass wir einen beliebig erweiterbaren Werkzeugkasten anbieten, der als Open Source öffentlich zugänglich ist. Die Werkzeuge sind miteinander kombinierbar, so dass man daraus Workflows zusammenstellen kann, deren Konfiguration mit einer Referenz auf die verwendeten Rohdaten in einer Art virtuellem Laborbuch gespeichert werden. Aus diesem Laborbuch lassen sich einzelne Experimente freigeben und auf Plattformen zum Austausch von Workflows (z.B. MyExperiment) sharen. Sind die Rohdaten verfügbar, so lassen sich die Experimente jederzeit wiederholen, die Konfiguration der einzelnen Werkzeuge, deren Sourcecode und die Art ihrer Zusammenstellung im Workflow sind dabei vollständig transparent.
Die Bandbreite der Reaktionen macht deutlich, dass sich die einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen (natürlich) nicht über einen Kamm scheren lassen und das Problem der (nicht-)Reproduzierbarkeit von Ergebnissen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Gleichwohl lässt sich der Tenor wahrnehmen, dass das gegenwärtige wissenschaftliche System vor allem spektakuläre und dadurch manchmal auch spekulative Studien durch Veröffentlichung belohnt, während dröge Überprüfungen von Ergebnissen anderer kaum Beachtung in den angesehenen Zeitschriften finden. Veröffentlichungen in namhaften Journals sind aber weiterhin der wichtigste Treibstoff wissenschaftlicher Karrieren. Diese Konstellation verhindert momentan noch eine wissenschaftliche Kultur, in der die Überprüfung anderer Forscher Studien zum täglichen Geschäft gehört.
Abgesehen von diesem allgemeinen Konflikt ergeben sich je nach Gegenstandsbereich spezifischere Probleme, was die Reproduzierbarkeit von Studien bzw. derer Ergebnisse angeht. In der Atom- und der Astrophysik steht es damit offenbar ganz gut, weil die untersuchten Stoffe bzw. beobachteten Weltraumphänomene entweder öffentlich zugänglich oder einfach beschaffbar sind. In der organischen Chemie ist die Reproduktion von Synthesen offensichtlich gang und gäbe, es hapert aber daran, die exakten Bedingungen für Synthesen auf eine nachvollziehbare Art weiterzugeben. Größere Schwierigkeiten machen da Forschungen auf dem Gebieten Psychologie und Medizin, ist doch die Wiederholung von Studien, in denen man viele menschliche Probanden benötigt, mit hohen Kosten verbunden.
Die Strategien, dem Problem nicht-reproduzierbarer Studien zu begegen, weisen in zwei Richtungen: Auf der einen Seite werden Plattformen geschaffen, auf denen wiederholte Studien veröffentlicht werden können. Das engagierteste Projekt in dieser Richtung ist sicherlich die Reproducibility Initiative, die Autoren von Studien quasi ein rundum-Sorglos-Paket anbietet, indem sie die Wiederholung der Experimente durch unabhängige Wissenschaftler organisiert. Das kostet natürlich und wird im gegenwärtigen Umfeld sicherlich noch nicht allzu stark nachgefragt werden. Wenn sich aber die wissenschaftliche Kultur ändern sollte (was sie wohl v.a. durch Druck von außen – hier von den großen Förderinstitutionen – tun dürfte), denke ich, dass einem solchen Modell die Zukunft gehört.
Die andere Stoßrichtung, das Problem in den Griff zu bekommen, ist die Änderung der Veröffentlichungskultur. In Artikeln sind die durchgeführten Experimente und die zugrundeliegenden Daten meist nicht vollständig beschrieben. Solche Artikel würde wohl auch niemand lesen wollen. Es lässt sich aber im besten Fall einrichten, dass man die verwendeten Daten und die eingesetzte Software als Supplemente zu den eigentlichen Artikeln veröffentlicht. Eine solche Kultur der Transparenz würde der Überprüfung, aber auch der Weiterentwicklung der vorgestellten Methoden immens dienen. Sehr interessant ist das Virtual Observatory aus dem Bereich der Astronomie, welches in gleich zwei Artikeln des Bloggewitters thematisiert wird.
Letzteres entspricht auch ungefähr dem Ansatz, den wir im Bereich der Textprozessierung mit unserem Text Engineering Software Laboratory (kurz Tesla) verfolgen. Grob kann man sich dieses virtuelle Labor als Verpackungsmaschine für Experimente vorstellen, die auf textuellen Daten operieren. Mit Texten sind dabei nicht nur natürlichsprachliche gemeint, sondern prinzipiell alles, was sich in Sequenzen diskreter Einheiten darstellen lässt – das gilt mit Einschränkungen ja auch für Proteine und Nucleinsäureketten sowie Partituren von Musikstücken. Der Ansatz ist der, dass wir einen beliebig erweiterbaren Werkzeugkasten anbieten, der als Open Source öffentlich zugänglich ist. Die Werkzeuge sind miteinander kombinierbar, so dass man daraus Workflows zusammenstellen kann, deren Konfiguration mit einer Referenz auf die verwendeten Rohdaten in einer Art virtuellem Laborbuch gespeichert werden. Aus diesem Laborbuch lassen sich einzelne Experimente freigeben und auf Plattformen zum Austausch von Workflows (z.B. MyExperiment) sharen. Sind die Rohdaten verfügbar, so lassen sich die Experimente jederzeit wiederholen, die Konfiguration der einzelnen Werkzeuge, deren Sourcecode und die Art ihrer Zusammenstellung im Workflow sind dabei vollständig transparent.
 Der Workflow-Editor von Tesla. Zu sehen ist die Kombination von Werkzeugen (Kästen) durch Verbindung der Ein-/Ausgabeschnittstellen.
Wir haben uns darum bemüht, die Benutzung des Werkzeugkastens/der Experimentverpackungsmaschine möglichst eingängig zu modellieren, weil wir damit die Hoffnung verbinden, dass sich möglichst viele Nutzer auf das System einlassen, einzelne Werkzeuge evaluieren und eventuell sogar neue erstellen. Die Weitergabe kompletter Experimente kann nämlich nicht nur dazu genutzt werden, um anderer Forscher Studien zu wiederholen, sondern im Idealfall auch, direkt auf diesen aufzusetzen oder durch Modifikationen (durch Austausch oder Rekonfiguration der Werkzeuge oder die Anwendung auf eine andere Datenbasis) zu besseren Ergebnissen zu kommen. Auch wenn wir noch viel Arbeit vor uns haben, was die noch einfachere Benutzbarkeit und die verbesserte Ausstattung von Tesla angeht, sind die Rückmeldungen der ersten Anwender von Tesla außerhalb unseres Lehrstuhls sehr positiv, so dass wir glauben, dass derartige Systeme in Zukunft stärker genutzt werden und die Möglichkeiten des wissenschaftlichen Austauschs sowie der Überprüfbarkeit von Studienergebnissen erweitern.
Der Workflow-Editor von Tesla. Zu sehen ist die Kombination von Werkzeugen (Kästen) durch Verbindung der Ein-/Ausgabeschnittstellen.
Wir haben uns darum bemüht, die Benutzung des Werkzeugkastens/der Experimentverpackungsmaschine möglichst eingängig zu modellieren, weil wir damit die Hoffnung verbinden, dass sich möglichst viele Nutzer auf das System einlassen, einzelne Werkzeuge evaluieren und eventuell sogar neue erstellen. Die Weitergabe kompletter Experimente kann nämlich nicht nur dazu genutzt werden, um anderer Forscher Studien zu wiederholen, sondern im Idealfall auch, direkt auf diesen aufzusetzen oder durch Modifikationen (durch Austausch oder Rekonfiguration der Werkzeuge oder die Anwendung auf eine andere Datenbasis) zu besseren Ergebnissen zu kommen. Auch wenn wir noch viel Arbeit vor uns haben, was die noch einfachere Benutzbarkeit und die verbesserte Ausstattung von Tesla angeht, sind die Rückmeldungen der ersten Anwender von Tesla außerhalb unseres Lehrstuhls sehr positiv, so dass wir glauben, dass derartige Systeme in Zukunft stärker genutzt werden und die Möglichkeiten des wissenschaftlichen Austauschs sowie der Überprüfbarkeit von Studienergebnissen erweitern.
Statement: Thomas Stäcker – „Eine Bibliothek aus Texten weben“
Die neue alte Rolle der Bibliothek als Ort des Sammelns, Erschließens und Vermittelns von wissenschaftlicher Literatur im digitalen Zeitalter
»The Invention of Printing , though ingenious, compared with the invention of Letters, is no great matter«. Diese für manchen vielleicht überraschende Feststellung, die Hobbes in seinem Leviathan trifft, lässt die grundsätzliche Ebene der Schriftlichkeit gegenüber ihrem Träger, dem Buch, aufscheinen und relativiert zugleich die Bedeutung des letzteren in einer gleichsam phylogenetischen Perspektive. Bibliotheken wiederum, wie der große niederländische Gelehrte Justus Lipisus schreibt: »… sind eine alte Einrichtung und wurden, wenn ich mich nicht täusche, zusammen mit der Schrift erfunden.“

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Augusteerhalle
(Foto: Friedrichsen | CC BY-SA 3.0)
Der enge Zusammenhang von Wissen, Schreiben und Bibliothek, so die These, löst sich auch in Zeiten des Internet nicht. Mit Lipsius gesprochen, kann das Wissen nicht mit Gewinn genutzt werden, wenn es nicht irgendwo aufbewahrt und bereitgestellt wird. Auch das elektronische Buch macht da keine Ausnahme, und es ist eine leichtfertige, ja gefährliche Vorstellung, dass das Internet gleichsam von selbst für die Kultur- und Wissenstradition und – sicherung sorgte. Bibliotheken und Archive behalten daher auch in Zeiten ubiquitärer digitaler Verfügbarkeit die Verantwortung für die Archivierung des Geschriebenen. Bibliotheken müssen sich jedoch im digitalen Zeitalter darauf einstellen, dass sich grundlegende Kulturtechniken, wie das Schreiben und Lesen, ändern und damit auch die traditionellen Formen des Sammelns, Erschließens und Zugänglichmachens. Überkomme und eingespielte Verhältnisse der Wissensproduktion und Aufgabenverteilungen müssen überdacht werden. Z.B. ist es in Zeiten des beliebig vervielfältigbaren Textes mittelfristig nicht mehr sinnvoll, wissenschaftliche Texte über ein gegenüber neuen „Lesetechniken“ wie maschine reading oder Anforderungen des semantic web weitgehend hermetisches Verlagssystem zu publizieren. Voraussetzung für Änderungen ist hier, dass es gelingt, die wissenschaftlichen Qualitätssicherungs- und Distributionssysteme neu auszurichten und dass Universitäten und Autoren die Kontrolle über ihre wissenschaftlichen Publikationen wieder stärker selbst in die Hand nehmen.
Bibliotheken sind Orte, an denen das Geschriebene, sei es analog oder elektronisch, zuverlässig als ein öffentliches, allen gemeinsames Gut für die Nachwelt gesichert wird, wo, unbeeinträchtigt von kommerziellen Interessen der freie Zugang über eigene Suchsysteme gewährleistet ist und wo in qualitativer Auswahl erworben wird. Allerdings sind Bücher nicht länger nur mehr materielle Gegenstände, die in Magazinen aufbewahrt werden, sondern in elektronischer Form miteinander semantisch vernetzte, an jedem Ort der Welt verfügbare, eben maschinenlesbare Texte, denen immer weniger ein end-user, sondern, wie McCarty es formulierte, ein end-maker gegenübersteht. Dieserart gewobene Texte bilden perspektivisch eine neue, eine digitale Bibliothek, die der analogen zur Seite tritt.
Dr. Thomas Stäcker ist Leiter der Abteilung „Neuere Medien, Digitale Bibliotheken“ und seit 2009 Stellvertretender Direktor der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei unter anderem in der Akquise und Betreuung von Digitalisierungs- und Erschließungsprojekten. Er studierte Philosophie, Latinistik und deutsche Literaturwissenschaft und promovierte 1994 am Fachbereich Kultur- und Geowissenschaften der Universität Osnabrück.
Quelle: http://gid.hypotheses.org/304
Die Zeit der Wahrheit
Als letzten Denkanstoß vor der RKB-Tagung bringt Michael Sonnabend hier sein Statement – und damit die Gelegenheit, sich schon einmal warmzudiskutieren, entweder im stillen Selbstgespräch oder in den Kommentaren.
Irgendwann werden sie anklopfen. Und Fragen stellen. Freundlich zwar, aber hartnäckig. Sie werden nach dem Sinn fragen, aber auch nach dem Zweck. Die Anderen. Die, die bisher still waren. Diejenigen, die immer glauben, sie seien nicht wichtig genug, um Fragen stellen zu dürfen. Diejenigen, die sich gar nicht getraut haben, misstrauisch zu sein. Weil sie nicht dazugehören.
Das wird die Zeit der Wahrheit. In der alles ans Licht kommt. Wo sich niemand mehr verstecken kann, hinter den dicken Mauern der Alma Mater. Hinter den dicken Panzern der Sprache. Dann werden die Anderen wissen wollen, was wirklich verhandelt wird im Namen der Wissenschaft. Wohl jenen, die dann erklären können, worin der gesellschaftliche Wert dessen liegt, womit sie sich tagtäglich beschäftigen.
Viele in der Wissenschaft halten diese Vorstellung sicherlich für eine Zumutung. Warum Wissenschaft für die Gesellschaft wichtig sei, liege doch klar auf der Hand. Es sei doch gesellschaftlicher Konsens, dass Wissenschaft und Forschung die Gesellschaft voranbringe. Ich wage das zu bezweifeln, zumindest was den Konsens betrifft. Und das liegt an der Wissenschaft selbst. Weil sie immer noch nicht angemessen kommuniziert. Weil sie sich immer nur die Fragen stellt, die sich aus ihr selbst heraus ergeben. Aber sich selten die Fragen anhört, die die Anderen sich stellen mögen.
Das hat viel mit Sprache zu tun. Mit dem offen zur Schau getragenen Unwillen, sich klar und deutlich – vielleicht sogar elegant – auszudrücken. Statt dessen flüchtet man sich lieber ins Unterholz der Passivkonstruktionen, erschlägt den Geist harmloser Mitmenschen mit dem rücksichtslosen Gebrauch von Substantiven und nicht enden wollenden Sätzen. Die Sprache der Wissenschaft ist darauf angelegt, nur von jenen verstanden zu werden, die zu den Eingeweihten gehören. Die Anderen werden sprachlich in die Flucht geschlagen. Wie zur Einschüchterung bläht sich die Sprache der Wissenschaft unentwegt auf.
Sie ist eine Form der Vorwärtsverteidigung. Verbunden mit der Hoffnung, dass niemand nachfragt, wenn es nur hübsch klug klingt. Aber schon Dürrenmatt wusste: „Die Arbeit an der Sprache ist Arbeit am Gedanken.“ In meiner täglichen Arbeit bekomme ich oft genug den Eindruck, dass es mit den „Gedanken“ nicht allzu weit her ist. Nicht selten habe ich es mit Texten zu tun, in denen Allerweltsweisheiten und Selbstverständlichkeiten zum hochwissenschaftlichen Paper mit der entsprechenden Terminologie hochgejazzt werden.
Wir haben es also mit Distinktion und Nebelkerzen zu tun. Man will unter sich bleiben und die Anderen schickt man in den Dunst. Das ist lange gut gegangen, aber mit der wachsenden Vorherrschaft des Internets werden sich die Nebel bald lichten. Dann wird so manches sichtbar werden, was in vergangenen Jahrhunderten zwischen zwei Buchdeckeln dem Vergessen anheimgefallen wäre.
Ich bin mir nicht so sicher, ob wissenschaftliche Sprache – insbesondere die der Geisteswissenschaften – durch das Internet wirklich besser werden wird. Schließlich gibt es auch im Netz genug abgelegene Ecken, in die sich kaum jemand verirrt. Aber das Internet bietet Chancen für diejenigen, die sich nicht ausschließlich in Geheim-Gesellschaften wohlfühlen: Nämlich wahrgenommen zu werden, ins Gespräch zu kommen, einen Platz in der Gesellschaft einzunehmen, den niemand mehr so ohne Weiteres in Zweifel ziehen kann. Wer das will, muss lernen, klar und deutlich zu sprechen. Dessen Tür werden sie dann vielleicht auslassen, wenn sie kommen und anklopfen.
Disclaimer: Ich weiß, es gibt nicht „die Wissenschaft“ oder „die Wissenschaftler“. Hier wäre eine Differenzierung notwendig, die ein Blogposting sicher nicht leisten kann. Es ist also die Einbildungskraft des Lesers und der Leserin gefragt, das allzu große Gefäß der Begrifflichkeiten mit je eigenen Vorstellungen und Erfahrungen zu füllen.
Quelle: http://rkb.hypotheses.org/392
Wer war Joachim von Sandrart?
Wer war Joachim von Sandrart? Nein, er war kein berühmter Söldnerführer und auch kein Geheimer Rat, der sich auf diplomatischem Parkett in diesem Konflikt engagiert hat. Und doch hat er in der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs seinen festen Platz; allerdings taucht er erst ganz am Ende dieses Konflikts auf. Denn nach dem Abschluß der Verhandlungen in Münster und Osnabrück begann 1649 in Nürnberg der sogenannte Exekutionstag, auf dem für die vielen noch offenen Probleme Lösungen gesucht wurden, vor allem für das Problem der Abdankung der Truppen. Eine wichtige Etappe zur Beantwortung solcher Fragen stellte der Interimsrezeß zwischen den Schweden und dem Kaiser vom 21. September 1649 dar. Zur Feier dieses Abkommens wurde ein feierliches Bankett ausgerichtet, das zwei Wochen später stattfand. Als Nürnberger Friedensmahl vom 5. Oktober ging es in die Geschichte ein und symbolisierte den erfolgreichen Abschluß dieser Verhandlungen. Sandrart erhielt damals den Auftrag, das Nürnberger Friedensmahl in einem repräsentativen Gemälde abzubilden, das ähnlich wie Gerard ter Borchs Gemälde des Friedens zu Münster zwischen Spanien und den Generalstaaten vor allem die an den Verhandlungen Beteiligten zeigt. Das „Friedensmahl“, riesenhaft in seinen Ausmaßen (290 x 445 cm), stellt eine der Ikonen des Friedensschlusses dar, für dessen zeitgenössische Breitenwirkung vor allem einige Kupferstiche sorgten.
Die Darstellung des Friedensmahls von 1649 ist sicherlich das bekannteste Gemälde Sandrarts und zweifelsohne dasjenige, das auch unter Nur-Historikern am besten bekannt sein dürfte. Dabei lohnt es durchaus, den Blick zu weiten und die insgesamt beeindruckende Lebensleistung des Künstlers wahrzunehmen. Dies ist jüngst in zweifacher Hinsicht sehr erleichtert worden. Zum einen ist seit einiger Zeit die kommentierte Online-Edition der „Teutschen Akademie“ verfügbar, ein monumentales Werk in drei Bänden, in dem Sandrart das kunsthistorische Wissen seiner Zeit vorstellt. Dem zuerst in deutscher Sprache erschienenen Werk folgte bald eine lateinische Ausgabe; beide sind hier verfügbar und durch verschiedene Indices mustergültig erschlossen. Zum anderen präsentiert die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel eine Ausstellung, die Sandrarts Biographie nachzeichnet, aber vor allem auch Einblicke in seine kunsttheoretischen Auffassungen bietet. Die Ausstellung kann nur noch bis zum 24. Februar 2013 besucht werden; danach wird man auf den Katalog „Unter Minervas Schutz“ zurückgreifen müssen.
Natürlich braucht man sich nicht weiter um Sandrart zu kümmern, wenn man einfach nur verstehen will, welcher Stellenwert der itio in partes im Rahmen des Westfälischen Friedenswerkes zukam oder wie man die Truppenmassen nach Ende der Kriegshandlungen loswurde. Aber eine solche Engstirnigkeit wird sich heute kaum jemand leisten können. Und selbst wenn man keine große Neigung zu kunsthistorischen Themen verspüren sollte, dient es in jedem Fall der Erweiterung des eigenen Horizonts, wenn man sich die Tatsache vergegenwärtigt, daß das berühmte Gemälde über das Nürnberger Friedensmahl eben nicht von irgendeinem Maler angefertigt wurde. Vielmehr handelt es sich bei Sandrart um einen der erfolgreichsten Künstler seiner Zeit und zudem um eine intellektuelle Zelebrität, deren Einfluß man nur schwer überschätzen kann. Als wichtig erscheint mir auch, zu sehen, daß Sandrarts Wirken weit in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts reichte. Er stellte also eine der Persönlichkeiten dar, die von den Erfahrungen des Kriegs geprägt waren, aber an der Gestaltung der Nachkriegszeit lebhaften Anteil hatten.
Das Nürnberger Friedensmahl ist, wie gesagt, unter Historikern gut bekannt. Erläuterungen und gute Reproduktionen des Gemäldes sowie der Kupferstiche finden sich etwa im Katalog „Von teutscher Not zu höfischer Pracht 1648-1701“, S. 26-32, sowie im Ausstellungskatalog „1648. Krieg und Frieden in Europa“, S. 419 f.
Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/84
Fundstück
L’holocauste, la Suisse, et l’historien
A l'occasion de la Journée en mémoire des victimes de l'Holocauste du 27 janvier 2013, le Président de la Confédération Ueli Maurer a prononcé un message qui évoque l'attitude de la Suisse pendant la seconde guerre mondiale en ces termes:
WeiterlesenL’holocauste, la Suisse, et l’historien
A l'occasion de la Journée en mémoire des victimes de l'Holocauste du 27 janvier 2013, le Président de la Confédération Ueli Maurer a prononcé un message qui évoque l'attitude de la Suisse pendant la seconde guerre mondiale en ces termes:
Linkdossier (2): Kathedralen des Wissens – Bibliotheken im Internetzeitalter
Interessante Ansätze, wie mit Bibliotheken in Zukunft umgegangen werden kann, bietet unsere zweite Ausgabe des Linksdossiers. Dieses Mal gibt es nicht immer ernst gemeinte Vorschläge, wie eine Bibliothek zu organisieren ist. Über weitere erheiternde Vorschläge für die Bibliotheken der Zukunft sind wir wie immer dankbar.
Wie man eine öffentliche Bibliothek organisiert
Ein über 20 Jahre alter Text, der noch heute funktioniert und zu einem Klassiker geworden ist. Umberto Eco darüber, wie eine öffentliche Bibliothek zu organisieren ist:
“1. Die Kataloge müssen so weit wie möglich aufgeteilt sein; es muß sehr viel Sorgfalt
darauf verwandt werden, den Katalog der Bücher von dem der Zeitschriften zu trennen
und den der Zeitschriften vom Schlagwort- oder Sachkatalog, desgleichen den Katalog
der neuerworbenen Bücher von dem der älteren Bestände. Nach Möglichkeit sollte die
Orthographie in den beiden Bücherkatalogen (Neuerwerbungen und alter Bestand)
verschieden sein: beispielsweise Begriffe wie “Code” in dem einen mit C, in dem anderen
mit K oder Namen wie Tschaikowski bei Neuerwerbungen mit einem C, bei den anderen
mal mit Ch, mal mit Tch.”
“Bibliothekslatein” oder Umberto Eco 2.0
Auf Eco aufbauend hat Dr. Oliver Obst in seinem Blog die Regeln ins Internetzeitalter verschoben:
“1.
Der Bibliothekar muß den Benutzer als dumm betrachten, informationsinkompetent, RSS-unwissend, ein Nichtstuer (andernfalls säße er an der Arbeit) und YouTube-Süchtiger.”
Auf ins Lesefreudenhaus
In der Zeit berichtet Pia Volk darüber, dass die Menschen nicht mehr in die Bibliotheken kommen, weil sie Bücher brauchen:
»Die Menschen kommen zu uns, um sich den Kopf wieder frei zu machen«, sagt Bürger. Was paradox klingt.
Bibflirt.de
Bibliotheken dienen nicht immer nur der Wissens-, sondern manchmal auch der Partnervermittlung. Auf Bibflirt.de können ganz Schüchterne anonym ihr Herz zum Beispiel so ausschütten:
“An den Zuckerjungen von der Ausleihe, der uns Mädchen in senem himmelblauen Hoodie verzaubert! Wir wollen, dass du weißt, dass dein verträumtes Lächeln der einzige Grund für uns ist, Tag für Tag die Bibliothek zu betreten! Danke <3″
Library turns to pole dancing to entice new readers
Auch eine Möglichkeit, potentielle Leser*innen anzusprechen: die Bibliothek einfach Zweck entfremden, das soll laut Guardian in Schottland passieren. Am 2. Februar, dem “Love Your Library Day”, wird die Bibliothek in eine Poledance-Klasse verwandelt. Daneben soll mit Büchern statt mit Schlägern Tischtennis gespielt werden. Die Motivation dahinter:
“Love Your Library Day is a marvellous opportunity for us all to celebrate the hugely important role libraries play in the heart of our local community.”
Quelle: http://gid.hypotheses.org/268
Schlaglichter auf die Geschichte, Band 3
So findet sich im Buch eine Einführung in die Parteien der Weimarer Republik neben einer Geschichte der französischen Republiken zwischen Französischer Revolution und Zweitem Weltkrieg, enthält das Buch eine Abhandlung über die Außenpolitik der Bonner Republik und eine detaillierte Analyse der Deutschen Einheit. Besondere Schmankerl in diesem Band sind eine komplette Geschichte des Supreme Court und ein kontrafaktisches Szenario, das die möglichen Auswirkungen eines deutschen Siegs im Ersten Weltkrieg darstellt.
Zusätzlich zu diesen allgemeinen Themen, die eine komplette Epoche beschreiben und deren Relevanz anhand einer spezifischen Problemstellung greifen, befassen sich andere Artikel mit sehr speziellen Themen. Beispiele für solche Themen sind etwa zeitgenössiche Debatten zu historischen Themen wie die Frage, ob "Mein Kampf" neu aufgelegt werden sollte oder ob Nazi-Vergleiche gemacht werden sollten. In einem Überblicksartikel werden die amerikanischen Präsidenten zusammen mit den Animaniacs erklärt, und ein Essay widmet sich der Frage, ob das Ende der amerikanischen Ureinwohner Völkermord war.
Für „Schlaglichter auf die Geschichte“ wurden die verwendeten Artikel noch einmal grundlegend überarbeitet. Jeder Band dieser Reihe enthält eine Auswahl von Artikeln zu den verschiedensten Themen.
Die Problemorientierung der Artikel und ihre prägnante Kürze ermöglicht dem historisch interessierten Publikum einen schnellen Einstieg ins Thema, die Aktualität des Forschungsstands und die pointierten Thesen regen das Nachdenken und Reflektieren an und heben „Schlaglichter auf die Geschichte“ damit von anderen Geschichtsüberblicken ab. In diesem Band finden Sie:
- Das Parteiensystem der Weimarer Republik
- Die SPD im Wahlkampf 1972
- Zur Steinbach-Debatte
- Die Geschichte des "Supreme Court of the United States”
- Die rechtlichen Grundlagen des Prinzipats
- Die Außenpolitik der Bonner Republik
- Zur Debatte um die Wiederauflage von „Mein Kampf“
- Drei Sätze, die die Welt veränderten
- Der Versailler Vertrag
- Der internationale Nazi-Vergleich und seine Helfershelfer
- Die amerikanischen Präsidenten…mit den Animaniacs
- Gurkentruppe in Lack und Leder
- Von der Ersten zur Dritten Republik
- Die DDR – ein Staat auf Abruf
- Weihnachten wieder zu Hause? Ein kontrafaktisches Szenario
- War das Ende der amerikanischen Ureinwohner Völkermord?
- Der 9. November – ein deutscher Tag in einem deutschen Jahrhundert
- Die deutsche Einheit
- Vom Elend des deutschen Geschichtsfernsehens
- War im Geschichts-Fernsehen früher alles besser?
Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2013/01/schlaglichter-auf-die-geschichte-band-3.html