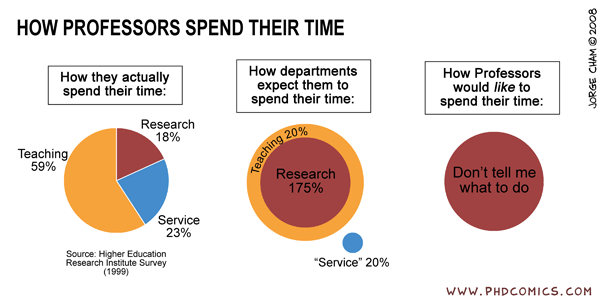Die katholischen Kirchen der Stadt Linz beherbergen mit dem Marienaltar und dem Gnadenstuhl zwei bedeutende spätgotische Altäre. Beide wurden ursprünglich für die 1462 geweihte und 1818 abgebrochene Ratskapelle auf dem Marktplatz gestiftet. Nach deren Abriss kam der Marienalter in die Martinskirche und diente dort mit Unterbrechungen bis 1953 als Hochaltar. Seit 1967 ist das Triptychon Hauptaltar der Linzer Marienkirche. Nach einer umfassenden Restaurierung vor einigen Jahren erstrahlt er heute wieder in leuchtenden Farben.
Das Programm des Retabels ist nicht eindeutig, da es weder die Bildfolge eines Marienlebensaltars noch die eines Altars der Sieben Freuden Mariä genau trifft, weshalb es allgemein als Marienaltar bezeichnet wird. Bei geschlossenen Flügeln ist links eine Verkündigung Mariä zu sehen; über der Fensterarkade findet sich die Jahreszahl 1463, das Fertigstellungsdatum des Altars.
Geöffnet zeigt das Triptychon auf dem linken Innenflügel eine Verkündigungsszene, bei der Maria in der Kleidung einer Magd ein aufgeschlagenes Buch auf dem Schoß hält. Auf der Mitteltafel sind oben in einer herrschaftlichen Rundbogenarchitektur die Geburt Christi und die Anbetung der Heiligen Drei Könige zu sehen, unten die Darbringung im Tempel sowie die ungewöhnliche Darstellung des auferstandenen Jesus, der mit Maria auf einem Thron sitzt, umgeben von singenden und musizierenden Engeln.
Der rechte Innenflügel zeigt auf ungeteiltem Goldgrund unten die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten und darüber eine trinitarische Marienkrönung. Maler des Marienaltars wie auch des Gnadenstuhls ist der so genannte Meister der Lyversberg-Passion, der um 1460 in Köln auftrat. Die beiden Linzer Altäre sind die ersten großen Werke dieses Künstlers und in der langen kölnischen Maltradition verwurzelt.
Als Stifter des Marienaltars gilt allgemein der Auftraggeber des Gnadenstuhls, Propst Tilmann Joel von Linz. Wilfried Podlech stellte dies jedoch nach der Restaurierung des Altars aus mehreren Gründen in Zweifel: Die Stifterfigur auf dem Marienaltar zeigt im Gegensatz zu der auf dem Gnadenstuhl einen jüngeren Mann.
Da beide Werke jedoch nahezu zeitgleich entstanden sind, kann es sich somit nicht um ein und dieselbe Person handeln, zumal es ungewöhnlich erscheint, dass ein Stifter zwei große Altarwerke gleichzeitig in Auftrag gibt. Gestützt wird diese Vermutung dadurch, dass zwar beide Werke das von Tillmann Joel verwendete Rosenwappen zeigen, jedoch auf dem Gnadenstuhl mit einer goldenen und auf dem Marienaltar mit einer roten Rose. Das Marienretabel wurde zudem erst zwei Jahre nach dem Tod Tillmann Joels vollendet, die Stifterfigur ist jedoch als lebende Person gekennzeichnet.
Aus diesen Indizien schloss Podlech, dass nicht Tillmann Joel, sondern sein Neffe Johannes Ruysch, ein Sohn seiner Schwester Lucia, der Stifter des Marienaltars ist. Johannes Ruysch diente ebenso wie sein Onkel und sein älterer Bruder Jakob als kurkölnischer Kanzler und wird in den Quellen als Rektor der Linzer Pfarrkirche genannt. Marienaltar und Gnadenstuhl wären somit als Familienstiftung zweier bedeutender Söhne der Stadt Linz zu sehen.