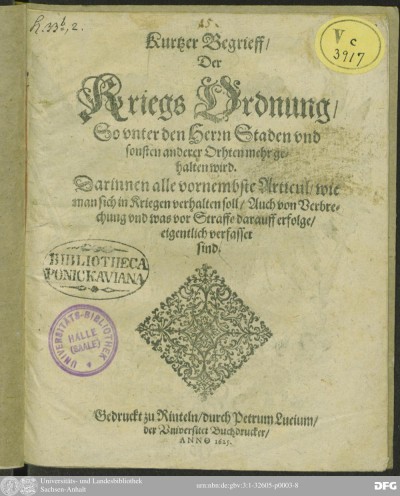Bekanntermaßen ist das Hantieren mit Zahlangaben in der Geschichte eine tückische Sache. Zahlen suggerieren auf den ersten Blick konkrete Anschaulichkeit. Doch wer will schon alle überlieferten Zahlen glauben? Stets haben historische Akteure und ihre Chronisten versucht, Zahlen zu manipulieren. Gerade im militärischen Bereich ist dies der Fall, so daß mittlerweile Quellen, die Zahlangaben präsentieren, schnell unter den Generalverdacht der Verfälschung geraten. Dies gilt beispielsweise für astronomische Angaben über gegnerische Verluste und komplementär dazu lächerlich geringe Zahlen für die eigenen. Zahlen waren und sind oft genug einfach Propaganda pur.
Im Folgenden soll es nun nicht um derartige Manipulationen gehen, sondern ganz allgemein um Angaben über Truppenstärken. Wie stark war eigentlich eine Armee, die gerade den Winter überstanden hatte?
[...]
Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/794