 Gemälde sind statische Gegenstände und als Betrachter können wir sie über einen längeren Zeitraum studieren, den Blick darin schweifen lassen oder Objekte fixieren.
Gemälde sind statische Gegenstände und als Betrachter können wir sie über einen längeren Zeitraum studieren, den Blick darin schweifen lassen oder Objekte fixieren.
Schauen wir für einen längeren Zeitraum auf einen gleichmäßigen Farbfleck, kann dieser sich in unserer Wahrnehmung verändern und erscheint weniger gesättigt. Vertiefen wir uns in Linienzeichnung, erhält diese bei intensiver Betrachtung neue Aspekte. Ebenfalls tritt dieser Effekt bei der Betrachtung von vielschichtigen Formen auf. Daraus kann man schließen, dass Kunstbetrachtung im Betrachter psychologische und dynamische Prozesse auslöst.

In dem Artikel Das Psychologische in der Kunst: Über Spannung und Entspannung beim Kunsterlebnis habe ich bereits über die Spannung, die Kunstwerke vermitteln, berichtet. Ich möchte wissen, ob eine solche Spannung bei ARTigo-Spielern feststellbar ist. In der obigen Darstellung, die die These von Kreitler & Kreitler verdeutlichen soll, habe ich den für mich relevanten Anteil an Spannung mit einer grünen Ellipse gekennzeichnet. Den Grad dieser Spannung möchte ich ermitteln.
Die These von Kreitler & Kreitler besagt, dass ein Kunstwerk Spannung (grün) vermittelt, was dann dazu beiträgt, dass eine im Betrachter bereits bestehende Spannung (rot) ihre Auflösung findet, was von einem Lustempfinden begleitet ist.
Die Farbtags der Kategorie Landschaft
Bei der Betrachtung der Auswertungen für Landschaftsbilder fällt auf, dass der Anteil der Gelb-, Orange- und Rot-Tags in impressionistischen Bildern höher liegt als in Bildern des Klassizismus. Gleichzeitig ist der Wert für die braunen Farbtags für den Impressionismus deutlich niedriger. Das dürfte daran liegen, dass die impressionistische Malweise weitestgehend auf Zwischentöne verzichtet, was zur Steigerung der Spannung durch Farbe beiträgt. Der Anteil der braunen Farbtags, der zur Vermittlung zwischen Farbkontrasten den Ausgleich in diesen Farbtönen sucht, wurde weniger häufig getaggt als bei den Bildern des Klassizismus.
Die Farbtags der Kategorie Porträt
Auch die Porträts der Impressionisten haben mehr Farbtags als die Porträts der Klassizisten. Im Gegensatz dazu ist aber die Differenz der Tags aus dem Beige-Braun-Ocker-Bereich bei weitem nicht so groß wie bei den Landschaftsbildern. Meine Erklärung hierfür wäre, dass Porträts insgesamt näher an der Realität orientiert sind als Landschaftsbilder und dass dafür mehr ausgleichende Farbtöne von den Malern verwendet wurden, deren Vorkommen dann mit den entsprechenden Farbtags aus dem Braun-Bereich getaggt wurden.

 Die abschließende Auswertung (siehe unten) zeigt den prozentualen Anteil der Farbtags an der Gesamtmenge der Tags für die Bilder eines Künstlers oder einer Gattung bzw. Epoche. Den größten Anteil Farbtags haben die Bilder von Giovanni Giacometti, bei den Bildern Alfred Sisleys ist der Anteil mit 10% am niedrigsten. Schaue ich mir beide Maler in ARTigo an, so komme ich zu dem Schluss, dass im Allgemeinen die Farben der Bilder Giacomettis stark gesättigt sind, die Farben bei Sisley dagegen weit weniger, d.h. er mischte ihnen häufig Weiß bei.
Die abschließende Auswertung (siehe unten) zeigt den prozentualen Anteil der Farbtags an der Gesamtmenge der Tags für die Bilder eines Künstlers oder einer Gattung bzw. Epoche. Den größten Anteil Farbtags haben die Bilder von Giovanni Giacometti, bei den Bildern Alfred Sisleys ist der Anteil mit 10% am niedrigsten. Schaue ich mir beide Maler in ARTigo an, so komme ich zu dem Schluss, dass im Allgemeinen die Farben der Bilder Giacomettis stark gesättigt sind, die Farben bei Sisley dagegen weit weniger, d.h. er mischte ihnen häufig Weiß bei.
Sättigung ist ein Faktor, der Spannung erhöht
„Sättigung der Farben ist ein Faktor, der die Spannungen einer spannungsgeladenen Farbkombination verstärkt, gleichgültig ob es sich bei den aufeinanderprallenden Farben um komplementäre oder höchst ähnliche Töne handelt. Akzeptieren wir die wahrscheinliche Annahme, dass Sättigung psychologisch mit der Intensität der Farbreize gleichzusetzen ist, so erhalten diese Ergebnisse eine große Bedeutung.“ (Kreitler, S. 54)
Die ARTigo-Spieler versehen Bilder mit gesättigten Farben mit mehr Farbtags. Daher würde ich folgern, dass die durch die gesättigten Farbtöne vermittelte Spannung von den Spielern aufgegriffen wurde und sich im vermehrten Taggen von Farbe ausdrückt.
 Außerdem zeigt die Grafik, dass impressionistische Bilder der Gattungen Porträt und Landschaft deutlich mehr Farbtags erhalten haben, als Bilder dieser Gattungen aus der Epoche des Klassizismus. So beträgt der Anteil der Farbtags bei den impressionistischen Porträts 12,7 %, bei klassizistischen Porträts 9,9%. Die Differenz zwischen den Epochen beträgt bei den Porträts 2,8%. Die impressionistischen Landschaftsbilder haben 12,9% Farbtags, die klassizistischen Landschaftsbilder 8.1%. Das macht einen Unterschied von 4,5% zwischen den Epochen dieser Gattung.
Außerdem zeigt die Grafik, dass impressionistische Bilder der Gattungen Porträt und Landschaft deutlich mehr Farbtags erhalten haben, als Bilder dieser Gattungen aus der Epoche des Klassizismus. So beträgt der Anteil der Farbtags bei den impressionistischen Porträts 12,7 %, bei klassizistischen Porträts 9,9%. Die Differenz zwischen den Epochen beträgt bei den Porträts 2,8%. Die impressionistischen Landschaftsbilder haben 12,9% Farbtags, die klassizistischen Landschaftsbilder 8.1%. Das macht einen Unterschied von 4,5% zwischen den Epochen dieser Gattung.
„So ist es beispielsweise zu erwarten, daß Gemälde, die bekannte, gewohnte Szenen oder Gegenstände auf herkömmliche Weise darstellen, die Reaktionen auf Farben derart beschränken, daß sie den Assoziationen entsprechen, welche durch die wahrgenommenen Inhalte hervorgerufen werden.“ (Kreitler, S. 83)
Aus der Sicht von ARTigo kann ich diese Annahme bestätigen, denn Bilder aus dem Klassizismus – eine Epoche in der Farben in der „herkömmlichen Weise“ verwendet wurden, erhalten deutlich weniger Farbtags als Bilder aus dem Impressionismus. Impressionistische Bilder vermitteln mehr Spannung, weil in ihnen auf ausgleichende Farbtöne verzichtet wurde und Farbe hier in einer den Sehgewohnheiten heute noch widersprechenden Art und Weise verwendet wird. Zwar sorgen die Bilder nicht mehr wie zu ihrer Entstehungszeit für Skandale. Allerdings ist auch heute noch eine Farbwirkung, die Spannung im Betrachter hervorruft, feststellbar. Dies zeigt der erhöhte Anteil der Farbtags bei den impressionistischen Bildern im Vergleich zu Bildern aus dem Klassizismus.
Die Auswertung der Farbtags ist ein Versuch, die von Bildern erzeugte Spannung erstmals mittels eines quantitativen Ansatzes darzustellen.
Weitere Artikel zum Thema
Die Farbtags des Kunstgeschichtsspiels ARTigo unter der Lupe
Wie ARTigo-Spieler Farbe taggen: Eine abstrakte Betrachtung der Farbtags
Das Psychologische in der Kunst: Über Spannung und Entspannung beim Kunsterlebnis
Literatur:
Hans Kreitler und Shulamit Kreitler: Psychologie der Kunst, 1980
Bild: Honoré Daumier, Triste contenance de la sculpture placée au milieu de la peinture…, 1857, Paris, Bibliothèque Nationale des Arts décoratifs
Digitale Bildquelle: www.artigo.org
Quelle: http://games.hypotheses.org/1779


 Wer das Wort “Wirklichkeit” in einer kulturwissenschaftlichen Debatte verwendet, ist stets darum bemüht, Anführungszeichen zumindest anzudeuten, um sich nicht verdächtig zu machen, mit einem naiven Realitätsbegriff zu hantieren. Helmut Lethen, Direktor des IFK, ist diese Diskussion inzwischen leid, weshalb er sein Buch “Der Schatten des Fotografen” der Frage widmet, in welchem Verhältnis Bilder und Fotografien zur Wirklichkeit stehen. Im Gespräch folgen wir n
Wer das Wort “Wirklichkeit” in einer kulturwissenschaftlichen Debatte verwendet, ist stets darum bemüht, Anführungszeichen zumindest anzudeuten, um sich nicht verdächtig zu machen, mit einem naiven Realitätsbegriff zu hantieren. Helmut Lethen, Direktor des IFK, ist diese Diskussion inzwischen leid, weshalb er sein Buch “Der Schatten des Fotografen” der Frage widmet, in welchem Verhältnis Bilder und Fotografien zur Wirklichkeit stehen. Im Gespräch folgen wir n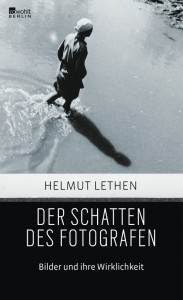 icht nur einigen Beispielen und theoretischen Bezügen, die im Buch besprochen werden – wie zum Beispiel die scheinbar idyllische Szene auf dem Coverfoto –, sondern reden auch über die Entstehung und den Schreibprozess. Für das Buch erhielt Helmut Lethen 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik. Unterstützt werde ich in dieser Episode von dem Philosophen Jakob Moser.
icht nur einigen Beispielen und theoretischen Bezügen, die im Buch besprochen werden – wie zum Beispiel die scheinbar idyllische Szene auf dem Coverfoto –, sondern reden auch über die Entstehung und den Schreibprozess. Für das Buch erhielt Helmut Lethen 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik. Unterstützt werde ich in dieser Episode von dem Philosophen Jakob Moser.


