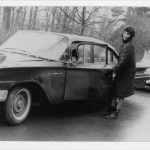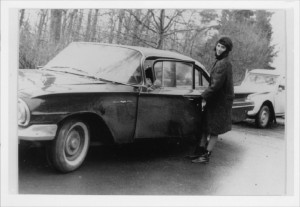Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg (* 1971), AfD-Vize und von BILD als „Blubber-Bea“ geschmäht, ist beileibe nicht die einzige Angehörige des uradeligen Adelshauses Oldenburg, die durch wirre Ansichten auffällt. Aber nicht darum soll es gehen, sondern um die Fortsetzung der mit dem Beitrag „Frauen-Traditionsnamen in Adelsfamilien vom 12. bis 20. Jahrhundert: Der Name Yolande“ begonnenen Studien zu aristokratischen Frauen-Vornamen.
Ihre Tante Eilika Fürstin zu Leiningen starb mit 87 Jahren am 26. Januar 2016 in Amorbach, entnehme ich einem Adelsblog. Die Tochter von deren Bruder Johann von Oldenburg ist die 1972 geborene Eilika Helene Jutta Clementine von Oldenburg, verheiratete Erzherzogin von Österreich1 Der Großvater von Frau von Storch war Nikolaus Friedrich Wilhelm von Oldenburg, der letzte Erbgroßherzog, der es in der Nazi-Zeit zum SA-Standartenführer brachte.2
Die Namen von Nikolaus‘ Kindern sind aufschlussreich:3
[...]