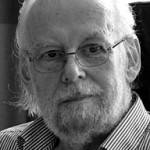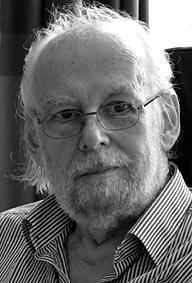Am 20.2.2014 fand in Hamburg ein eintägiger Workshop statt, der die Vermittlung der jüdischen Geschichte im digitalen Zeitalter zum Thema hatte. Veranstalter waren das Institut für die Geschichte der deutschen Juden (in dessen Räumlichkeiten die Tagung auch stattfand), die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg. Die Tagung stieß auf so reges Interesse, dass die Veranstalter laut eigener Ansage sogar Anmeldungen zurückweisen mussten, weil der bis zum letzten Platz gefüllte Raum nicht ausreichte. Die Teilnehmerschaft kam mit verschiedenen Interessen zur Veranstaltung, und es schien neben der (vermutlich größeren) Gruppe, die in zur jüdischen Geschichte arbeiten, eine Reihe von Vertretern (wie den Autor dieser Zeilen) zu geben, die das Ganze von der Warte der digitalen Geschichtskultur her interessierte. Das sorgte für vielfältige Diskussionen, wobei der erste Teil des Programms zunächst von einer grundsätzlichen Annäherung durch den Vortrag von Astrid Schwabe (Flensburg) und danach einer Reihe von Projektvorstellungen geprägt war.
Es wurde eine beeindruckende Vielfalt an Projekten präsentiert, die sich auf sehr verschiedene Weise mit jüdischer Geschichte beschäftigen. Diese sollen hier nicht im Einzelnen aufgezählt werden, doch einige Eindrücke wiedergegeben werden. Zunächst einmal bestach die (auch mediale) Vielfalt – von der kartengestützten geographischen Suche nach jüdischen Erinnerungsorten über die Web-2.0-basierte Einbindung von Usern bis hin zu komplex programmierten Klanglandschaften. In mehreren Präsentationen wurde darauf verwiesen, dass – vielleicht gerade bei der häufig vertretenen Thematik Verfolgung und Ermordung von Juden – eine Kombination aus face-to-face-Kommunikation und digitalen Materialien angebracht ist. Respekt nötigt auch das Engagement vieler Ehrenamtlicher ab, die durch lokalgeschichtliche Zugriffe die Thematik sehr lebendig zu machen verstehen und dafür einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit opfern. Dabei kommen obendrein sehenswerte Resultate heraus! Sehr zu begrüßen war auch, dass mehrere Präsentationen eher Fragen aufwarfen denn fertige Resultate zeigten, und dass auch Raum für Unsicherheit und Skepsis da war. Dies zeigte meiner Meinung nach, dass die Entwicklung einfach noch sehr im Gange ist, die Adaption neuer digitaler Tools und Vermittlungsmethoden noch eingeübt wird. Oft stehen auch nur projektbasierte Finanzierungen zur Verfügung, so dass die Kontinuität der Angebote noch nicht in jedem Fall gesichert ist. Apps und darauf zur Verfügung gestellte Materialien sollen im Übrigen häufig auch der Vor- oder Nachbereitung von Besuchen dienen, d.h. nicht nur punktuell, sondern die Erfahrung etwa eines Gedenkstättenbesuchs so noch erweiternd oder auch vertiefend.
Nach den Projektvorstellungen und der Mittagspause teilte sich die Gruppe in zwei Workshops, welche sich zwei verschiedenen Fragestellungen widmeten:
- Digital im Vergleich zu analog: Welchen Einfluss haben digitale Angebote auf den Prozess der Vermittlung und der Nutzung?
- Den User im Blick: Wer nutzt digitale Angebote zur Geschichtsvermittlung und wer nicht? Welche Rolle haben dabei die Vermittler?
Dabei war man sich im ersten Workshop einig, dass es einen Einfluss gibt, doch gingen die Meinungen darüber, ob dies als positiv oder negativ zu werten sei, auseinander. Für die Mehrheit lag der verstärkte Nutzen in einer aktiveren Einbindung von Schülerinnen und Schülern bzw. Studierenden. Kontrovers wurde diskutiert, ob in Zeiten des digitalen Wandels und der stärker partizipativen und kommunikativen Funktion des Internets der Begriff von der Geschichtsvermittlung denn noch angebracht sei. Geht es nicht viel mehr um aktive Aneignung und Mitgestaltung denn passive Rezeption nach einem instruktionistischen Modell (Stichwort: Lehre nach dem Schüttprinzip).
Der zweite Workshop sah sich der Beantwortung der schwierigen Frage gegenüber, wer die digitalen Kommunikationsangebote etwa in den Social Media überhaupt nutze. Die Gefahr von antisemitischen und anderweitig rassistischen Kommentaren wurde thematisiert – auch hier gab es keinen Konsens. Mehrere Stimmen gaben jedoch der Möglichkeit, sich für die Meinungen von Usern zu öffnen – so könnten diese z.B. ja inhaltliche Hinweise für noch offene Fragen geben, weil sie Personen auf Fotos erkennen oder andere Informationen etwa aus dem familiären Umfeld haben. Ein für beide Workshops verbindender Aspekt war die Frage, ob gerade ein Gebiet wie die jüdische Geschichte mehr Anlass zu Befürchtungen davor gebe, dass die Inhalte durch eine digitale Darbietung oder Kommunikation in 140-Zeichen-Tweets banalisiert würden. Auch hier gab es letztlich keine endgültige Antwort, und wie bei so vielen der an dem Tag diskutierten Themen könnte man sagen: Sensibilität ist gefragt, aber die Chancen der digitalen Welt wurden als höher eingeschätzt als die Risiken, so mein Eindruck.
Jedenfalls zeigte der große Anklang, den der Workshop fand, dass die Beschäftigung mit der Thematik als wichtig empfunden wird und sicherlich weitergehen wird. Eine Anregung an die Organisatoren wäre, einen Informationspool für digitale Projekte im Bereich jüdischer Geschichte anzulegen, vielleicht in Form einer digitalen Pinnwand o.Ä. Dann könnten zunächst einmal schlichtweg die existierenden Projekte gesammelt werden.
Für Ergänzungen oder weitere Hinweise in den Kommentaren bin ich sehr dankbar.
P.S. Unter dem Hashtag #JüdischDigital wurde über die Tagung getwittert, was nach Auskunft der Organisatoren für sie Neuland war, aber eifrig genutzt wurde.
Quelle: http://digigw.hypotheses.org/618