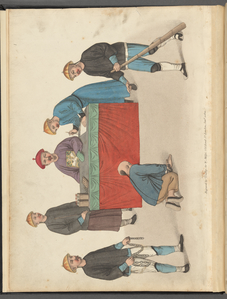Wenn man über Archäologie und Star Trek schreibt, könnte man zum Beispiel über Dokumentations- und Ausgrabungsmethoden der Zukunft sinnieren. Was wird in Zukunft möglich sein, und was ist jetzt schon möglich? Kann man, aber mach ich nicht. Das Spannende an Science-Fiction ist ja nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart, die sich solche Utopien, Fantasien oder Spekulationen ersonnen hat.
Archäologie ist kein bestimmendes Element bei Star Trek, aber eins, das immer wieder auftaucht. Und es taucht in den unterschiedlichsten Zusammenhängen auf. Manchmal wird sie nur kurz in einem Halbsatz der Figuren erwähnt, manchmal ist sie das entscheidende Element im Plot einer ganzen Episode. Eine Ursache, warum Archäologie so oft in Kinofilmen, Fernsehserien und Computerspielen vorkommt, ist wahrscheinlich ihre Beliebtheit. Archäologie ist positiv besetzt. Und auch bei Star Trek ist die Sicht auf die Archäologie positiv.[1] Sie ist als dramaturgisches Element auch sehr vielseitig einsetzbar, wie wir gleich sehen werden, aber vorher noch Grundsätzliches.
Das Phänomen Star Trek, mit seinen Anfängen in den späten 60er Jahren, ist heute Teil der Popkultur. Star Trek ist kein abgeschlossenes Universum. Begab man sich in den 60ern noch auf die Reise in ferne Welten, wird das Bild in TNG differenzierter und schafft den Sprung in die 90er Jahre. In der darauffolgenden Serie Deep Space Nine verändert sich der ganze Focus im Vergleich zu ihren beiden Vorgänger-Serien. Das Schiff fliegt nicht mehr ins Weltall hinaus, sondern das Universum-Geschehen kommt auf die Raumstation. Die vernunftorientierte, sozialistische Utopie wird aufgebrochen und die Föderation liegt in einem verlustreichen Krieg mit dem Dominion aus dem fernen Gamma-Quadranten. Die Voyager wird unfreiwillig in den Delta-Quadranten katapultiert und begegnet auf dem Weg nach Hause den verschiedensten Geschöpfen und Abenteuern. Die jüngste Serie Enterprise spielt vor TOS und bleibt hier vorerst außen vor. (Ich habe die Serie nämlich nicht vollständig gesehen). DS9, Voyager und Enterprise bilden in sich geschlossene Systeme aus, die auf der ursprünglichen Star Trek Idee Gene Rodenberrys beruhen, sich dadurch aber nicht eingrenzen lassen. Es scheint, dass dieses stete Weiterentwickeln und Reagieren auf die gesellschaftliche Wirklichkeit das Erfolgsrezept von Star Trek ist.[2]
In diesen unterschiedlichen Serien wird auch die Archäologie als narratives Element unterschiedlich eingesetzt. Während in Star Trek TOS die Archäologie immer wieder mal am Rande auftaucht, ist in TNG der Kapitän des Raumschiffes Cpt. Picard ein leidenschaftlicher Amateur-Archäologe, wohl mit Universitätsabschluss, und es gibt sogar regelrechte Archäologie-Folgen. In DS9 spielt die Archäologie eine mythologische Sonderrolle. In Voyager wird das moralische Element der gesellschaftlichen Reflexion, das in TNG bereits aufkommt, weitergeführt.
In TOS: Das letzte seiner Art liefert die Enterprise Versorgungsgüter auf Planeten M-113, auf dem eine mehrjährige archäologische Ausgrabung durchgeführt wird. Auch eine von Kirks Verflossenen ist eine Archäologin, die aber nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen ist (TOS: Gefährlicher Tausch). Dass exoarchäologische Forschung nicht ungefährlich ist, erfahren wir in TNG: Mutterliebe, in der die Archäologin Marla Aster bei der Untersuchung koinonianischer Ruinen getötet wird und einen Sohn zurücklässt. Aber nicht nur Menschen betreiben Archäologie, auch der hochrangige cardassianische Offizier Neral zeigt eine Schwäche für dieses Fach (DS9: Unter den Waffen schweigen die Gesetze).
Durch alle vier Serien zieht sich das Element, dass ein Relikt aus der Vergangenheit auftaucht und die fiktive Gegenwart durcheinander wirbelt. Die Erbauer sind vergangene Hochkulturen, deren Geschichte unbekannt oder mindestens äußerst mysteriös ist. Erzählerisch ist es ein einfacher Kniff: Ein völlig unbekannter historischer Gegenstand taucht auf und die Geschichte nimmt ihren Lauf:
In der Originalserie trifft die Enterprise auf den Planeten Amerind, auf dem sich ein seltsamer Obelisk befindet, der von einer untergangenen Zivilisation als Kometenabwehrschirm installiert wurde, aber nach mehreren Jahrhunderten in Betrieb jetzt kaputt gegangen ist (TOS: Der Obelisk). Der Androide Data wird sogar einmal selbst zu einem archäologischen Fund in einer Schicht des 19. Jahrhunderts (TNG: Gefahr aus dem 19. Jahrhundert I &II). Die Star Trek Figuren müssen besonders auf ihren Nachwuchs aufpassen, sonst kann es nämlich passieren, dass dieser in einfach herumliegenden Zeitportalen verschwindet und als eine um mehrere Jahre gealterte Personen wieder herauskommt (DS9: Das Zeitportal).
Aber Exoarchäologie findet nicht nur auf Planeten statt, sondern auch im Weltall selbst. Der Enterprise D begegnet ein einsam im Raum fliegender Komet, der sich als gigantische Bibliothek herausstellt. Sie kann Materie morphologisch verändern und verwandelt das Schiff in eine Tempelanlage, die stark an altamerikanische Hochkulturen erinnert (TNG: Der Komet). Eine Hinterlassenschaft weniger hochentwickelter Zivilisationen im Weltall sind Sonden. Der Präwarp-Zivilisation auf Kataan im Parvenium-System droht die Vernichtung durch eine Supernova. Sie schicken eine Sonde ins Weltall, die mit Hilfe eines nukleonischen Strahls eine ganze Biografie eines Kataaner simulieren kann (TNG: Das zweite Leben). Manchmal wird man aber auch von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt wie im ersten Star Trek Spielfilm aus dem Jahre 1979, als sich V´ger als die verschollene Voyager 6 entpuppt, eine fiktive Nachfolge-Sonde der beiden tatsächlich entsandten Voyager 1 und 2.
Archäologie spielt aber nicht nur als erzählerischer Anlass eine Rolle, sondern steht in einigen Folgen auch im Zentrum des Plots. Über die drei wichtigsten Archäologie-Folgen in TNG habe ich bereits in dem vorhergegangen Star Trek Post berichtet. Erzählerisch handelt es sich zum Ersten um eine Indiana-Jones-Story (TNG: Picard macht Urlaub), zum Zweiten um ein Gut-jagt-Böse-Geschichte (TNG: Der Schachzug I & II) und zum Dritten vermittelt die klare moralische Botschaft: Alle Wesen im Weltall sind Geschwister (TNG: Das fehlende Fragment)!
Auffällig dabei ist, dass Archäologie als Wissenschaft erscheint, die aufklärt, echte Beweise anführt und dabei Mythen entzaubert. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Roddenberry und seine Drehbuchautoren dem Christentum und überhaupt allen Religionen skeptisch gegenüber standen. In der Serie selbst gilt Religion zumindest in der Föderation als überwunden.
In der Serie Voyager wird dieses erzählerische Prinzip die Archäologie betreffend fortgeführt.
Der Molekularpaläontologe Forra Gegen vom Volk der Voth findet mit seinem Assistenten ein menschliches Skelett von einem verstorbenen Voyager-Crewmitglied. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass Menschen und Voth vergleichbare DNS haben, also verwandt sind. Auf der Erde des Mesozoikums haben sich Hadrosaurier zu intelligenten Wesen weiterentwickelt, die schließlich auch zur Raumfahrt im Stande waren. Sie verließen die Erde und wurden im Delta-Quadranten sesshaft. Diese Erkenntnisse entsprechen aber nicht der politischen Doktrin der Voth und so kommt es zu einem Standgericht, das an den Prozess gegen Galileo erinnert (VOY: Herkunft aus der Ferne).
Auf dem Weg durch den Deltaquadranten wird die Raumschiffcrew durch Halluzinationen von einem Massaker während eines Kriegen geplagt. Die Besatzung scheint selbst an diesem Massenmord beteiligt gewesen zu sein. Es stellt sich heraus, dass diese vermeintlichen Erinnerungen von einem Sender verursacht werden, der ein Mahnmal für die Opfer eines sehr lang zurückliegenden Kriegsverbrechens ist. Die Voyager-Besatzung repariert den Sender, damit diesen historischen Geschehnissen auch weiterhin gedacht werden kann (VOY: Das Mahnmahl).
Mit der Verantwortung des Historikers beschäftigt sich VOY: Der Zeitzeuge. Das Backup des Doktors befindet sich in einem Museum auf dem Planeten der Vaskaner und Kyrianer im 31. Jahrhundert. Die Völkerschaften sind bereits über Jahrhunderte andauernden gesellschaftlichen Unruhen ausgesetzt. Die Durchquerung des Planetensystems durch die Voyager vor sieben Jahrhunderten wird als Anlass dafür gesehen. Nur die wissenschaftlich korrekte historische Forschung, die frei ist von Vorurteilen, kann den Frieden zwischen den Völkern stiften. Is klar.
Star Trek Deep Space Nine stellt in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme im Star Trek Universum dar. Es ist die düsterste der Star Trek Serien und der dramaturgische Einsatz der Archäologie verändert sich. Hatte die Archäologie in TNG eine aufklärende Funktion, bekommt sie in DS9 eine Rolle innerhalb des mythisch-religiösen Weltbildes Bajors zugewiesen. Die Rolle von Religion für Gesellschaften wird in der Serie herausgearbeitet und der Glaube, als persönliches Erleben für Star Trek-Verhältnisse, überbetont.[3]
Bajors Götter sind nicht-körperliche Wesen, die in einem Wurmloch leben, der als Himmelstempel bezeichnet wird. Das Verhältnis zwischen den sogenannten Propheten und den Bajoranern ist ein wohlwollendes. Die Archäologie bestätigt Bajors Mythen als Wahrheit. So ist es dem Abgesandten der Propheten Cpt. Sisko vorbehalten, den Nachweis zu führen, dass die Bajoraner früher als die Völker benachbarter Planeten-Systeme Raumfahrt betrieben. Er baut archäologisch-experimentell ein Leuchtschiff und fliegt damit in Richtung Cardassia Prime. Durch natürlich vorkommende Tachyonenstürme erreicht das Leuchtschiff Warpgeschwindigkeit und gelangt damit bis ins cardassianische System. Die Cardassianer sehen sich gezwungen zuzugeben, dass die Absturzstelle des antiken Leuchtschiffes vor kurzem ausgegraben worden ist (DS9: Die Erforscher). Es ist auch der Abgesandte, der die versunkene Stadt B`hala findet, nach der Generationen von Archäologen vergeblich gesucht haben (DS9: Heilige Visionen). Die Erforschung obliegt Ranjen Koral, einem bajoranischen Mönch, der bei Forschungsfragen ganz selbstverständlich den Abgesandten zu Rate zieht (DS9: Zeit der Abrechnung). Zu guter Letzt ist es auch, na wer? natürlich der Abgesandte, der den letzten verschollenen Drehkörper in einer wilden, affektiven Buddelei ausgräbt (DS9: Das Gesicht im Sand).
Archäologinnen und Archäologen treten als Rand- und Hauptfiguren auf, oder die Entdeckung eines historischen Fundes steht am Anfang der Episode. Archäologie wird aber auch als Mittel eingesetzt, um einen Sachverhalt zu verifizieren oder zu falsifizieren, denn archäologisch geborgene Gegenstände lügen nicht. Archäologie kann Aberglaube entlarven, oder es bestätigt den aufgebauten Mythos von Gottheiten und Prophezeiungen. Archäologie ist in Star Trek also nur bedingt ein Teil der sozialistischen Utopie amerikanischer Prägung, sondern vielmehr ein narratives Element, das vielseitig einsetzbar ist.
Verwendete Literatur
D. L. Bernardi, Star Trek and history. Race-ing toward in a white furure (New Brunswick, New Jersey u. London 1998)
H. Brandt-F. Schindel-J. Wellhöner, Indiana Jones im Weltraum? Das Bild der Archäologie in Star Trek, in: N. Rogotzki- T. Richter- H. Brandt- P. Friedrich- M. Schönhoff- P. M. Hahlbohm (Hrsg.), Faszinierend! Star Trek und die Wissenschaften 2 (Kiel 2003) 139-164
L. Russell, Archaeology and Star Trek: Exploring the past in the future, in: M. Russell (Hrsg.), Digging Holes in popular culture. Archaeology and science fiction, 2002, 19-29
O. Wenskus, Umwege in die Vergangenheit. Star Trek und die griechisch-römische Antike. Literaturwissenschaftliche Studien zu Antike und Moderne 13 (Innsbruck 2009)
Weitere Literatur: Faszinierend! Ein archäologischer Ausflug ins Science-Fiction (Interner Link)
Siehe auch: Das archäologische Geschichtsbild bei Star Trek (Interner Link)
[1] O. Wenskus, Umwege in die Vergangenheit. Star Trek und die griechisch-römische Antike. Literaturwissenschaftliche Studien zu Antike und Moderne 13 (Innsbruck 2009)11-13
[2] A. Rauscher, Das Phänomen Star Trek. Virtuelle Räume und metaphorische Weiten (Fulda 2003) 10-18
[3] O. Wenskus, Umwege in die Vergangenheit. Star Trek und die griechisch-römische Antike. Literaturwissenschaftliche Studien zu Antike und Moderne 13 (Innsbruck 2009) 11-13
Quelle: http://de.hypotheses.org/71688