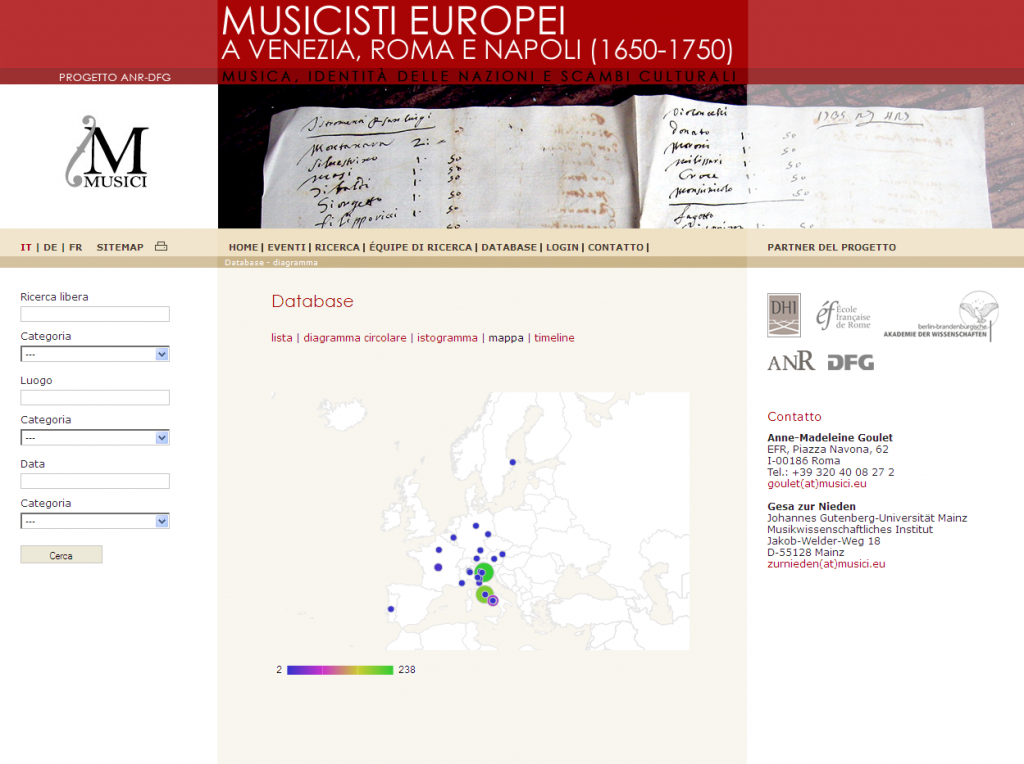Stellen Sie sich vor, Sie müssten gleich einen wissenschaftlichen Text lesen. Welche Assoziationen befallen Sie bei dem Gedanken daran?
Stellen Sie sich vor, Sie müssten gleich einen wissenschaftlichen Text lesen. Welche Assoziationen befallen Sie bei dem Gedanken daran?
???
Haben Sie etwa gerade gegähnt? Graust es Ihnen vor langen, verschachtelten Sätzen, die Sie dreimal lesen müssen, bevor Sie sie verstehen? Würden Sie sich wünschen, dafür weniger Zeit aufwenden zu müssen? Nicht, weil Sie der Inhalt nicht interessieren würde, sondern weil das Lesen länger dauert, als es nötig wäre, und deshalb mühevoller ist?
(Nebenbei erwähnt: wissenschaftliche Texte müssen nicht zwangsweise kompliziert geschrieben werden; jeder Autor könnte seine Texte auch gut lesbar gestalten.)
Hier aber geht es ums Bloggen und hier dürfen, nein müssen Sie es anders machen:
- Schreiben Sie einfach! Das erleichtert Ihnen das Schreiben und Ihrem Leser das Lesen.
- Bloggen ist Kommunikation und dabei ist der Leser auch immer an der Person des Autors interessiert. Hier können Gedanken und Überlegungen Ausdruck finden, die in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht üblich sind. Das Blog bietet durch eine andere Herangehensweise an das Thema damit eine Möglichkeit, Ihr Thema zu reflektieren.
Außerdem können Sie hier Ihre Begeisterung rüberbringen. Gerade das ist ja etwas, die Sie antreibt und an dieser persönlichen Note ist der Leser interessiert. Dann geraten Texte auch nicht langweilig.
Eine schöne Bestätigung ist, wenn die am Anfang noch bescheidene Leserzahl wächst, was Sie an der Statistik des Blogs ablesen können. Dort erfahren Sie, wie oft ein Artikel aufgerufen wurde. - Rezepte für das Bloggen im wissenschaftlichen Bereich gibt Marc Scheloske auf seinem Blog Wissenswerkstatt. Hier finden Sie auch ein paar weiterführende Links zum Thema.
- Authentizität ist ein Stichwort, denn Sie werden einige Ihrer Leser später im realen Leben kennen lernen. Da sollte der Eindruck, den der Leser aufgrund der Blogartikel von Ihnen hat, mit dem realen Eindruck übereinstimmen.
- Blogposts möglichst regelmäßig zu veröffentlichen, wird allgemein propagiert.
- Auch ist es besser, öfter kurze als seltener lange Blogposts zu veröffentlichen. Da Leser eines wissenschaftlichen Blogs häufig selbst aus der Wissenschaft kommen, raten Sie mal, was sie nicht wollen? Lange, komplizierte Texte lesen(s.o.). Wenn Sie also über neue Forschungsergebnisse berichten, dann können Sie sich leicht vorstellen, dass Texte, die gut lesbar und nicht abschreckend lang sind, eher gelesen werden. Der Nutzen für den Leser liegt in der Kombination aus Wissensgewinn und Zeitersparnis.
- Damit Artikel nicht zu lang geraten, kann man sie teilen. Schreiben Sie Mehrteiler oder Fortsetzungen.
- Als Hilfsmittel für das Schreiben verwende ich ein Synonymwörterbuch (die Münchner UB stellt es online zur Verfügung, was ich sehr praktisch finde). Was verwenden Sie oder was hilft Ihnen beim Schreiben? Außerdem gibt es weitere Literatur und Tipps hier:
- Schreibwerkstatt von Huberta Weigl
- Schreibnudel von Gitte Härter
- Mir persönlich helfen die Tipps von Ulrike Scheuermann: Die Schreibfitness-Mappe, Wien 2011
Welche Beispiele und Hinweise können Sie zur Vervollständigung der Liste geben? Ich bin gespannt!
______________________
Abbildung: Buntstifte by joerpe, CC BY-NC 2.0
______________________
Artikelreihe: Wissenschaftliches Bloggen in der Praxis