Höfe, weltliche wie geistliche, königliche, fürstliche, gräfliche oder herrliche, waren in all ihren politischen, kulturellen, sozialen, auch ökonomischen Aspekten die wesentlichen Herrschaftszentren1 der vormodern-vorstaatlichen Anwesenheitsgesellschaften2. Je nach Forschungsperspektive können sie in verfassungs-, rechts-, sozial-, kommunikations- oder kulturgeschichtlicher Hinsicht als symbolisch-repräsentativer oder textlicher Zusammenhang interpretiert werden3 oder als hierarchisch strukturierte Ordnung, dabei stets sowohl strukturell wie personell, formal wie informell4 auf den jeweiligen Herrn orientiert5. Der in der Einleitung dieser Blog-Reihe zitierte Walter Map nimmt vor allem die personelle Orientierung wahr und deutet diese kritisch als Ausdruck des Bestrebens, einem Einzigen zu gefallen6. Walter Map markiert mit seinen Worten treffend die Beobachtung, dass sich die Stellung des einzelnen Höflings nach seiner Nähe zum Herrn bestimmt habe. Zeitgenössisch, umgangssprachlich, aber auch in der Forschung wird diese Stellung insbesondere dann, wenn sie durch eine intensive Nahbeziehung zum Herrn hervorgehoben und ausgezeichnet ist und damit bereits in der Zeit prominent greifbar, ganz unterschiedlich angesprochen. Bekannt ist die interessengeleitete Abqualifizierung solch Personals7. So nennt etwa der sogenannte ‚Oberrheinische Revolutionär‘ den engen Kreis um Kaiser Maximilian schmorotzer, die nechst bim bett des Herrn sind8, der Chronist Wilhelm Rem bezeichnet sie als laurbůben9 und hebt Maximilians Diener Matthäus Lang als huorenjäger hervor10. Die Forschung hat sich v.a. der meist synonym und ohne analytische Trennschärfe verwendeten Begriffe des ‚Günstlings‘ und ‚Favoriten‘ bedient, dabei aber die nicht nur umgangssprachlich gegebenen pejorativen Implikationen kaum vermeiden können11, zumal schon in der Überlieferung jene abwertenden Äußerungen, recht häufig schlicht durch Neid motiviert, angeboten werden.
[...]
Fundstücke
- Woher kamen die Verluste der Roten Armee?
- Geschichte des deutschen U-Boots, das die Geheimwaffen nach Japan bringen sollte
- Die SZ hat eine Fotostrecke zur italienischen Front im Ersten Weltkrieg.
- Vox hat was zur Geschichte der rasierten Frauenbeine (Englisch)
Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2015/05/fundstucke_25.html
„Für mich war Fotografieren immer Politik und politischer Kampf“
ARCHIV-AUGUST 2022
Die Visual History-Redaktion nutzt den Monat August, um interessante, kluge und nachdenkenswerte Beiträge aus dem Visual History-Archiv in Erinnerung zu rufen. Für die Sommerlektüre haben wir eine Auswahl von acht Artikeln getroffen – zum Neulesen und Wiederentdecken!
(2) Im März 2022 ist der Berliner Pressefotograf Paul Glaser im Alter von 80 Jahren gestorben. Ab Mitte der 1970er Jahre fotografierte er u.a. Motive gesellschaftspolitischer Konflikte in Berlin wie Hausbesetzungen, Friedensdemonstrationen und Straßen-Krawalle. In den Jahren 1989 bis 1993 arbeitete Glaser in Ostdeutschland und fotografierte Entstehendes und Verfallendes. Unser ZZF-Kollege Florian Völker hat 2015 ein Interview mit ihm geführt.
[...]
durchsichten: Transnationale Wechselbeziehungen. Deutschland und das östliche Europa
Die Europäische Union und der Nationalismus der politischen Mitte
Die Debatte über den Nationalismus im Europa des 21. Jahrhunderts befasst sich fälschlicherweise meist nur mit dessen Radikalisierungen, nicht aber mit dem Umstand, dass der Nationalismus ein Geflecht ist, das ebenso gut in der sogenannten politischen Mitte wächst.
Der Beitrag Die Europäische Union und der Nationalismus der politischen Mitte erschien zuerst auf Wolfgang Schmale.
Quelle: http://wolfgangschmale.eu/die-europaeische-union-und-der-nationalismus-der-politischen-mitte/
Richtlinien zur Bewertung digitaler Geschichtswissenschaft: ein Vorschlag der AHA
 Die American Historical Association (AHA) hat mit den „Draft Guidelines on the Evaluation of Digital Scholarship [PDF]“ eine interessante Initiative gestartet, die auch in den Geschichtswissenschaften hierzulande diskutiert werden sollte: ein Richtlinienentwurf für die Evaluierung digitaler Geschichtswissenschaft. Ausgangspunkt ist die Bestandsaufnahme, dass neue digitale Praktiken in Forschung, Lehre, Pädagogik und Servicebereichen entstehen, es aber noch keine Standards gibt, wie diese zu bewerten sind.
Die American Historical Association (AHA) hat mit den „Draft Guidelines on the Evaluation of Digital Scholarship [PDF]“ eine interessante Initiative gestartet, die auch in den Geschichtswissenschaften hierzulande diskutiert werden sollte: ein Richtlinienentwurf für die Evaluierung digitaler Geschichtswissenschaft. Ausgangspunkt ist die Bestandsaufnahme, dass neue digitale Praktiken in Forschung, Lehre, Pädagogik und Servicebereichen entstehen, es aber noch keine Standards gibt, wie diese zu bewerten sind.
Sicherlich: bei den zehnseitigen Guidelines handelt es sich in erster Linie um einen pädagogischen Text, der oftmals wenig konkret ist. Vieles klingt auf den ersten Blick selbstverständlich. Dass es das offensichtlich nicht ist, beweist die bloße Existenz dieser Guidelines. Der Hauptzweck des Textes dürfte folglich darin liegen, um Verständnis für digitale Praktiken zu werben und flächendeckend in der historischen Disziplin Ängste und Vorurteile abzubauen. Vielfach trauen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht, digitale Methoden und Werkzeuge einzusetzen, da für die Bewertung digitaler Projekte die entsprechenden Richtlinien fehlen. Hier setzt der Entwurf ein, der Kriterien zur Evaluierung digitaler Projekte und wissenschaftliche Kommunikation entwickeln möchte, die bei Einstellung, Beförderung und tenure (hiring, promotion, and tenure) zum Einsatz kommen sollen.
[...]
Moderne Museen. Experiment, Tradition und Globalisierung
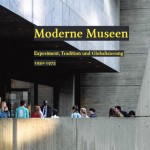
Nach dem Zweiten Weltkrieg eignen sich weltweit modern arbeitende Architekten eine Bauaufgabe an, die bis dahin fast ausschließlich von traditionell gesinnten Vertretern des Fachs wahrgenommen wurde: das Museum. Das überkommene Bild des Museums – der Kunsttempel, das Schatzhaus, der Kunstpalast – wird, anschließend an museologische Diskurse der 1920er- und 1930er-Jahre, gänzlich neu konzipiert. Es entsteht das Museum als flexible Ausstellungsmaschine und Lernort, das Museum als architektonischer Ausdruck des demokratischen (auch: sozialistischen) Wohlfahrtsstaats und nicht zuletzt das Museum als Ausflugsziel einer zunehmend automobilen Gesellschaft. Mit dem White Cube etabliert sich ein global erfolgreiches Museumsidiom. Gefragt wird nach den Entstehungsbedingungen des Modernen Museums wie nach dessen Aktualität für den zeitgenössischen Museumsbau.
Donnerstag, 28. Mai 2015
19:00 Uhr
Begrüßung
Christoph Gengnagel, Universität der Künste Berlin
Dorothee Wimmer, Richard-Schöne-Gesellschaft für Museumsgeschichte e.V.
[...]
Quelle: https://www.visual-history.de/2015/05/22/moderne-museen-experiment-tradition-und-globalisierung/
Euro-Babel: Better Analysis Based on Endangered Languages
Stellenausschreibung: Computerlinguist mit Kenntnis linksläufiger Sprachen (5 Jahre, E13, vollzeit)
 Im ERC-Projekt “Contemporary Bioethics and the History of the Unborn (COBHUNI)” an der Universität Hamburg ist zum 01.09.2015 eine Stelle für einen Computerlinguisten mit (neben anderen Kenntnissen) Kenntnis linksläufiger Sprachen zu besetzen. Alle weiteren Informationen finden sich in der Stellenausschreibung.
Im ERC-Projekt “Contemporary Bioethics and the History of the Unborn (COBHUNI)” an der Universität Hamburg ist zum 01.09.2015 eine Stelle für einen Computerlinguisten mit (neben anderen Kenntnissen) Kenntnis linksläufiger Sprachen zu besetzen. Alle weiteren Informationen finden sich in der Stellenausschreibung.
.
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=5114
“Wer nicht mehr befreit werden konnte”
Ansprache von Katrin Stoll anlässlich der Eröffnung der Ausstellung “Niemandsorte” am DHI Warschau.
“Schritte –
In welchen Grotten der Echos
seid ihr bewahrt
den ihr den Ohren einst weissagtet
kommenden Tod?
[…]
Schritte –
Urzeitspiel von Henker und Opfer,
Verfolger und Verfolgten,
Jäger und Gejagt –
[…]”
Nelly Sachs‘ Werk gehörte nicht zur Pflichtlektüre des Deutschunterrichts des Gymnasiums in Ost-Westfalen, an dem ich vor 20 Jahren mein Abitur ablegte. Damals, 50 Jahre nach Kriegsende, hielt der leitende Lehrer meines Jahrgangs auf unserer Abschlussfeier eine bewegende, emotionale Rede, in deren Mittelpunkt er die von Deutschen verübten Verbrechen in ganz Europa stellte und uns unsere politische Verantwortung vor Augen führte.
[...]
Quelle: https://mws.hypotheses.org/27404

