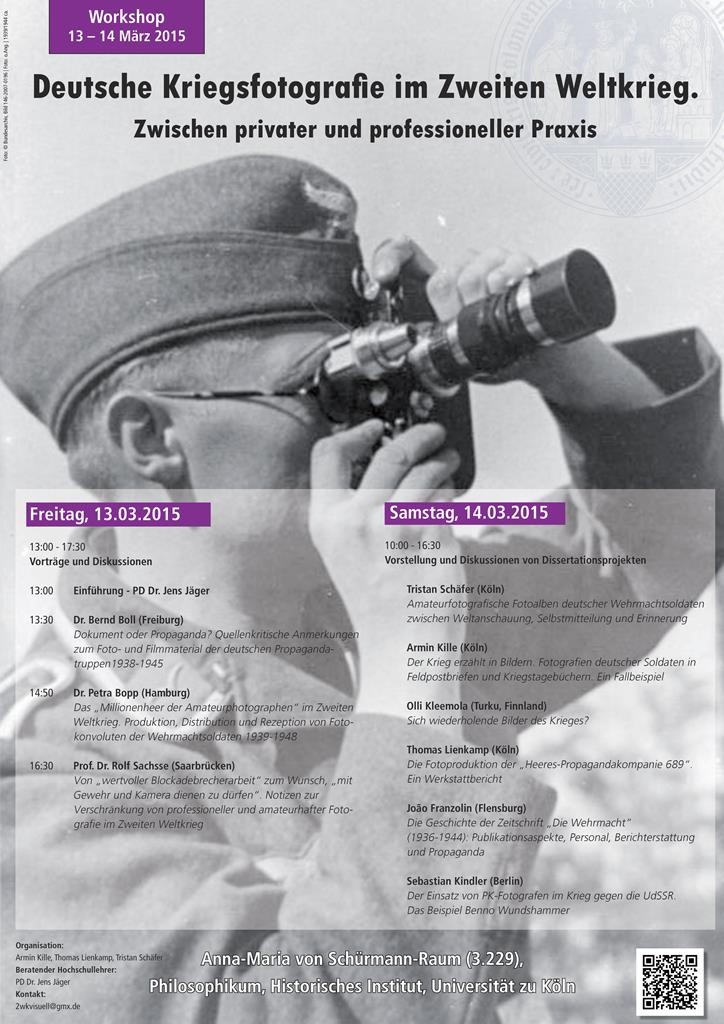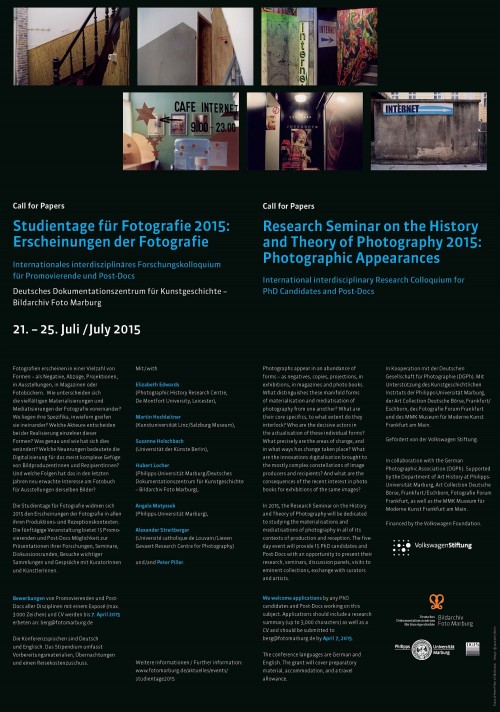Nach Mareike Königs Vortrag “Blogs als Wissensorte der Forschung”, wurde auf der Tagung Die Zukunft der Wissensspeicher: Forschen, Sammeln und Vermitteln im 21. Jahrhundert - ausgerichtet von der Gerda Henkel Stiftung und dem Konstanzer Wissenschaftsforum am 5. und 6. März in Düsseldorf – eine lebhafte Diskussion geführt; leider viel zu kurz, wie ich fand. Es begann eine Art Blog-Bashing, das in späteren Vorträgen von verschiedenen Rednern mit kurzen Seitenhieben fortgesetzt wurde.
 Beispielhaft möchte ich die Aussage von Prof. Ulrich Gotter von der Universität Konstanz nennen, der wissenschaftliches Bloggen mit Exhibitionismus gleichsetzte. Also bin ich wohl eine Exhibitionistin. Da es meine Art nicht ist, gegen solche Aussagen mit entblößtem Oberkörper á la Pussycat Riot die Bühne zu stürmen, verwende ich hierzu lieber mein Blog – das empfinde ich als standesgemäßer. Denn dies scheint der Ort meiner wissenschaftlichen Exhibition zu sein.
Beispielhaft möchte ich die Aussage von Prof. Ulrich Gotter von der Universität Konstanz nennen, der wissenschaftliches Bloggen mit Exhibitionismus gleichsetzte. Also bin ich wohl eine Exhibitionistin. Da es meine Art nicht ist, gegen solche Aussagen mit entblößtem Oberkörper á la Pussycat Riot die Bühne zu stürmen, verwende ich hierzu lieber mein Blog – das empfinde ich als standesgemäßer. Denn dies scheint der Ort meiner wissenschaftlichen Exhibition zu sein.
Wie ich zum Bloggen kam
Als „Ich-will-mich-der-Öffentlichkeit-nicht-aussetzen-Internet-Nutzerin“ besuchte ich 2012 die Tagung „Weblogs in den Geisteswissenschaften“. Mein Doktorvater, Prof. Hubertus Kohle, hielt dort einen Vortrag und gehört außerdem zum Wissenschaftlichen Beirat von de.hypotheses. Da dachte ich: „Gehste hin. Machste ‘n guten Eindruck.“ Ich hatte niemals die Absicht, ein Blog zu eröffnen, da hätte ich mich ja in die Öffentlichkeit stellen müssen. Ih gitt!
Der Nutzen meines Blogs
Im Laufe der Veranstaltung wurde mir klar, welche Möglichkeiten sich durch das Bloggen für mich bieten würden und drei Wochen später hatte ich mein Blog bei hypotheses eröffnet. So schnell kann ein Sinneswandel gehen. Handeln beginnt immer im Kopf und zwar mit Denken. Die Schublade, mich nicht in die Öffentlichkeit stellen zu wollen ging zu und ein neues Kapitel begann: das des Bloggens.
Ich weiß nicht, wie ich ohne Blog die Einarbeitungszeit durchgestanden hätte. Im ersten Jahr schrieb ich jede Woche einen Artikel, danach etwas weniger, aber dennoch regelmäßig. Es motivierte mich, lasen doch sicher der ein oder die andere mit. Genau das ist wichtig, zumal ich als externe Promovendin nicht direkt an den Wissenschaftsbetrieb angeschlossen bin. Durch das Blog bin ich Mitglied einer wissenschaftlichen Community und das spornt an und tut gut!
Aufwand und Nutzen
Einen Artikel zu verfassen braucht Zeit, aber die investiere ich in mich, in mein Wissen. Was könnte ich also nützlicheres für mich tun? Es scheint so, als hätte nur die Öffentlichkeit etwas von meinen Texten, aber zunächst bin es immer ich, die einen Wissensgewinn aus der intensiven Beschäftigung mit einem Thema zieht – und dann erst die anderen.
Wer noch mehr Gründe für das Bloggen sucht: Auf dem Redaktionsblog von hypotheses hatte ich vor einiger Zeit dazu einen Artikel verfasst Warum sollte ich als Wissenschaftler/in bloggen?
Meine Meinung
So, und das alles hat nichts mit Exhibitionismus zu tun. Hätte es das, dann gälte es für das Publizieren von Büchern oder in Zeitschriften ebenfalls. Denn worin liegt der Unterschied?
Ich für meinen Teil kann Bloggen nur empfehlen. Schreiben Sie mir über die Kommentarfunktion gerne Ihre Motivation für das Bloggen. Argumente gegen das Bloggen können Sie hingegen für sich behalten – die interessieren mich nicht.
Digitale Bildquelle: www.artigo.org
Künstler: Gustave Courbet
Titel: L’Origine du monde
Ort: Paris, Musée d’Orsay
Datierung: 1866
Quelle: http://games.hypotheses.org/1919