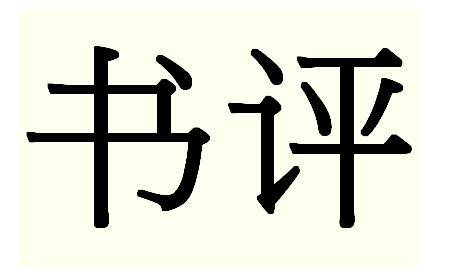English
Ever since National Socialism used the term “Rasse” in a biologistic and inhumane manner and forced it into culture, it has no longer been possible for German speakers to use the term in a neutral, or uncharged, fashion. The term is also considered scientifically obsolete. However, since the English cognate (“race”) calls up aspects of diversity which cannot be adequately captured by any other term (e.g. ethnic background as a category of analysis for self- and external attributions of race), some scholars address this difficulty to distinguish current usage from that of National Socialism and to turn to a slightly different history of the term. Others instead speak of “ethnicity” and thus relate “race” to post-modern concepts of communities.[1]
Multidimensional diversity
Exploring the subject of diversity in German-speaking and international contexts inevitably ushers in the linguistic and categorical problems of the term “Rasse” (“race”), which appears in the relevant discourse time and again. As regards classroom teaching, one important question is whether the German tradition of history didactics possesses an adequate category for exploring how learners from different ethnic backgrounds deal with certain historical topics.[2] Although present-day Austria has a diverse population, with ethnic backgrounds ranging from the Mediterranean region through South-Eastern Europe to Asia and Africa, not enough consideration is given to the effects of how people see themselves and others on the formation of historical identity or on history learning.[3] In the classrooms of a globalising world, homogenising ideas about learners and their backgrounds are no longer valid. Students may behave quite differently depending on past influences and present circumstances. The identities of individual students differ not only in terms of sex, nationality, religion, culture, health and so forth, but also in terms of their behaviour towards external differences and their social connotations (e.g. skin colour).
Risk of hierarchisation
These categories of difference are all in constant danger of falling into discriminatory essentialisation and hierarchisation, in which stereotypes are constructed, reinforced, or passed on unthinkingly. In Anglo-American literature, it thus often seems that “African Americans” or “Caribbean Americans” constitute homogeneous groups on account of particular cultural and / or physical characteristics. Accordingly, it remains largely unknown whether these designations are self-attributions by the groups involved in the debate over historical didactics, as in the United States Census, or whether such designations are assigned to such groups by researchers. It would therefore be a dangerous balancing act to deal with these categories without critical anti-racist, post-colonial, and socially-minded examination [4]. This is true in particular if one takes these categories as the basis for raising awareness of identity-forming patterns within the context of historical learning. That is, do students choose (their) identity or is (their) identity chosen on the basis of social attributions. Ultimately, this central question also concerns interactions between socio-cultural categories, which, through relational accumulation within social systems, including the institution of history teaching, lead to discrimination (“intersectionality”). However, a tendency towards ignoring the variety of social attributions within the context of “race” would negate a relevant aspect of identity. Along these lines, Martin Luecke has therefore argued that the very “undoubtedly racist history of Germany has a blocking effect on the establishment of racism-critical research.” [5] This in turn raises another fundamental question: does the concept of “race” need to be (re)introduced into German-speaking critical discourse or not?
“Ethnicity” — another way
So far, the above questions about history teaching have not been addressed at all in Austria. Whereas in the United States there is a lively debate on how to teach the transatlantic slave trade, specifically on how learning groups consisting of “European Americans,” “African Americans,” and students from other ethnic backgrounds react to the subject of slavery, as well as its causes and effects [6], in the German-speaking discourse ethnic background is very seldom treated as a category of analysis. Following Robert Miles, Martin Luecke argues that the category of “race” should receive greater attention, in particular because it represents a relevant ideological construct which brings into the debate real and imaginary, biological and cultural facets, and therefore carries considerable weight.[7 ] Within the context of historical and political learning, moreover, the question of “race” is crucial in a diverse world. At the same time, however, part of me resists the (re-)introduction of the category of “race,” or “Rasse” for that matter. My resistance is due to the fact that current German-speaking usage rests on past meaning, whose potential re-coding as a socio-cultural construct will probably not produce greater clarity, but instead runs the risk of reviving older racist patterns of interpretation. It might therefore be worthwhile for present German-speaking didactics of history to move towards a more nuanced discussion of the concept of “ethnicity” in order to emphasize its transmutable character of socio-cultural construction especially with a stronger focus on self-descriptions and excluding biologistic aspects.[8] It also seems necessary to make a clear distinction between a useful epistemological category in research (here: “ethnicity”) and a racism-critical discussion of substantive social phenomena.[9]
____________________
Literature
- Lovejoy, Paul E./ Bowser, Benjamin P. (Ed.). The Transatlantic Slave Trade and Slavery: New Directions in Teaching and Learning. Trenton 2013.
- Epstein, Terrie. Interpreting National History: Race, Identity, and Pedagogy in Classrooms and Communities. New York; London, 2009.
External Link
____________________
[1] Such discussions lie within the scope of an ethics of scientific historical language; see Christoph Kühberger and Clemens Sedmak, Ethik der Geschichtswissenschaft. Zur Einführung (Vienna, 2008), 140ff.
[2] At the time, this was established especially in the field of Holocaust education. See Viola Georgi, Entliehene Erinnerung: Geschichtsbilder junger Migranten in Deutschland (Hamburg, 2003).
[3] See Katarina Browne, “The Psychological Consequences of Slavery for Beneficiaries of Slavery: Implications for Classroom Teaching,” in P. E. Lovejoy and B.P. Bowser, The Transatlantic Slave Trade and Slavery: New Directions in Teaching and Learning (Trenton, 2013), 219–24.
[4] Katharina Walgenbach, Intersektionalität – eine Einführung. – http://portal-intersektionalitaet.de/theoriebildung/schluesseltexte/walgenbach-einfuehrung/ (last accessed 11.8.2014).
[5] Martin Lücke, “Diversität und Intersektionalität als Konzepte der Geschichtsdidaktik,” in Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichtes, vol. 1. Eds. M. Lücke and M. Barricelli (Schwalbach/ Ts. 2012), 136–146, 139.
[6] Alan J. Singer, New York and Slavery: Time to Teach the Truth (New York, 2008).
[7] Lücke 2012, 139.
[8] “Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Aehnlichkeiten [sic!] des äußeren Habitus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinsamkeit hegen, derart, daß dieser für die Propagierung von Vergemeinschaftungen wichtig wird, dann, wenn sie nicht ‚Sippen‘ darstellen, ‚ethnische‘ Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine Blutsgemeinsamkeit objektiv vorliegt oder nicht.” (M. Weber 1972). See further Rainer Schnell, Dimensionen ethnischer Identität (1990). – https://www.uni-due.de/~hq0215/documents/1990/1990_DimensionenEthnischerIdentitaet.pdf (last accessed 2.7.2014). For a critical position, see Olja Alvir, “Verlegenheitsbegriff Ethnie als Abgrenzung zu Anderen,” Der Standard, 1 February 2013. – http://dastandard.at/1358305217685/Verlegenheitsbegriff-Ethnie-als-Abrenzung-zu-Anderen (last accessed 2.7.2014).
[9] For instance, the scientifically rejected, but unfortunately socially persistent “race theory.” See Klaus Taschwer, “Neuer Streit um DNA-Unterschiede zwischen ‚Rassen’”, Der Standard, 12 August 2014 http://derstandard.at/2000004302135/Neuer-Streit-um-DNA-Unterschiede-zwischen-Rassen; (last accessed 14 August 2014). See also http://cehg.stanford.edu/letter-from-population-geneticists/ (last accessed 14 August 2014).
____________________
Image credits
© Christoph Kühberger, 2014. Poster Segment Gandhi-Museum, Mani Bhavan (India).
Recommended citation
Kühberger, Christoph: “Race” – an neccessary category? In: Public History Weekly 2 (2014) 32, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-2520.
Copyright (c) 2014 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.
Deutsch
Seitdem der Nationalsozialismus den Terminus “Rasse” auf eine biologistische und menschenverachtende Art gebrauchte, ist es im deutschsprachigen Raum nicht mehr möglich, den Begriff unbelastet zu nutzen. Er gilt zudem als wissenschaftlich überholt. Da jedoch für einige ForscherInnen der englischsprachige Begriff “race” Bereiche von Diversität erfasst, die mit keinem anderen Begriff zufriedenstellend ausgedrückt werden können (z.B. ethnischer Hintergrund als Analysekategorie für rassistische Selbst- und Fremdzuschreibungen), weichen manche auf diesen aus, um ihre Abgrenzung zum Nationalsozialismus zu markieren und um eine etwas andere Begriffsgeschichte zu nützen. Andere sprechen von “Ethnizität” und beziehen sich damit auf post-moderne Konzepte von Gemeinschaften.[1]
Mehrdimensionale Diversität
Beschäftigt man sich geschichtsdidaktisch mit Fragen der Diversität im deutschsprachigen und internationalen Kontext, stößt man allerdings unweigerlich auf das sprachlich-kategoriale Problem rund um “Rasse”/”race”, da der Begriff dort immer wieder auftaucht. Mit Blick auf die SchülerInnen stellt sich die Frage, ob man in der deutschsprachigen Tradition der Geschichtsdidaktik über eine satte Kategorie verfügt, um zu erforschen, wie Lernende mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen bestimmte Themen verarbeiten.[2] Obwohl in Österreich nicht nur Menschen mit ethnischem Hintergrund aus den Mittelmeerregionen oder aus Süd-Osteuropa leben, sondern auch aus Asien und Afrika, wird derzeit etwa nicht ausreichend darüber nachgedacht, welche Auswirkungen deren jeweilige Selbst- und Fremdbilder im Zusammenhang mit einer historischen Identitätsbildung bzw. dem historischen Lernen besitzen.[3] In den Klassenzimmern einer sich globalisierenden Welt kann eben nicht von homogenisierenden Vorstellungen über die Zusammensetzung der Lerngruppe ausgegangen werden. Die SchülerInnen verhalten sich daher auch ganz unterschiedlich gegenüber den Zumutungen der Vergangenheit und ihrer Verarbeitung in der Gegenwart. Ihre Identitäten unterscheiden sich nämlich nicht nur hinsichtlich des Geschlechts, der Schicht, der Nationalität, der Religion, der Kultur, der Gesundheit und vielem mehr, sondern auch durch ihr Verhalten gegenüber äußerlichen Unterschieden und deren Konnotationen innerhalb der Gesellschaft (z.B. Hautfarbe).
Gefahr der Hierarchisierung
Diese Differenzkategorien sind jedoch alle je gefährdet, in eine diskriminierende Essentialisierung und Hierarchisierung zu verfallen, indem Stereotypen aufgebaut, verfestigt oder tradiert werden. So hat es oftmals in der anglo-amerikanischen Literatur den Anschein, dass “African Americans” oder “Caribbean Americans” Gruppen darstellen, welche aufgrund kultureller und/oder körperlicher Merkmale homogen wären. Es bleibt zudem meist weitgehend ungeklärt, ob es sich bei den je angeführten Gruppen in den geschichtsdidaktischen Diskussionen um Selbstzuschreibungen handelt, wie dies im United State Census gemacht wird, oder um Fremdzuschreibungen seitens der ForscherInnen. Es wäre also eine gefährliche Gratwanderung, würde man den Umgang mit diesen Kategorien nicht einer antirassistischen, postkolonialen und gesellschaftskritischen Prüfung unterziehen [4], wenn man sie für den Aufbau einer Sensibilität gegenüber Identitätsmustern im Rahmen des historischen Lernens heranzieht, die von SchülerInnen selbst gewählt werden oder aufgrund von Zuschreibungen innerhalb von Gesellschaften entstehen. Letztlich geht es durchaus auch um Wechselwirkungen von sozio-kulturellen Kategorien, die durch relationale Kumulation innerhalb von sozialen Systemen, zu denen auch der Geschichtsunterricht als Institution zu rechnen ist, zu Diskriminierung führen (“Intersektionalität”). Ein tendenzielles Ignorieren der unterschiedlichsten Zuschreibungen, die im Zusammenhang mit “race” in einer Gesellschaft stattfinden, würde jedoch bedeuten, einen relevanten Aspekt von Identität zu negieren. Martin Lücke argumentiert daher etwa, dass gerade die “zweifellos rassistische Vergangenheit Deutschlands blockierend auf die Etablierung rassismuskritischer Forschung” wirke.[5] Es muss jedoch gerade an dieser Stelle die Anfrage erlaubt sein, ob der deutschsprachige Diskurs dazu tatsächlich die (Wiederein-)Führung des Konzeptes “race” benötigt.
“Ethnie” – ein anderer Weg
Relevante Fragen, die sich in diesem Zusammenhang für die Beobachtung des Geschichtsunterrichts ergeben, wurden bisher in Österreich noch gar nicht im ausreichenden Maße wahrgenommen. Während es etwa in den USA eine geschichtsdidaktische Diskussion zur Vermittlung des transatlantischen Sklavenhandels gibt, in der erörtert wird, wie eine Lerngruppe aus “European Americans”, “African Americans” und anderen SchülerInnen mit verschiedenen ethnischen Hintergründen auf die Thematisierung der Sklaverei, ihre Ursachen und Wirkungen reagieren,[6] wird im deutschsprachigen Diskurs der ethnische Hintergrund als Analysekategorie noch relativ wenig beachtet. Martin Lücke argumentiert mit Robert Miles dafür, dass auch die Kategorie “race” eine Aufmerksamkeit erfahren sollte, da sie ein relevantes ideologisches Konstrukt darstellt, das reale und/oder erfundene, biologische und/oder kulturelle Facetten verarbeitet und dabei massive Bewertungen vornimmt.[7] Mir scheint es im Zusammenhang mit historisch-politischem Lernen wichtig, diesen Bereich in einer von Diversität geprägten Gesellschaft nicht auszuschließen, doch gleichzeitig regt sich in mir innerer Widerstand gegen die (Wieder-) Einführung einer Kategorie “race” oder gar “Rasse”. Dies liegt darin begründet, dass im deutschen Sprachraum mit diesen Termini auf eine in der Vergangenheit verankerte Wortbedeutung verwiesen wird, deren Neukodierung vermutlich nicht zu mehr Klarheit führt, sondern vielmehr Gefahr läuft, ältere rassistische Deutungsmuster wiederzubeleben. Es könnte sich daher nicht nur für die deutschsprachige Geschichtsdidaktik lohnen, eine differenziertere Diskussion zum Begriff der “Ethnie” zu führen, um dessen wandelbaren Konstruktionscharakter zu betonen und um biologistische Momente dabei auszuschließen.[8] Überdies sollte eine Trennung zwischen einer nutzbaren erkenntnistheoretischen Kategorie in der Forschung (“Ethnie”) und einer inhaltlichen rassismuskritischen Diskussion von gesellschaftlichen Phänomenen vorgenommen werden.[9]
____________________
Literatur
- Lovejoy, Paul E. / Bowser, Benjamin P. (Hg.): The Transatlantic Slave Trade and Slavery. New Directions in Teaching and Learning. Trenton 2013.
- Epstein, Terrie: Interpreting National History: Race, Identity, and Pedagogy in Classrooms and Communities. New York / London 2009.
Externe Links
____________________
[1] Derartige Diskussionen fallen in den Bereich einer Ethik der geschichtswissenschaftlichen Sprache. Vgl. Kühberger, Christoph / Sedmak, Clemens: Ethik der Geschichtswissenschaft. Zur Einführung. Wien 2008, S. 140ff.
[2] Dies wurde derzeit vor allem im Umfeld der Holocaust Education etabliert. Vgl. Georgi, Viola: Entliehene Erinnerung. Geschichtsbilder junger Migranten in Deutschland. Hamburg 2003.
[3] Vgl. Browne, Katarina: The Psychological Consequences of Slavery for Beneficiaries of Slavery. Implications for Classroom Teaching. In: The Transatlantic Slave Trade and Slavery. New Directions in Teaching and Learning. Hrsg. v. P. E. Lovejoy / B. P. Bowser. Trenton 2013, S. 219-244.
[4] Vgl. Walgenbach, Katharina: Intersektionalität – eine Einführung. – http://portal-intersektionalitaet.de/theoriebildung/schluesseltexte/walgenbach-einfuehrung/ (zuletzt am 11.8.2014).
[5] Lücke, Martin: Diversität und Intersektionalität als Konzepte der Geschichtsdidaktik. In: Lücke, Martin / Barricelli, Michele (Hrsg.): Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichtes. Bd. 1. Schwalbach/ Ts. 2012, S. 136-146, hier S. 139.
[6] Vgl. Singer, Alan J.: New York and Slavery. Time to Teach the Truth. New York 2008.
[7] Lücke, Diversität (wie Anm. 5), S. 139.
[8] „Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Aehnlichkeiten [sic!] des äußeren Habitus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinsamkeit hegen, derart, daß dieser für die Propagierung von Vergemeinschaftungen wichtig wird, dann, wenn sie nicht ‚Sippen‘ darstellen, ‚ethnische‘ Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine Blutsgemeinsamkeit objektiv vorliegt oder nicht.“ (M. Weber 1972). – Zitiert nach: Schnell, Rainer: Dimensionen ethnischer Identität (1990). – https://www.uni-due.de/~hq0215/documents/1990/1990_DimensionenEthnischerIdentitaet.pdf (2.7.2014) – Kritisch ablehnend: Alvir, Olja: Verlegenheitsbegriff Ethnie als Abgrenzung zu Anderen. In: Der Standard 1.2.2013. – http://dastandard.at/1358305217685/Verlegenheitsbegriff-Ethnie-als-Abrenzung-zu-Anderen (zuletzt am 2.7.2014).
[9] Z.B. die wissenschaftlich abgelehnte, aber gesellschaftlich immer wieder auftauchende „Rassentheorie“. Vgl. Taschwer, Klaus: Neuer Streit um DNA-Unterschiede zwischen „Rassen“, in: Der Standard, 12.8.2014 – online abrufbar unter: http://derstandard.at/2000004302135/Neuer-Streit-um-DNA-Unterschiede-zwischen-Rassen (zuletzt am 14.8.2014). Vgl. dazu auch die Stellungnahme von führenden Humangenetiker/innen: Letters: ‘A Troublesome Inheritance’http://cehg.stanford.edu/letter-from-population-geneticists/ (zuletzt am 14.8.2014).
____________________
Abbildungsnachweis
© Christoph Kühberger, 2014. Plakatausschnitt Gandhi-Museum, Mani Bhavan (Indien).
Empfohlene Zitierweise
Kühberger, Christoph: “Rasse” – eine notwendige Kategorie? In: Public History Weekly 2 (2014) 32, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-2520.
Copyright (c) 2014 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.
The post “Race” — a necessary category? appeared first on Public History Weekly.
Quelle: http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/2-2014-32/race-necessary-category/
 Gestern wurde dem 84. Deutschen Archivtag das Archivportal-D der Öffentlichkeit übergeben. Das im Internet unter https://www.archivportal-d.de frei zugängliche Portal ermöglicht eine umfassende und kostenlose Recherche in Deutschlands Archiven. Archivbesuche und Forschungsreisen werden damit besser planbar und können effizienter gestaltet werden.
Gestern wurde dem 84. Deutschen Archivtag das Archivportal-D der Öffentlichkeit übergeben. Das im Internet unter https://www.archivportal-d.de frei zugängliche Portal ermöglicht eine umfassende und kostenlose Recherche in Deutschlands Archiven. Archivbesuche und Forschungsreisen werden damit besser planbar und können effizienter gestaltet werden.