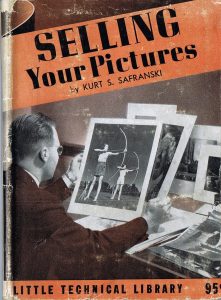Sinnfällige Metapher oder ironische Anspielung?
… diese Formulierung hat eine Freundin einmal gefunden, um die Schwierigkeiten zum Ausdruck zu bringen, die mit dem fünften der funktional-pragmatischen Felder einhergehen. Und in der Tat rühren diese Schwierigkeiten daher, dass dieses Feld noch wenig bestellt ist.
Ich habe mich an diese Formulierung erinnert, als ich letztens wieder einmal über die Beobachtungsgabe Erving Goffmans staunen musste. Sie geht freilich einher mit einer Gabe, zu schildern, was er beobachtete.
“First, there are overlayed “keyings.” The published text of a serious paper can contain passages that are not intended to be interpreted “straight,” but rather understood as sarcasm, irony, “words from another’s mouth,” and the like. However, this sort of self-removal from the literal content of what one says seems much more common in spoken papers, for there vocal cues can be employed to ensure that the boundaries and the character of the quotatively intended strip are marked off from the normally intended stream. (Which is not to say that as of now these paralinguistic markers can be satisfactorily identified, let alone transcribed.) Thus, a competent lecturer will be able to read a remark with a twinkle in his voice, or stand off from an utterance by slightly raising his vocal eyebrows. Contrariwise, when he enters a particular passage he can collapse the distance he had been maintaining, and allow his voice to resonate with feeling, conviction, and even passion. In sensing that these vocally tinted lines could not be delivered this way in print, hearers sense they have preferential access to the mind of the author, that live listening provides the kind of contact that reading doesn’t.” (Goffman 1981: 174f.)
Hier handelt es sich um einen Auszug aus Goffmans kursorischem Gang durch die Spezifika von Vorlesungen; und was er dort berührt, ist ein nicht uninteressanter Aspekt von Hochschul- und noch mehr von (interner) Wissenschaftskommunikation. Dabei kennzeichnet die Eingangspassage schon eine erste Schwierigkeit, die sich mit diesen Aspekten verbindet. Bei der Umsetzung in die Schriftlichkeit mögen Spuren der von Goffman beobachteten Aspekte noch übrig bleiben. Diese aber identifizieren zu können, gestaltet sich als äußerst voraussetzungsreiche Aufgabe.
Um was für Aspekte handelt es sich dabei aber? Und warum sind diese für mich, sprich für mein Promotionsprojekt1 eigentlich interessant?
Beginnen wir mit dem eingangs erwähnten Malfeld oder vielleicht besser mit der sog. Fünf-Felder-Lehre der Funktionalen Pragmatik: Karl Bühler (1934/1984) hat in seiner Sprachtheorie zwei sprachliche Aufgabenfelder unterschieden. Das Zeigfeld und das Symboldfeld. Das Zeigfeld betrifft die Organisation von Aufmerksamkeit. Indem mit verschiedenen Wörtern und anderen Zeighilfen in unterschiedlichen Verweisräumen gezeigt wird, wird die Aufmerksamkeit von Sprecher und Hörer synchronisiert. Ich, jetzt, hier, her, hin, da, dort, jener, dieser, du. Das sind Beispiele für deiktische Ausdrücke. Nonverbale Deixeis spielen selbstverständlich eine ebenso wichtige Rolle (vornehmlich in der Kommunikation unter Anwesenden). Das Symbolfeld betrifft den begrifflichen Haushalt einer Sprache. Symbolfeldausdrücke sind dazu in der Lage begriffliche Gehalte im Hörer zu aktualisieren oder sie veranlassen ihn dazu, in seinem Wissen danach zu suchen. Die Substantive, Adjektive und Verben bzw. ihre Stämme sind die einfachsten Beispiele für Symbolfeldausdrücke. Hören wir diese Stämme geht es nicht darum unsere Aufmerksamkeit auf etwas im Wahrnehmungs-, Rede-, Text- oder Vorstellungsraum zu richten, sondern wir aktualisieren ein begriffliches Wissen; man könnte auch sagen: einen spezifisch strukturierten Frame mit charakteristischen Anschlussstellen (siehe z.B. Busse 2012).
In Auseinandersetzung mit Bühler hat die Funktionale Pragmatik drei weitere sprachliche Aufgabenfelder ausgemacht (vgl. überblickend Ehlich 2010). Die einzelnen sprachlichen Felder benennen dabei Zweckbereiche sprachlichen Handelns unterhalb der Ebene des Sprechakts. Auf dieser Ebene sprachlichen Handelns wird davon gesprochen, dass “Prozeduren” ausgeführt werden, um spezifische Zwecke zu bearbeiten. Bspw. deiktische Prozeduren mit sprachlichen Mitteln wie ich oder hier zum Zweck der Aufmerksamkeitssynchronisation. Prozeduren sind also Handlungseinheiten, deren Zweck sie zu einem Feld zuordenbar macht. In den verschiedenen Sprachen wurden die sprachlichen Mittel, die diese fünf Aufgabenfelder bearbeiten, jeweils unterschiedlich funktionalisiert. Mit Prozeduren werden sprachliche Akte und Handlungen, also Handlungseinheiten höherer Stufe gebildet.
Die drei weiteren Felder, die die Funktionale Pragmatik unterscheidet, sind die Folgenden: das Bearbeitungsfeld, das Lenkfeld, das Malfeld. Zum Bearbeitungsfeld werden sprachliche Mittel gezählt, die das Verhältnis anderer Ausdrücke zueinander verstehbar machen (operative Prozeduren). Damit erfüllen sie eine spezifische Funktion bei der Konstitution propositionaler Gehalte aus einfachen, aneinandergereihten Ausdrücken. Zum Lenkfeld gehören sprachliche Mittel, die einen ‘direkten’ Eingriff ins hörerseitige Handeln nehmen (expeditive Prozeduren). Hörerseitige Interjektionen beispielsweise geben auf subtile aber äußerst präzise und ökonomische Art und Weise dem Sprecher einen Eindruck davon, wie sein Gesagtes verstanden wird, das er auf diese Verstehenssignale hin anpassen kann. Vokativ und Imperativ gehören ebenso in diese Kategorie.
Was leistet nun diese Kategorie der sprachlichen Prozeduren, versammelt in unterschiedlichen sprachlichen Feldern?
“Es sind nun die sprachlichen Prozeduren, die die sprachliche Realisierung von Handlungen [...] tragen, Scharniere, in denen sich die sprachlichen Funktionen, wie sie sich in den mentalen Prozessen hörerseitig niederschlagen, formal erfassen lassen und damit den bekannten linguistischen Analyse-Instrumentarien öffnen.” (Rehbein 2001: 937)
Mit der Kategorie der Prozeduren wird es also möglich die kleinsten grammatischen Strukturen handlungstheoretisch zu begreifen und zu fragen, was diese Mittel interaktional und kommunikativ leisten. Die Feldzugehörigkeit einzelner Ausdrücke und anderer sprachlicher Mittel ist nicht zwangsläufig eine einfache, d.h. einzelne Ausdrücke können durch Aspekte zweier Prozeduren bestimmt sein und in ihrer Funktionalität gerade davon abhängen. Zudem ist die Feldzugehörigkeit, also die Funktionalität (einzelner) sprachlicher Mittel historisch (und auch subkulturell) veränderlich – wie das bei Sprache immer der Fall ist.
Nun zum letzten Feld, dem Malfeld. Sprachliche Mittel dieses Feldes werden ausgeführt, um expressive Prozeduren zu realisieren. Zum Malfeld heißt es an unterschiedlichen Stellen z.B.:
“Mittels der malenden Prozedur drückt der Sprecher eine affektive Befindlichkeit aus, die er so dem Hörer kommuniziert, um eine vergleichbare Befindlichkeit bei ihm zu erzeugen.” (Ehlich 2010: 541f.)
“Abgleichung der S+H-Einschätzungen” (Ehlich 2009: 435)
“das Malfeld mit Ausdrücken zum Vollzug malender Prozeduren, d.h. im weiten Sinne zur expressiven Verbalisierung von Atmosphärischem und Emotionen, was im Deutschen vor allem durch intonatorische Modulation, kaum durch einzelne Wörter geschieht” (Redder 1998: 67)
“die expressiven Prozeduren des Malfeldes wie Imitationen, geheimnisvolle oder expressive Intonation (wie Toll!), die bei H eine Bewertung bewirken” (Rehbein 2001: 937)
“Solche Prozeduren haben es mit der Kommunikation von situativer “Atmosphäre” und psychophysischer Befindlichkeit, von Stimmung und Emotion zu tun.” (Redder 1994: 240)
Das Malfeld erweist sich in diesen Charakterisierungen wahrlich als ein weites Feld, dessen Bestimmung offenbar noch nicht präzise greifbar ist: Befindlichkeit, Einschätzung, Atmosphärisches, Emotionen, Bewertung. Das scheint mir eine äußerst heterogene Liste zu sein, die andeuten könnte, dass das Malfeld als – wie es sich bisher darstellt – Restkategorie des Subjektiven vielleicht grundlegend überdacht werden sollte.2 Dass sich das so darstellt, liegt auch daran, dass Untersuchungen dazu noch recht rar sind. Redders (1994) Analyse einer Nacherzählens stellt dazu einen ersten Schritt dar. Zu den sprachlichen Mitteln des Malfeldes schreibt sie:
“Es dominieren eindeutig Formen der Modulation. Allerdings sind auch vereinzelte lexikalische Formen verwendet, namentlich ‘ach Gott!’ [...] und das Kompositumelement ‘Riesen-’ [...]. Eine einzig syntaktisch zu nennende Form fällt auf, nämlich die rhythmische Isolierung syntaktisch ansonsten verbundener Ausdrücke [...]; ich habe sie als Parallelismus interpretiert.” (Redder 1994: 253)
Das bringt uns zurück zum obigen Zitat von Goffman, in dem er eine Reihe kommunikativer Mittel hervorhebt, mit denen bewertet, eingeschätzt, eine Befindlichkeit gegenüber dem Gesagten zum Ausdruck gebracht wird. Er beschreibt unterschiedliche intonatorische, modulatorische aber auch nonverbale Mittel der Distanzierung und der Approximation an das Gesagte. Sein Beispiel stammt selbstverständlich aus einem spezifischen Kommunikationsbereich. In der Wissenschaft besteht eine große Notwendigkeit solche Verhältnisse zum Zitierten, um das es hier ja hauptsächlich geht, herzustellen. Genauer: Es besteht essentielle Notwendigkeit eine Positionierung zum bisherigen Forschungsstand darzustellen. Und Goffman hat hier quasi die virtuosen Mittel herausgegriffen, die diesen Zweck auf äußerst subtile und differenzierte Art und Weise bearbeiten und er hat nicht einfache Formulierungsmuster im Blick, die das Zitierte oder Referierte in bestimmter Weise qualifizieren, indem dieses in Matrixsätze wie X betont zu recht, dass oder Y hat sehr treffend herausgearbeitet, dass eingebettet wird (Steinseifer 2010: 95). Das sind gewissermaßen neuralgische Punkte, an denen sich eristische Handlungen manifestieren dürften (vgl. da Silva 2014),3 da die Qualifizierung fremder Erkenntnisse für die Konturierung der eigenen Position – ich bin geneigt zu sagen: der eigenen eristischen Origo – wesentlich ist.
Wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, wir die Beherrschung der Mittel, die dem Hörer oder Leser solche Hinweise geben, mit zunehmender Sozialisation im Wissenschaftsbetrieb immer zahlreicher, immer subtiler und auch (mehrfach) adressierbar.4 Und wie Goffman zeigt, geht es dabei nicht nur um Einschätzungen des Wahrheitsgehaltes vorgängiger Forschung. Wissenschaft ist ja gewissermaßen eine Lebensentscheidung. Zwangsläufig bleiben Befindlichkeiten und Emotionen nicht aus. Fraglich ist nur, wie stark sie einerseits Eingang in die traditionellen Publikationsinfrastrukturen finden DÜRFEN und andererseits, ob sie überhaupt Eingang finden KÖNNEN in diese Verdauerung wissenschaftlicher Kommunikation. Nicht ohne Grund schreibt Goffman:
“In sensing that these vocally tinted lines could not be delivered this way in print, hearers sense they have preferential access to the mind of the author, that live listening provides the kind of contact that reading doesn’t.” (Goffman 1981: 174f.)
In der Tat sind die Mittel, die Redder (1994) herausgearbeitet hat, nicht einfach in die Schriftlichkeit überführbar, ja sie scheinen nicht einmal einfach ‘übersetzbar’ zu sein, wenn man bedenkt, welche stilistischen, ja normativen Anforderungen an den wissenschaftlichen Ausdruck geknüpft sind. Nichtsdestotrotz haben wir alle schon Texte von Kolleg_innen gelesen, die wir gut und lange kennen, mit deren Auffassungen und deren Stil wir vertraut sind. Mit diesem Hintergrundwissen meint man, Spuren malender Prozeduren in einzelnen Texten ganz sicher ausmachen zu können, man ‘hört’ den_die Autor_in und seine_ihre Befindlichkeiten gewissermaßen beim Lesen selbst sprechen. Welche Mittel das sind, die uns diesen Eindruck gewinnen lassen, ist freilich nicht so ohne Weiteres zu sagen. Ist doch schließlich auch das höchst individuell.
Das Problem linguistischer Analysen diesen Zuschnitts ist, dass sie mit zunehmendem Hintergrund-, ja mit zunehmenden Feldwissen zunehmend komplex und detailliert; aber auch zunehmend idiosynkratisch werden. Gerade für das Malfeld, das in weiten Bereichen sicherlich auf gruppenspezifisches Hintergrundwissen aufbaut oder anders: das die detaillierte Kenntnis gemeinsamer oder zumindest geteilter Kommunikationsgeschichte bedarf, um umfänglich verstanden zu werden – gerade für das Malfeld also bedeutet das, dass dessen Rekonstruktion äußerst voraussetzungsreich ist. Genauso verhält es sich mit der titelgebenden Phrase und der gewählten Illustration. Es schließt sich die Frage an, ob es sinnvoll erscheint, diese Voraussetzungen für die Analyse z.B. interner Wissenschaftskommunikation restlos einzuholen. Mir scheint nicht. Sind doch die Mitglieder der akademischen Gemeinschaft, die am Diskurs teilnehmen, i.d.R. auch nicht umfänglich über die Hintergründe verständigt, die die jeweiligen Anspielungen vielleicht nur von den Mitgliedern einer Schule oder gar nur von einer kleinen Gruppe von Kollegen lesbar werden lassen.
Die illokutiven Horizonte5, die wissenschaftliche Texte bergen, weil ihre Autor_innen damit befasst sind, kontinuierlich, konkurrenziell und kooperativ um die Wahrheit zu ringen, sind also mit unterschiedlichen Wissenshintergründen auch unterschiedlich tief zu erschließen. Selbiges kennzeichnet aber auch die Situation des durchschnittlichen Wissenschaftlers, was diese hermeneutische Herausforderung nicht zu einem Spezifikum der Forschungssituation macht, sondern auch die alltägliche Situation der Akteure selbst kennzeichnet.
Literatur
Bühler, Karl (1982): Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Ungekürzter Nachdruck der Ausgabe von 1934. Stuttgart: Gustav Fischer.
Busse, Dietrich (2012): Frame-Semantik. Ein Kompendium. Berlin, Boston: De Gruyter.
Ehlich, Konrad (2009): Interjektion und Responsiv. In: Hoffmann, Ludger (Hg.): Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin, New York: De Gruyter, S. 423–444.
Ehlich, Konrad (2010): Prozedur. In: Glück, Helmut (Hg.): Metzler-Lexikon Sprache. 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler, S. 541–542.
Goffman, Erving (1981): The Lecture. In: Erving Goffman: Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, S. 160–196.
Pohl, Thorsten (2007): Studien zur Ontogenese wissenschaftlichen Schreibens. Tübingen: Niemeyer.
Redder, Angelika (1994): “Bergungsunternehmen” – Prozeduren des Malfeldes beim Erzählen. In: Brünner, Gisela/Graefen, Gabriele (Hg.): Texte und Diskurse. Methoden und Forschungsergebnisse der funktionalen Pragmatik. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 238–264.
Redder, Angelika (1998): Sprachbewusstsein als handlungspraktisches Bewusstsein – eine funktional-pragmatische Diskussion. In: Didaktik Deutsch 3 (5), S. 60–76.
Rehbein, Jochen (2001): Das Konzept der Diskursanalyse. In: Brinker, Klaus/Antos, Gerd/Heinemann, Wolfgang/Sager, Sven F. (Hg.): Text- und Gesprächslinguistik. Linguistics of Text and Conversation. Berlin, New York: De Gruyter (HSK, 16.2), S. 927–945.
Silva, Ana da (2014): Wissenschaftliche Streitkulturen im Vergleich. Eristische Strukturen in italienischen und deutschen wissenschaftlichen Artikeln. Heidelberg: Synchron.
- Wobei ich betonen möchte, dass ich nicht nur aus Promotionsprojekt bestehe! ;-)
- Überdacht vor allem deswegen, weil die expressiven Prozeduren, im Vergleich zu allen anderen Prozeduren, gewissermaßen omnipräsent sind. D.h. es muss angenommen werden, dass Ausprägungen expressiver Prozeduren überall und immer in unterschiedlicher Markiertheit vorhanden sein müssen, da immer eine Befindlichkeit, Stimmung, Emotionalität in verschiedenen Graden rekonstruiert werden kann. Ein Anschluss an die Diskussionen der linguistischen Stilistik (z.B. die Arbeiten von Fix oder Sandig) erschiene hier sinnvoll.
- Ich bin gerade über Ana da Silvas (2014) Dissertation. Sie ist ganz frisch erschienen und ich freue mich schon auf ihre Analysen.
- Pohl (2007) scheint mir zum Thema der Ontogenese wissenschaftlicher Schreibfähigkeit äußerst reichhaltig und ertragreich zu sein. Dem muss ich bei Gelegenheit noch mehr Aufmerksamkeit widmen.
- Ana da Silva (vgl. 2014: 45f.) spricht von ‘illokutiven Strata’.
Quelle: http://metablock.hypotheses.org/645