Axel Beer: Rezension zu: Böning, Holger: Der Musiker und Komponist Johann Mattheson als Hamburger Publizist. Studie zu den Anfängen der Moralischen Wochenschriften und der deutschen Musikpublizistik. Bremen 2011, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/20013.html
Steffen Hölscher: Rezension zu: Bronisch, Johannes: Der Mäzen der Aufklärung. Ernst Christoph von Manteuffel und das Netzwerk des Wolffianismus. Berlin 2010, in: H-Soz-u-Kult, 22.11.2011
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-132
Werner Schiedermair: Rezension zu: Brugger, Walter / Dopsch, Heinz / Wild, Joachim (Hrsg.): Herrenchiemsee. Kloster – Chorherrenstift – Königsschloss. Regensburg 2011, in: ZLBG, 14.11.2011
http://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/rezension_2066.html
Thomas Nicklas: Rezension zu: Brunert, Maria-Elisabeth / Lanzinner, Maximilian (Hrsg.): Diplomatie, Medien, Rezeption. Aus der editorischen Arbeit an den ‘Acta Pacis Westphalicae’. Münster 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/19033.html
Michael V. Leggiere: Rezension zu: Chickering, Roger / Förster, Stig (Hrsg.): War in an Age of Revolution, 1775-1815. Cambridge 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/18138.html
Axel Gotthard: Rezension zu: Coy, Jason Philip / Marschke, Benjamin / Sabean, David Warren (Hrsg.): The Holy Roman Empire, Reconsidered. Oxford 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/18040.html
Daniela Hacke: Rezension zu: Domröse, Sonja: Frauen der Reformationszeit. Gelehrt, mutig und glaubensfest. Göttingen 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/18688.html
Anja Werner geb. Becker: Rezension zu: Dubois, Laurent / Scott, Julius S. (Hrsg.): Origins of the Black Atlantic. New York 2010, in: H-Soz-u-Kult, 08.11.2011
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-094
Anja Golebiowski: Rezension zu: Ebert, Christa: Literatur in Osteuropa. Russland und Polen. Berlin 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/20771.html
Tobias Daniels: Rezension zu: Fasano Guarini, Elena: Repubbliche e principi. Istituzioni e pratiche di potere nella Toscana granducale del ’500 – ’600. Bologna 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/18847.html
Sebastian Becker: Rezension zu: Fröhlich, Martin: Mysterium Venedig. Die Markusrepublik als politisches Argument in der Neuzeit. Bern / Frankfurt a.M. [u.a.] 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/20019.html
Johannes Laschinger: Rezension zu: Heigl, Armin: Cuius regio, eius religio? Vom Versuch die Oberpfälzer zu Calvinisten zu machen. Regensburg 2009, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/17801.html
Katja Hillebrand: Rezension zu: Herzog, Markwart / Weigl, Huberta (Hrsg.): Mitteleuropäische Klöster der Barockzeit. Vergegenwärtigung monastischer Vergangenheit in Wort und Bild. Konstanz 2011, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/16639.html
Verena Steller: Rezension zu: Hyam, Ronald: Understanding the British Empire. Cambridge 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/18119.html
Helmut Zedelmaier: Rezension zu: Jaumann, Herbert (Hrsg.): Diskurse der Gelehrtenkultur in der Frühen Neuzeit. Ein Handbuch. Berlin 2011, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/19118.html
Katja Bernhardt: Rezension zu: Johannes, Ralph (Hrsg.): Entwerfen. Architektenausbildung in Europa von Vitruv bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Geschichte – Theorie – Praxis. Hamburg 2009, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/17565.html
Christian Kühner: Rezension zu: Kane, Brendan: The Politics and Culture of Honour in Britain and Ireland, 1541-1641. Cambridge 2010, in: H-Soz-u-Kult, 01.11.2011
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-078
Derek Beales: Rezension zu: Karstens, Simon: Lehrer – Schriftsteller – Staatsreformer. Die Karriere des Joseph von Sonnenfels (1733-1817). Wien 2011, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/20417.html
Malte Griesse: Rezension zu: Kümin, Beat / Scott, James C. (Hrsg.): Political Space in Pre-industrial Europe. Aldershot 2009, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/16597.html
Erich Schneider: Rezension zu: Kummer, Stefan: Kunstgeschichte der Stadt Würzburg 800-1945. Regensburg 2011, in: ZLBG, 17.11.2011
http://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/rezension_2063.html
Herbert Jaumann: Rezension zu: Lefebvre, Armelle (Hrsg.): Comparaisons, raisons, raisons d’État. Les Politiques de la république des lettres au tournant du XVIIe siècle. München 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/18735.html
Philipp Lenhard: Rezension zu: Lindemann, Albert S. / Levy, Richard S. (Hrsg.): Antisemitism. A History. Oxford 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/19942.html
Stefanie Walther: Rezension zu: Lundt, Bea: Europas Aufbruch in die Neuzeit 1500-1800. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Darmstadt 2009, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/15850.html
Anja Werner geb. Becker: Rezension zu: Mamigonian, Beatriz G. / Racine, Karen (Hrsg.): The Human Tradition in the Black Atlantic, 1500-2000. Lanham 2010, in: H-Soz-u-Kult, 08.11.2011
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-094
Peter Mario Kreuter: Rezension zu: Mitev, Plamen / Parvev, Ivan / Racheva, Vania u.a. (Hrsg.): Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. Münster / Hamburg / Berlin / London 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/19122.html
Janine Rischke: Rezension zu: Nowosadtko, Jutta: Stehendes Heer im Ständestaat. Das Zusammenleben von Militär- und Zivilbevölkerung im Fürstbistum Münster 1650-1803. Paderborn 2011, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/15353.html
Erich Schneider: Rezension zu: Öhm, Ulrike: Die Würzburger “Tiepolo-Skizzenbücher”. Die Zeichnungsalben WS 134, 135 und 136 im Martin-von-Wagner-Museum der Universität Würzburg (Bestandskataloge der Graphischen Sammlung des Martin-von-Wagner-Museums der Universität Würzburg 2). Weimar 2009, in: ZBLG, 17.11.2011
http://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/rezension_2077.html
Carl Antonius Lemke Duque: Rezension zu: Pasamar, Gonzalo: Apologia and Criticism. Historians and the History of Spain, 1500-2000. Oxfordshire 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/20018.html
Ronald G. Asch: Rezension zu: Questier, Michael (Hrsg.): Stuart Dynastic Policy and Religious Politics, 1621-1625. Cambridge 2009, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
URL: http://www.sehepunkte.de/2011/11/18645.html
Anja Werner geb. Becker: Rezension zu: Racine, Karen / Mamigonian, Beatriz G. (Hrsg.): The Human Tradition in the Atlantic World, 1500-1850. Lanham 2010, in: H-Soz-u-Kult, 08.11.2011
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-094
Sascha Weber: Rezension zu: Reed, Terence James: Mehr Licht in Deutschland. Eine kleine Geschichte der Aufklärung. München 2009, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/16278.html
Wolfgang E. J. Weber: Rezension zu: Richter, Susan: Fürstentestamente der Frühen Neuzeit. Politische Programme und Medien intergenerationeller Kommunikation. Göttingen 2009, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/16182.html
Roman Deutinger: Rezension zu: Seufert, Ingo (Bearb.): Die Inschriften der Stadt Freising (Die Deutschen Inschriften 69 = Münchener Reihe 12). Wiesbaden 2010, in: ZBLG, 08.11.2011
http://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/rezension_2037.html
Sue Peabody: Rezension zu: Schmieder, Ulrike / Füllberg-Stolberg, Katja / Zeuske, Michael (Hrsg.): The End of Slavery in Africa and the Americas. A Comparative Approach. Berlin 2011, in: H-Soz-u-Kult, 25.11.2011,
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-144
Matthias Schnettger: Neuere Publikationen zur Hofforschung (Rezension), in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/18690.html
Stefan Laube: Rezension zu: Thums, Barbara / Werberger, Annette (Hrsg.): Was übrig bleibt. Von Resten, Residuen und Relikten. Berlin 2009, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/15463.html
Peter Schuster: Rezension zu: Tlusty, B. Ann: The Martial Ethic in Early Modern Germany. Civic Duty and the Right of Arms. Basingstoke 2011, in: H-Soz-u-Kult, 05.12.2011
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-167
Lisa Klewitz: Rezension zu: Veltmann, Claus / Birkenmeier, Jochen (Hrsg.): Kinder, Krätze, Karitas. Waisenhäuser in der Frühen Neuzeit. Katalog zur Jahresausstellung der Franckeschen Stiftungen vom 17. Mai 2009 bis 4. Oktober 2009. Halle 2009, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/16475.html
Caecilie Weissert: Rezension zu: Vermeulen, Ingrid Renée: Picturing Art History. The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century. Amsterdam 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/19231.html
Holger Kürbis: Rezension zu: Walther, Stefanie: Die (Un-)Ordnung der Ehe. Normen und Praxis ernestinischer Fürstenehen in der Frühen Neuzeit. München 2011, in: H-Soz-u-Kult, 18.11.2011
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-125
Wolfgang Wüst: Rezension zu: Weber, Christoph: Episcopus et Princeps. Italienische Bischöfe als Fürsten, Grafen und Barone vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Bruxelles u.a. 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/19098.html
Johannes Myssok: Rezension zu: Wren Christian, Kathleen / Drogin, David J. (Hrsg.): Patronage and Italian Renaissance Sculpture. Aldershot 2010, in: sehepunkte 11 (2011), Nr. 11, 15.11.2011
http://www.sehepunkte.de/2011/11/19237.html
Ernst Schütz: Rezension zu: Zunker, Maria Magdalena: Geschichte der Benediktinerinnenabtei St. Walburg in Eichstätt von 1035 bis heute. Lindenberg 2009, in: ZLBG, 14.11.2011
http://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/rezension_1744.html
Quelle: http://frueheneuzeit.hypotheses.org/892
 Die Prozesse gegen Mauerschützen, gegen die Befehlshaber von Grenztruppen und gegen Mitglieder des Politbüros gelten als abgeschlossen. Zeit für eine Bilanz, Zeit für ein Gespräch über die Möglichkeiten, Verstöße gegen Menschenrechte über Rechtssysteme hinweg strafrechtlich zu verfolgen. Rainer Schröder, Professor für Rechtsgeschichte an der Humboldt-Universität, erörtert im MONTAGSRADIO Nr. 19/2011 die Aufarbeitung von geschehenem Unrecht mit den Mitteln des Rechtsstaats.
Die Prozesse gegen Mauerschützen, gegen die Befehlshaber von Grenztruppen und gegen Mitglieder des Politbüros gelten als abgeschlossen. Zeit für eine Bilanz, Zeit für ein Gespräch über die Möglichkeiten, Verstöße gegen Menschenrechte über Rechtssysteme hinweg strafrechtlich zu verfolgen. Rainer Schröder, Professor für Rechtsgeschichte an der Humboldt-Universität, erörtert im MONTAGSRADIO Nr. 19/2011 die Aufarbeitung von geschehenem Unrecht mit den Mitteln des Rechtsstaats. Dass die Rede vom “Unrechtsstaat” keine Floskel bleibt, belegen die Gerichtsprozesse, die nach dem Ende der DDR gegen begangenes Unrecht geführt wurden. Insbesondere jene Verbrechen, die den Tod von Flüchtlingen an der Mauer bzw. der innerdeutschen Grenze zur Folge hatten, standen im Fokus der Justiz und der Öffentlichkeit. Nicht zuletzt Egon Krenz wurde wegen der Todesopfer an der Mauer und der deutsch-deutschen Grenze zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Über Strafmaße und den Sinn von Strafe, über symbolische Urteile und die Frage nach Gerechtigkeit, über Wege der strafrechtlichen Aufarbeitung und die Grenzen des Rechtsstaats, über Menschenrechtsverletzungen und die Möglichkeiten sie nachträglich zu verurteilen, sprechen Markus Heidmeier und Jochen Thermann mit Prof. Dr. Rainer Schröder in dieser Ausgabe des Montagsradios.
Dass die Rede vom “Unrechtsstaat” keine Floskel bleibt, belegen die Gerichtsprozesse, die nach dem Ende der DDR gegen begangenes Unrecht geführt wurden. Insbesondere jene Verbrechen, die den Tod von Flüchtlingen an der Mauer bzw. der innerdeutschen Grenze zur Folge hatten, standen im Fokus der Justiz und der Öffentlichkeit. Nicht zuletzt Egon Krenz wurde wegen der Todesopfer an der Mauer und der deutsch-deutschen Grenze zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Über Strafmaße und den Sinn von Strafe, über symbolische Urteile und die Frage nach Gerechtigkeit, über Wege der strafrechtlichen Aufarbeitung und die Grenzen des Rechtsstaats, über Menschenrechtsverletzungen und die Möglichkeiten sie nachträglich zu verurteilen, sprechen Markus Heidmeier und Jochen Thermann mit Prof. Dr. Rainer Schröder in dieser Ausgabe des Montagsradios.




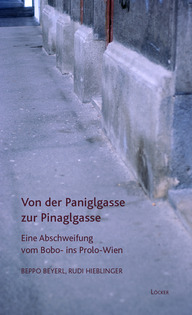 Ein sehr schönes Wien-Buch ist der letztes Jahr bei Löcker erschienene, von Beppo Beyerl -
Ein sehr schönes Wien-Buch ist der letztes Jahr bei Löcker erschienene, von Beppo Beyerl - 