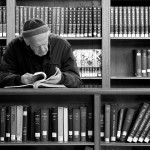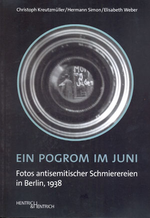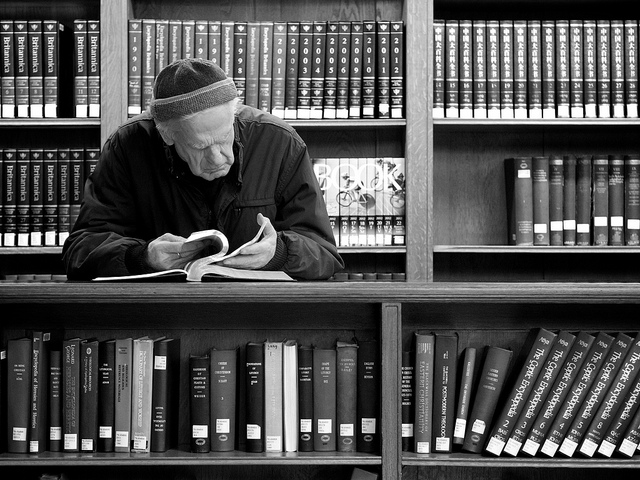Wissenschaftsblogs geben Auskunft darüber, welches Verständnis von Wissenschaft die Bloggenden haben und wie sie sich im Wissenschaftsbetrieb verorten((1)). Denn durch Blogs entstehen neue wissenschaftliche Publikations- und Kommunikationspraktiken, die bisherige Formate und Standards von Wissenschaftlichkeit und damit unsere Forschungskultur insgesamt in Frage stellen. Wenn das Medium die Botschaft ist, wie es der Medientheoretiker Marshall McLuhan formulierte, dann zeigen bloggende Forscherinnen und Forscher, wie sie sich Wissenschaft vorstellen oder wünschen: offen, vernetzt, horizontal, direkt, schnell, vielseitig… und mit der akzeptierten Möglichkeit, sich zu irren.
Wissenschaftsblogs geben Auskunft darüber, welches Verständnis von Wissenschaft die Bloggenden haben und wie sie sich im Wissenschaftsbetrieb verorten((1)). Denn durch Blogs entstehen neue wissenschaftliche Publikations- und Kommunikationspraktiken, die bisherige Formate und Standards von Wissenschaftlichkeit und damit unsere Forschungskultur insgesamt in Frage stellen. Wenn das Medium die Botschaft ist, wie es der Medientheoretiker Marshall McLuhan formulierte, dann zeigen bloggende Forscherinnen und Forscher, wie sie sich Wissenschaft vorstellen oder wünschen: offen, vernetzt, horizontal, direkt, schnell, vielseitig… und mit der akzeptierten Möglichkeit, sich zu irren.
Zentral für die Bloggenden ist die Frage des return of investment bei dieser selbstbestimmten Aneignung eines Publikationsorts, denn Bloggen, Blogs lesen und in Blogs kommentieren kostet Zeit((2)). Und die ist bei allen knapp. Vieles steht und fällt dabei mit der Anerkennung dieser (neuen) Praktik als “wissenschaftlich”. Wie weit sollen bestehende Konzepte von Wissenschaftlichkeit ausgedehnt werden? Können Blogposts oder Tweets Teil der anerkannten Wissenschaftsproduktion sein? Brauchen wir dafür eine Qualitätssicherung?((3)) Wenn ja: Wie könnte sie aussehen? Und tut sich die Wissenschaftsblogosphäre überhaupt einen Gefallen, wenn sie auf diese Fragen Antworten gibt und das Schreiben in Blogs Regeln auferlegt, wo es doch in vielerlei Hinsicht gerade eine Befreiung von normierten Textformaten und deren langsamen und bisweilen arbiträren Publikationsverfahren darstellt?
Meine eigene Vision vom Wissenschaftsbloggen wird hier in Form von Aufrufen an die geisteswissenschaftliche Blogcommunity verdeutlicht, die gleichzeitig mögliche Themenfelder für die Blogparade #wbhyp abstecken. Sie beruht auf den Beobachtungen und Thesen, dass:
1) Blogbeiträge – zumindest in naher Zukunft - nicht allgemein als wissenschaftliche Leistung anerkannt werden,
2) sich ein Kampf um diese Anerkennung nicht lohnt, wenn damit einher geht, dass man die Besonderheiten des Genres abschleifen muss,
3) folglich eine Besinnung darauf notwendig ist, was Bloggen eigentlich ausmacht, auf das Neue und Besondere daran, was andere Formate nicht hergeben, und
4) es (immer wieder neu) herauszufinden gilt, warum sich Bloggen trotzdem lohnt.
Aufruf 1: Gegen Definitionen: die Vielfalt ist eine Stärke der Blogs
Ein Blick auf bestehende Wissenschaftsblogs - nicht nur auf unserer Plattform - zeigt die große Vielfalt und Uneindeutigkeit der Blogpraktiken, die ich für eine Stärke halte, die aber in unserer Wissenschaftskultur als Schwäche ausgelegt wird: Stichwort “Basar” (=Blog) gegen “Kathedrale” (=Zeitschrift)((4)). Denn Blogs sind in den allermeisten Fällen Selbstpublikationen ohne vorgeschaltete Qualitätskontrolle. Ihre Vielfalt spiegelt daher die Unterschiedlichkeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und deren jeweilige Vorstellung von „Wissenschaft“ wider. Sie zeigt, dass sich die wissenschaftliche Schreibpraxis nicht auf genormte Peer-Review-Artikel reduzieren lässt.
Die Wissenschaftscommunity tut sich mit einengenden Definitionen und Versuchen, das Wissenschaftsbloggen zu normieren und anderen Publikationsformaten anzupassen, keinen Gefallen, wenn die Besonderheiten des Bloggens, deren Schwerpunkte jeder für sich selbst legen mag, abgeschliffen werden. Statt zu betonen, was Blogs alles „auch“ können, sollten wir uns darauf konzentrieren, was (bisher) ausschließlich Blogs können bzw. in Blogs gemacht wird.
Aufruf 2: Vergesst die wissenschaftliche Anerkennung von Blogs!
de.hypotheses ist als Blogportal angetreten, Antworten auf die gängigen Vorurteile und Bedenken gegenüber dem Wissenschaftsbloggen zu liefern, nämlich Fragen der Sichtbarkeit/Auffindbarkeit, Qualität, Archivierung und Zitierbarkeit von Blogs: Das Portal ist ein zentraler Einstieg, nur themenzentrierte Blogs von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern werden aufgenommen, die Blogs werden archiviert. Mit der Plattform und den damit verbundenen Services wie Schulungen, technischer Support sowie Beratung und Aufklärung über Open Access, Creative-Commons-Lizenzen, das Ausfüllen eines Impressums, den Anforderungen für eine ISSN sowie erklärenden Beiträgen im Bloghaus und im Redaktionsblog - wie z.B. die Serie “Blog&Recht” von Klaus Graf in Archivalia - haben Redaktion und Community Management viel dafür getan, um eine anerkannte Umgebung für das Wissenschaftsbloggen zu bilden und Bloggen in der wissenschaftlichen Praxis zu etablieren und zu professionalisieren.
Das soll aber nicht heißen, dass auch die Inhalte der Blogs, das also, was jede oder jeder Einzelne aus ihrem oder seinem Blog macht, vereinheitlicht oder professionalisiert werden sollen (was auch immer das heißen mag). Denn selbst wenn man vereinheitlichen würde: Solange Blogs ein Ort der Selbstpublikation bleiben, wird sich an der fehlenden Anerkennung als wissenschaftliche Publikation, gleichgestellt mit Beiträgen in Zeitschriften mit Herausgebergremien oder Peer-Review-Verfahren, nichts ändern, so ungerecht das im Einzelnen sein mag.
Aufruf 3: Wissenschaftsblogs sind andere Formate: nutzt sie aus!
Blogs, so wie sie hier verstanden werden, sind keine Zeitschriften, keine Sammelbände und keine Monographien und sie sollen es aus meiner Sicht auch nicht sein. Sie stellen ein eigenes Format dar, das seine Berechtigung im Wissenschaftsprozess hat, als Praktik des Austauschs und der wissenschaftlichen Kommunikation, angesiedelt zwischen einem lockeren mündlichen Gespräch und der rigideren Form eines wissenschaftlichen Aufsatzes für ein Journal. Ein "missing link"((5)) .
Einblicke in die laufende Forschung geben zu können, sowie die Möglichkeit, einzelne kleinere Aspekte zu zeigen, ungewöhnliche Themen aufzugreifen, die man in Zeitschriften nicht unterbringen kann oder will((6)), andere Medienformate einzusetzen (Bilder, Hyperlinks, Podcasts, Videos etc. so viele man möchte ohne die Beschränkung, die man in Print-Medien erfährt), geistreiche, übermütige Essays in Ich-Form zu schreiben, vielleicht mit Smileys und Strikes 
, lange Beiträge neben kurzen, in einem Monat viel, im nächsten wenig zu publizieren, schnell publizieren zu können, in Kommentaren in einen Dialog zu treten…, machen das Besondere, die Freiheit, den Spaß am Wissenschaftsbloggen aus.
In der Praxis lässt sich aber eine Annäherung der Formate beobachten: Mailinglisten posten ihre Ankündigungen in Blogs, BlogJournals wie Public History Weekly entstehen etc. Sicherlich haben ankündigungslastige Themen-, Instituts- und Tagungsblogs als Service-Dienstleistung und thematische Sammlungen ihre Berechtigung. Viele Forschende dürften über sie mit dem Wort und Phänomen “Blog” überhaupt das erste Mal in Berührung kommen. Doch mit Bloggen im ursprünglichen Sinn hat das wenig zu tun. Ich wünsche mir daher mehr forschungszentrierte Themenblogs, in denen das Forschungsthema und das eigene wissenschaftliche Tun reflektiert werden. Das muss nicht immer in regelrechten Forschungsbeiträgen geschehen. Aber weniger Ankündigungen, mehr Reflexion, mehr Kreativität, mehr Witz, mehr Zweifel, mehr Sackgassen wären schön. Mehr Kommentare außerdem. Fromme Wünsche?
Aufruf 4: Herausfinden, warum es sich trotzdem lohnt
Es gibt gute Gründe, jenseits der formalen Anerkennung von Blogposts als wissenschaftlicher Output, zu bloggen. Denn ein Blog erfüllt nicht nur dann einen return of investment, wenn die Publikationen für Berufungs- und andere Verfahren anerkannt werden und Einladungen zu Tagungen, Beiträgen oder Stellenangebote folgen. Leider werden die „weichen“ Gründe für das Bloggen, wie das Klären von Gedanken, das Schreiben üben, das Vorwärtskommen im dialogischen Wissenschaftsprozess, das Sich-Vernetzen etc. erst durch eigene Erfahrung einsichtig. Das Erfahrungswissen anderer ist in Diskussionen oftmals wenig überzeugend, da das Totschlagargument „Zeitmangel“ übermächtig ist. Ich würde mir wünschen, dass Beiträge der Blogparade die guten Gründe für das Wissenschaftsbloggen, die es ja sehr zahlreich gibt, aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenfassen.
Kuratierverfahren, wie sie de.hypotheses und andere über die Auswahl von Beiträgen für die Startseite oder den Slider vollziehen, sind wichtig. Sie sorgen für Sichtbarkeit und helfen dem Einzelnen beim Filtern, machen aber aus einem Blogbeitrag keine Peer-Review-Veröffentlichung und damit zu einer jener wissenschaftlichen Leistungen, die etwa bei Einstellungsverfahren zählen. Eine Möglichkeit um diese Anerkennung zu schaffen ist der Einsatz von Open-Peer-Review-Verfahren. Damit können einzelne Blogbeiträge ausgewählt, zu Artikeln ausgearbeitet und „veredelt“ werden. Die überarbeiteten Fassungen werden online sowie in Print veröffentlicht. OpenEdition möchte ein solches Verfahren gemeinsam mit Perspectivia.net ausprobieren. Voraussetzung ist die Bereitschaft der Community, bei solchen Verfahren mitzumachen.
Gleichwohl bliebe das gros der Blogposts ohne Anerkennung durch den Wissenschaftsbetrieb. Doch wäre das so schlimm? Ich meine nein, aus den genannten Gründen, und weil es uns mit de.hypotheses gelungen ist, eine “Community of practice”((7)) aufzubauen, die neben der Erkenntnis, dass man nicht alleine ist, als Beleg dafür stehen kann, dass der wissenschaftliche Austausch in Blogs seine Berechtigung hat.
______
Beitrag zur Blogparade: Wissenschaftsbloggen: zurück in die Zukunft - ein Aufruf zur Blogparade #wbhyp
Abbildung: Kite by Mario, CC BY-NC 2.0.
- Die ersten beiden Absätze sind in Teilen ein Eigenplagiat meines sich im Druck befindlichen Aufsatzes: Herausforderung für unsere Wissenschaftskultur: Weblogs in den Geisteswissenschaften, in: Wolfgang Schmale, Digital Humanities - Zukunftsperspektiven, Beiheft zu den HMRG, 2015.
- Vgl. z.B. Monika Lehner, 走為上策 *, in: mind the gap(s), 17.12.2014, http://mindthegaps.hypotheses.org/1945.
- Vgl. Klaus Graf, Qualität wird überschätzt, in: Digitale Geschichtswissenschaft, 30.9.2014, http://digigw.hypotheses.org/1063.
- Vgl. Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar: musings on Linux and open source by an accidental revolutionary, Cambridge 2001; siehe dazu den Eintrag in Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kathedrale_und_der_Basar
- Vgl. Arthur Charpentier, Blogging in Academia, A Personal Experience, in: Social Science Research Network, 18.2.2014, http://ssrn.com/abstract=2398377 oder http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2398377.
- Vgl. Maxi Maria Platz, in: 1 Jahr MinusEinsEbene auf de.hypotheses, in: MinusEinsEbene, 10.10.2013, http://minuseinsebene.hypotheses.org/849; Monika Lehner, Wissenschaftliches Bloggen im SWOT-Check, in: Mind the gap(s), 13.11.2014, http://mindthegaps.hypotheses.org/1869.
- Vgl. Etienne Wenger, Communities of Practice, Cambridge 1998.
Quelle: http://redaktionsblog.hypotheses.org/2674