Das englische Adjektiv „multidirectional“ ist ein ziemlich technischer Begriff. Auf gut Deutsch bedeutet er „Mehrrichtungs-“ oder „Mehrwegs-“ und als erstes kommt einem da die Mehrwegflasche in den Sinn. Der amerikanische Literaturwissenschaftler Michael Rothberg hat „multidirectional“ trotzdem auf Kultur angewandt. „Multidirectional Memory“ ist ein Versuch, Erinnerungskultur in mehrere Richtungen, sozusagen gegen den Strich, zu denken. Damit stellt „Multidirectional Memory“ ein Modell vor, das eine interdisziplinäre und transnationale Untersuchung von Erinnerungskultur stützt.
Erinnerungskultur, oder „memory“ – wie man im Englischen sagt, verarbeitet individuelle Erfahrungen kulturell zu Sinn und macht sie dadurch verständlich und bedeutsam (Kantsteiner 2002:189). Rothberg verwendet „memory” als Begriff für die soziale Praxis des Erinnerns. Es geht ihm um den Prozess des Wachrufens und Verdrängens, des Aktivierens und Blockierens von Erfahrungen.
Heute wird Erinnerungskultur häufig in den Kategorien „Opfer“ und „Täter“ gedacht (Vgl. Buruma 1999; Jureit / Schneider 2010; Schulze Wessel / Franzen 2012). „Opfer“ und „Täter“ sind dabei zu kollektiven und identitätsstiftenden Zuschreibungen geworden.
Rothbergs Ausgangsfrage lautete: Wie lässt sich die Beziehung zwischen verschiedenen Opfergeschichten neu erörtern?
Auf die Gedenkjubiläen im Jahr 2015 bezogen, könnte die Frage lauten: Welche Rolle spielt die Erinnerung an den Holocaust heute für die Erinnerung an den Genozid an den Armeniern? Oder welche Rolle spielt die aktuelle Verfolgung und Vernichtung der Jesiden aus dem Irak für die Erinnerung an den Genozid in Bosnien vor 20 Jahren?
Rothberg hat theoretische und literarische Arbeiten seit den 50er und 60er Jahren analysiert, die sowohl die Vernichtung der europäischen Juden als auch die Verbrechen während der Entkolonialisierung gleichzeitig verhandeln. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Annahme eines Wettbewerbs zwischen verschiedenen Opfergeschichten analytisch wenig gewinnbringend sei: “Against the framework that understands collective memory as competitive memory – as a zero-sum struggle over scarce resources – I suggest that we consider memory as multidirectional: as subject to ongoing negotiation, cross-referencing, and borrowing; as productive and not private.” (Rothberg 2009:3).
Die Annahme also, dass es einen Kampf der Erinnerungen gäbe, die um öffentliche Dominanz ringen, sollte hinterfragt werden. Denn dieser Annahme liegt die Überzeugung zugrunde, dass eine bestimmte Gruppe eine einzigartige Geschichte, Kultur und Identität habe. Nimmt man jedoch die Parallelen, Bezüge und Ähnlichkeiten zwischen unterschiedlichen kollektiven Opfergeschichten in den Blick, so wird deutlich, dass ein exklusives Verständnis von kultureller Identität schwer haltbar ist. Mit einer derartigen Betonung der Interaktionen zwischen den Erinnerungsprozessen divergierender Gruppen trägt Rothberg dem Denken Rechnung, dass Gedächtnis und Identität keine klar umrissenen Gegebenheiten sind, sondern sich wandelnde, komplexe und immer wieder auch in Frage zu stellende kulturelle Phänomene bedeuten.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Rothberg verneint nicht die Existenz von Opferkonkurrenzen, sondern er weist auf die Notwendigkeit hin diese zu hinterfragen. Dafür entwickelt er ein dem Konkurrenzdenken gegenläufiges Modell: nämlich die Gemeinsamkeiten und Bezugnahmen zwischen verschiedenen kollektiven Opfergeschichten zu untersuchen.
Rothberg schlägt vor, die weltweite Erinnerung an den Holocaust als etwas zu verstehen, das andere Opfergeschichten nicht blockiert, sondern ihrer Artikulation dient. Dabei funktioniere die Bezugnahme der Geschichten jenseits ihrer zeitlichen und räumlichen Verortung – „multidirectional“. Ereignisse, die vor dem Holocaust stattgefunden haben, wie beispielsweise der Genozid an den Armeniern, oder auch danach, wie der Genozid in Bosnien und Herzegowina, werden mit Referenz aufeinander öffentlich erinnert.
Dabei geht es nicht darum, historische Ausmaße, Kontexte und Folgen in ihrer Faktizität zu vergleichen, sondern um den Akt der gegenwärtigen öffentlichen Artikulation. Es geht darum, dass etwas sagbar wird und zwar öffentlich, also kollektiv mitteilbar. Letztlich zielt diese öffentliche Artikulation der Opfergeschichten auf die kollektive Anerkennung des Leidens. Durch die Bezugnahme auf andere Opfergeschichten kann die Artikulation gestärkt werden.
Mit „multidirectional“ meint Rothberg aber auch, die Verbindungen zwischen der Benennung gegenwärtig stattfindender Missetaten und historischer Verbrechen zu reflektieren. Dies veranschaulicht er, indem er die Gleichzeitigkeit der Entkolonialisierung mit dem Aufkommen einer öffentlichen Holocaust-Erinnerung in den Blick nimmt. Während der Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem stattfand und die öffentliche Artikulation der Geschichten von Holocaust-Überlebenden förderte, tobte in Algerien der Unabhängigkeitskrieg mit der französischen Kolonialmacht. Rothberg setzt sich mit verschiedenen Beispielen auseinander, die zu jener Zeit Folter, Staatsterror und Vernichtung in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und während des Algerienkriegs behandeln. Die gerade stattfindende Gewalt und der Rassismus beeinflusste, insbesondere in Frankreich, die aufkommende öffentliche Erinnerung an vergangene extreme Gewalt und Ausgrenzung (Rothberg 2009:192).
Dass bei Rothberg die Entkolonialisierung im Zusammenhang mit der öffentlichen Thematisierung des Holocausts gedeutet wird, muss hier deswegen betont werden, weil etwa Aleida Assmann bereits in ihrer Auseinandersetzung mit Levy / Snayder 2007 vorgeschlagen hatte, die Holocaust-Erinnerung als ein Paradigma zu begreifen, auf welches sich andere Genozide und Traumata beziehen (Assmann 2007:14). Die umgekehrte Denkrichtung jedoch, also dass auch andere Verbrechen die Artikulation des Holocaust beeinflussen können, macht diesen Vorgang erst „multidirectional”.
Eine weitere Dimension der „Mehrseitigkeit“ von Erinnerungsprozessen unterfüttert Rothberg theoretisch, indem er sich auf Sigmund Freuds psychoanalytischen Begriff der „Deckerinnerung“ bezieht (Freud 1907). Freuds „Deckerinnerung“ beschreibt einen Vorgang, bei dem etwas Banales, Alltägliches im Detail erinnert wird und zwar um etwas Singuläres, Schwerwiegendes zu überdecken. Es geht darum, wie Erinnerung auch dazu verwendet werden kann, um etwas anderes zu verdrängen. Erinnern um zu vergessen, könnte man salopp formulieren.
Obwohl Rothberg kritisiert, dass Freuds Erkenntnisse aus der Individualpsychologie schwer auf Kollektive zu übertragen sind, gebraucht er „Deckerinnerung“, um auf die Mehrdeutigkeit von kollektiven Erinnerungsprozessen zu verweisen. Beispielsweise nennt er die weitreichende Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust in den USA eine „Deckerinnerung“, welche die unangenehmen Erinnerungen an die Sklaverei und den Genozid an den eingeborenen Völkern abdämpfe (Rothberg 2009:195). Die englische Übersetzung von „Deckerinnerung“ als „screen memory“ weist aber über das bloße Überdecken und Filtern von Erinnerungen hinaus und schließt ein Projizieren und Raum-Geben mit ein.
Was bringt nun dieser Blick für das Gemeinsame verschiedener kollektiver Opfergeschichten?
Die Untersuchung der Verbindungen zwischen verschiedenen Opferartikulationen zeigt, dass es bei allen um die Erfahrung des Andersseins geht. Zweitens steht das Ringen um öffentliche Anerkennung der Anderen im Mittelpunkt. Drittens beschreibt Rothberg das Zeugnis-Ablegen als die wirkmächtigste Form um Gewalt aufzudecken. Der Umgang mit Differenz und die Beteiligung von marginalisierten Gruppen an dem, was öffentlich über die Vergangenheit eines Gemeinwesens verhandelt wird, sind folglich zwei Aspekte, die bei der Untersuchung von Erinnerungskultur aus transnationaler Perspektive eine wesentliche Rolle spielen.
Dabei besteht die Möglichkeit, dass sich Opfergeschichten und Opfergruppen gegenseitig unterstützen und nicht bekämpfen. So wurde die öffentliche Kundgebung zur Anerkennung des Genozids an den Armeniern am 24. April 2015 in Istanbul von Kurden, Griechen und Assyrern breit unterstützt. Und in Bosnien und Herzegowina hat beispielsweise die Opferorganisation “Izvor” aus Prijedor zum Gedenken an den armenischen Genozid aufgerufen. “If memory is as susceptible as any other human faculty to abuse […] this study seeks to emphasize how memory is at least as often a spur to unexpected acts of empathy and solidarity; indeed multidirectional memory is often the very grounds on which people construct and act upon visions of justice.” (Rothberg 2009:19)
Rothbergs französische Version von „multidirectional memory“ lautet „nœuds de mémoires“ (Rothberg, Sanyal and Silverman 2010). Darin klingen phonetisch Pierre Noras „lieux de mémoires“ an, ins Deutsche übersetzt hieße „nœuds de mémoires“ so viel wie „Erinnerungsknoten“ oder verflochtene Erinnerungen.
Meines Erachtens geht es aber um mehr als um Verflechtungen. Es geht darum, Erinnerungskultur anders zu verstehen. Denkt man europäische Geschichte von ihren Zivilisationsbrüchen aus, so sollte neben dem Holocaust auch dem Kolonialismus Aufmerksamkeit zuteilwerden. Rothbergs „Multidirectional Memory“ veranschaulicht, wie sich dann unser Verständnis von Erinnerungskultur verändert. Durch die Betonung des Zeugnis-Ablegens als wirkmächtigste Form der Artikulation erfahrener Gewalt rückt er ins Zentrum, dass in einem derart komplexen Kontext die individuelle Erinnerung mehr Gewicht erhält. Erst eine öffentliche Artikulation des Zeugnisses jedoch macht es kollektiv wirksam. So erfolgt eine Pluralisierung von Erinnerungskultur und ihre Privatisierung wird verhindert. Das Zusammenfügen der individuellen Geschichten zu einem Narrativ aber ist dann nicht mehr das Ziel, sondern das Ziel wird die Betrachtung ihrer gegenseitigen Bezüge, „multidirectional“ eben.
Literatur
Assmann, Aleida. 2007. “Europe: A Community of Memory?” German Historical Institute Bulletin:11–25.
Buruma, Ian. 1999. The Joys and Perils of Victimhood.
Freud, Sigmund. 1907. Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube u. Irrtum, Berlin: Karger.
Jureit, Ulrike, and Christian Schneider, Hgs. 2010. Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung, Stuttgart: Klett-Cotta.
Kantsteiner. 2002. “Finding Meaning in Memory. A Methodological Critique of Collective Memory Studies” History and Theory. 41:179–197.
Levy, Daniel and Natan Snayder. 2007. Erinnerung im globalen Zeitalter: der Holocaust. 3870 : Suhrkamp Globalisierung, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Rothberg, Michael. 2009. Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization, Stanford: Stanford University Press.
Rothberg, Michael, Debarati Sanyal, and Maxim Silverman, Hgs. 2010. Yale French studies, no. 118 & 119, Noeuds de mémoire. Multidirectional memory in postwar French and francophone culture, New Haven, Conn.: Yale University Press.
Schulze Wessel, Martin, and K. E. Franzen, Hgs. 2012. Schriften des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität, Bd. 5, Opfernarrative. Konkurrenzen und Deutungskämpfe in Deutschland und im östlichen Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, München, Oldenbourg: Oldenbourg Verlag.
Quelle: http://erinnerung.hypotheses.org/55







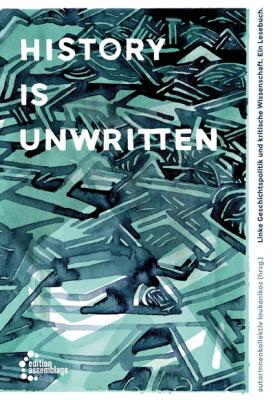 Jetzt ist der formidable Band auch bei mir eingelangt:
Jetzt ist der formidable Band auch bei mir eingelangt: