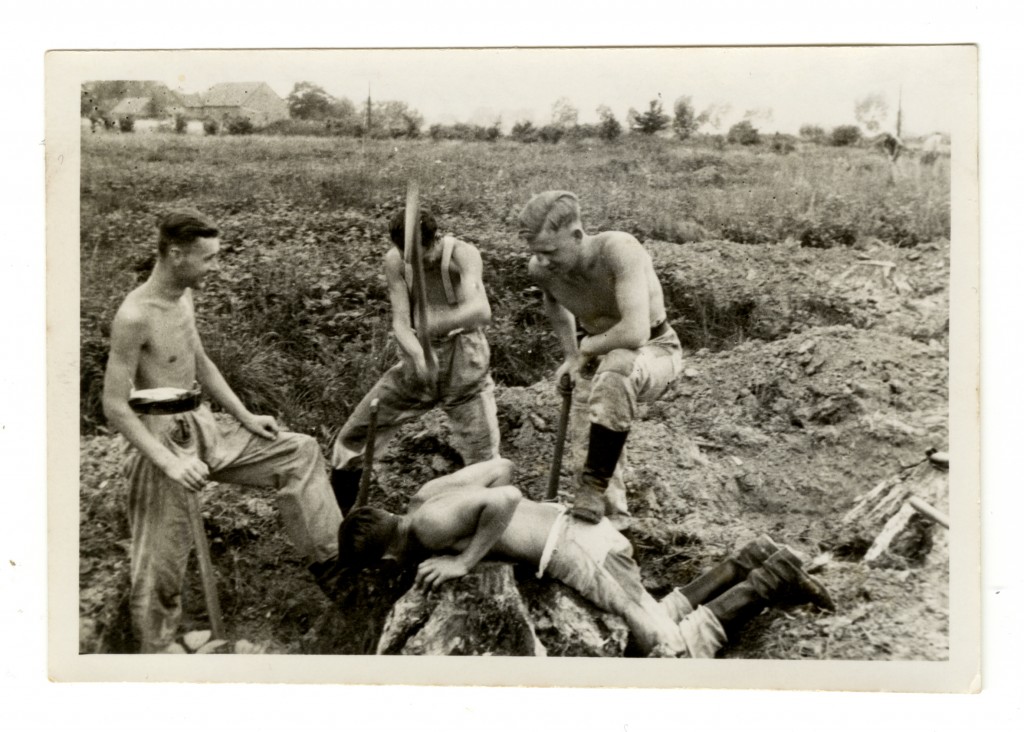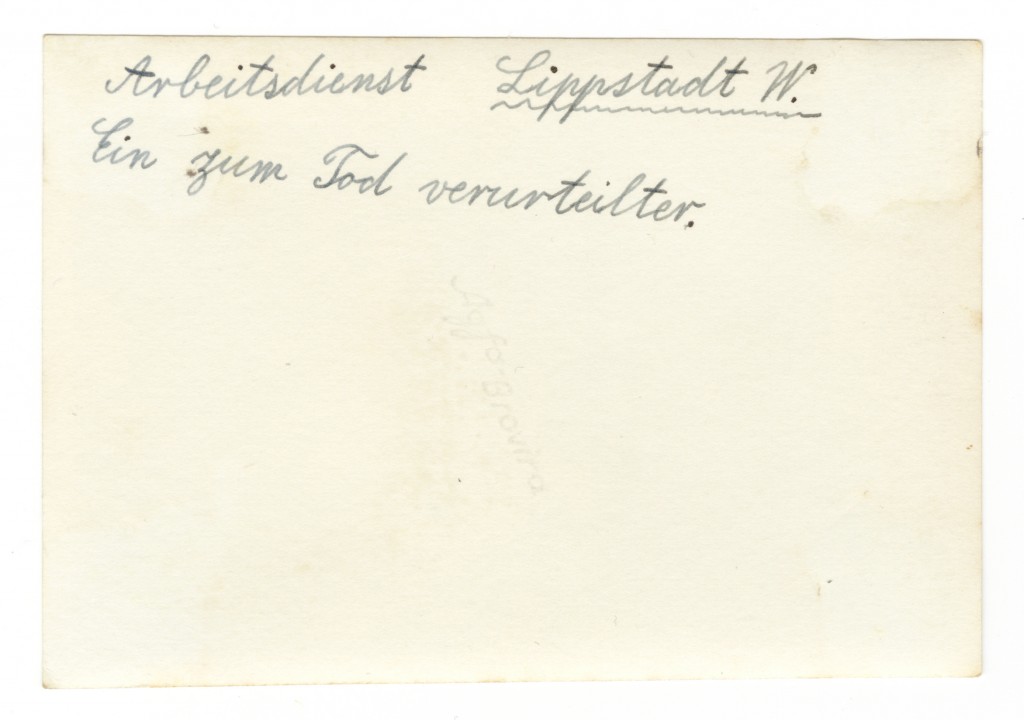Folien und Volltext (leicht gekürzt, aber mit den wichtigsten Nachweisen) meines Vortrags heute in Wien.
Archivisches Bloggen in Deutschland, 10.11.2014, Wien (Bloggen in Geschichtswissenshaft und Archiven – Workshop)
Einführung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Titel meines Vortrags ist natürlich eine Täuschung, wenn auch unbeabsichtigt. Ihnen in einem kurzen Vortrag einen Überblick über Archivblogs in Deutschland geben zu wollen, das würde nur zur vielen – und sehr verkürzten Beschreibungen führen. Und das könnten die dort Bloggenden auch viel besser.
Vor wenigen Jahren hätte man über ganz wenig berichten können bzw. nur ganz wenige Blogs aufzählen können: Neben „Archivalia“, das von Klaus Graf ja seit über 10 Jahren mit Themen und Meinungen rund ums Archivwesen befüllt wird, stehen ja seit einiger Zeit regional oder auch regionalgeschichtlich orientierte Archivblogs (gutes Beispiel: siwiarchiv, seit Anfang 2012); daneben sind quellenorientierte Blogs eine gute Option für Archive; ebenso möglich und genutzt werden Projektblogs (Bsp. Archivum Rhenanum), Blogs zu Veranstaltungen (zu denken ist da vor allem an die regionalen Archivtage, aber auch an das Blog der Konferenz „Offene Archive“), dann Blogs zu archivischen Spezialthemen (das geht von der Aktenkunde bis hin zur Frage des Web 2.0-Einsatzes – hier also wiederum „Offene Archive“); dann haben wir natürlich auch einige (oder eher: wenige) institutionelle Archivblogs. Daneben bloggen Kolleginnen und Kollegen auch in wachsender Zahl bei einigen Gemeinschaftsblogs mit – das passt natürlich besonders, wenn es um Kernkompetenzen wie Landesgeschichte und ähnliches geht.
Manches wird ja auch heute Nachmittag noch angesprochen werden, etwa das Blog des Archivamts in Münster gleich im Anschluss. Die gesteigerten Aktivitäten sind sicher dem Umstand zu verdanken, dass das Thema in der Archivwelt angekommen ist – wenn auch der überwiegende Teil der Archivarinnen und Archivare der Sache mit Skepsis gegenüber steht. Aber mein Eindruck ist, dass es nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und dass das Web 2.0 auf Archivtagen eigene Sektionen und ähnliches erhält, das ist ja sicherlich ein gutes Zeichen.
Woran liegt das? Es liegt sicherlich an Archiven, die einfach mal in die neue Welt eingestiegen sind. Und vielen, die dann gefolgt sind oder zumindest interessiert waren. Es liegt an Konferenzen und eben Blogs, die dem Thema sicherlich auch etwas den Weg geebnet haben und auch zeigen, dass man sachlich über die Dinge sprechen kann. Bestes Beispiel zuletzt ist ja die Diskussion zum Beitrag von Bastian Gillner auf „Offene Archive“ – über 60, oft längere Kommentare, und alles ohne die Nebengeräusche, die man von anderen Seiten kennen gelernt hat. [...]
Das Aufblühen der Blogs unter den Archiven und Archivaren mag auch daran liegen, dass es beispielsweise über de.hypotheses sehr einfach ist, ein Blog aufzubauen. Dass das nichts kostet und man noch technische Unterstützung und die Einbettung in eine geisteswissenschaftliche community dazu bekommt – das ist klasse und ich kann das nur empfehlen, auch aus Sicht eines Archivs, das derzeit vier Blogs über das Blogportal betreibt bzw. an Blogs mitbeteiligt ist.
Das Aufblühen der Blogs und generell der Sozialen Medien bei unseren Einrichtungen hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich die Möglichkeit habe, schnell und ohne Umwege oder lange Wartezeiten an die Öffentlichkeit zu kommen. Wer jemals in einer größeren Verwaltung gearbeitet hat, der weiß, dass die Wege ins Netz und die Betreuung einer Homepage nicht immer gottgegeben sind und dem Archiv in die Hand gelegt werden.
Doch jetzt genug davon. Ich möchte mit Ihnen nun noch einen Blick darauf werfen, welche Entwicklungen derzeit bei den deutschen Dachorganisationen des Archivwesens laufen. Ich meine damit zum einen den Verband deutscher Archivarinnen und Archivare, dann aber auch die BKK, die Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag.
In beiden Fällen geht es auch um den Einsatz von Blogs.
VdA-Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit und Social Media“
Also zunächst zum VdA. Hier hat vor einigen Monaten die Einsetzung einer AG zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Social Media positiv überrascht – zumindest wird man mal davon ausgehen dürfen, wenn man sich die Ziele der AG vor Augen führt: Es geht um eine Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit der Verbandes. Die AG wurde vom Gesamtvorstand eingesetzt. Ihr gehören neben Vertretern aus dem Vorstand und der Geschäftsführung des VdA vor allem Kolleginnen und Kollegen an, die selbst bereits aktiv im Web 2.0 unterwegs sind – also ein Expertengremium, wenn man so will: Andrea Rönz, Bastian Gillner, Thorsten Unger, Jens Murken, Thomas Wolf und ich. Die Gruppe hat bereits die bisherigen PR-Kanäle des VdA unter die Lupe genommen – eine Erweiterung der zwei-Wege-Kommunikation war dabei Konsens. Die AG erarbeitet deshalb ein Gesamtkonzept für eine neue, erweiterte Öffentlichkeitsarbeit des VdA, die dann dem Gesamtvorstand vorgelegt wird. Hier wird es dann auch um Themen gehen wie:
Eigenschaften der neuen PR.
Instrumente der neuen PR.
Bestandsaufnahme.
Ziele und Zielgruppen.
Ein erklärtes Ziel ist es dabei vor allem, ein archivwissenschaftliches Blog aufzuziehen. Es könnte, was ja auch dem VdA-Aufbau nach Fachgruppen entspricht, nach Archivsparten gegliedert sein – also: staatliche, kommunale und kirchliche Archive, Archive der Wirtschaft, Medienarchive usw.
Es wird sicherlich Rubriken zum Verband, zu Veranstaltungen (wie dem deutschen Archivtag) und zu den VdA-Arbeitskreisen geben.
Die AG hat sich, ohne dass ich da zuviel verrate, auch bereits mit Themen wie guidelines für die Redaktion oder der Kommentarfunktion auseinandergesetzt – da geht es ja vor allem um die Frage der Moderierung und Freischaltung.
Als System soll übrigens wordpress verwendet werden.
Ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr das VdA-Blog das Licht der Welt erblicken kann.
BKK-Unterausschuss „Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit“
Ein Indiz dafür, dass die deutschen Archivare der Meinung sind: wir kommen nicht mehr am Thema Soziale Medien vorbei – ein Indiz ist nicht zuletzt, dass der Dachverband der deutschen Kommunalarchive, die BKK, einen Unterausschuss mit der Sache beschäftigt. Die BKK verfügt ja über eine Reihe solcher Ausschüsse, die dann Empfehlungen beschließen – das geht von der Bestandserhaltung über IT-Fragen bis hin zum harten Brot der Personenstandsunterlagen und anderes, was einen Kommunalarchivar manchmal so quält. Damit nun die Sozialen Medien keine Qual werden, hat die BKK bereits Anfang 2013 den Auftrag vergeben, Empfehlungen zu erarbeiten.
Man könnte jetzt einwenden: warum Empfehlungen und nicht einfach mal machen? Einige der Mitglieder des Ausschusses sind ja nun mal seit Jahren auch voll in der Web 2.0-Praxis drin. Klar. Aber vielleicht ist das Vorgehen über Richtlinien, Empfehlungen, guidelines und was immer auch dem deutschen Archivwesen angemessen. Wir schweben halt nicht einfach jenseits aller Verwaltungsstrukturen. Und ehrlich gesagt: eine Empfehlung, die hauchzart auch den Stempel des deutschen Städtetags trägt, ist sicher keine schlechte Waffe, wenn das „einfach mal machen“ mal auf Widerstand stößt.
Also Empfehlungen. Sie sollen den Weg ins „Neuland“ erklären und ein Wegweiser sein, und eine Handlungsanleitung sein.
Sie werden, soviel kann man bereits sagen, die folgenden Bereiche umfassen:
Zunächst ein großes Auffangbecken namens Soziale Netzwerke (da geht es dann neben den üblichen Verdächtigen auch um Video- oder Fotoplattformen); vieles wird wohl eher in Form einer kommentierten Linkliste genannt werden können.
Dann wird an zweiter Stelle die Nutzung von Blogs thematisiert. Darauf folgen dann die Nutzerorientierung bei einer Kernaufgabe, nämlich der Erschließung, und die Nutzerorientierung bei der Ressourcengenerierung – hier als Stichwort crowdfunding. Dann folgt ein Blick auf eine eigentlich ebenso wichtige Sache: die eigene Organisation 2.0 im Archiv.
Wie sind die Kapitel nun untergliedert?
Das wäre zunächst eine kurze Definition der Anwendung bzw. der Gruppe von tools eines Bereichs. Dann folgt eine Erläuterung zu den möglichen Zwecken des Einsatzes – also für welches Arbeitsfeld des Archivs könnte das relevant sein usw.?
Es folgt ein Blick auf die Ressourcenfrage, inklusive der Frage möglicher Kosten. Das ist ja bei der derzeitigen finanziellen Situation vieler Archive und ihrer Träger nicht ganz unwichtig. Beim Thema Kosten darf man allerdings unterstellen, dass da mit einem ganz geringen finanziellen Aufwand ein Höchstmaß an Signifikanz in der Archivwelt (und weit darüber hinaus) erreicht werden kann.
Aus meiner Sicht geht es hier auch darum, zu erläutern, wie viel Aufwand ein Beitrag bei Facebook, ein Tweet bei Twitter oder ein Blogpost machen kann – und wann etwas schief läuft: schief läuft z.B. etwas, wenn die Vorbereitung eines Facebook-Beitrags Stunden dauert und das von der Anteilnahme der halben Archivbelegschaft begleitet wird).
Alle fünf Hauptkapitel der Handreichung sollen dann mit praktischen Beispielen enden – genauer: mit best-practice-Beispielen. Hier wird man sicher den Blick nicht allein auf den deutschen Sprachraum richten. Da sind uns manche Staaten mit ihren Archiven oder auch Archivverwaltungen meilenweit voraus. Aber es tut sich was, nicht zuletzt in der Welt der Archiv-Blogosphäre.
Andererseits werden neben größeren Leuchtturmprojekten gerade auch die Beispiele aus kleineren Archiven von Interesse sein – denn hier zeigt sich, was mit etwas Engagement und vergleichsweise wenig Aufwand möglich ist. In manchen Fällen werden sicherlich auch Schulungen helfen, die Berührungsängste abzubauen – die Workshops, die jetzt mehrfach in NRW durchgeführt worden sind, können da angeführt werden. Praktische Beispiele sollen aber vor allem dazu animieren, die Sozialen Medien einmal auszuprobieren; vielleicht erst einmal als (bloggende) Privatperson, also als Archivar/in XY, dann aber auch als Institution.
Und: Es lohnt sich in aller Regel und befreit so manches Archiv vom Staub der Jahrhunderte, und wenn es nur das Image ist (das staubig wirkt).
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Quelle: http://archive20.hypotheses.org/2201