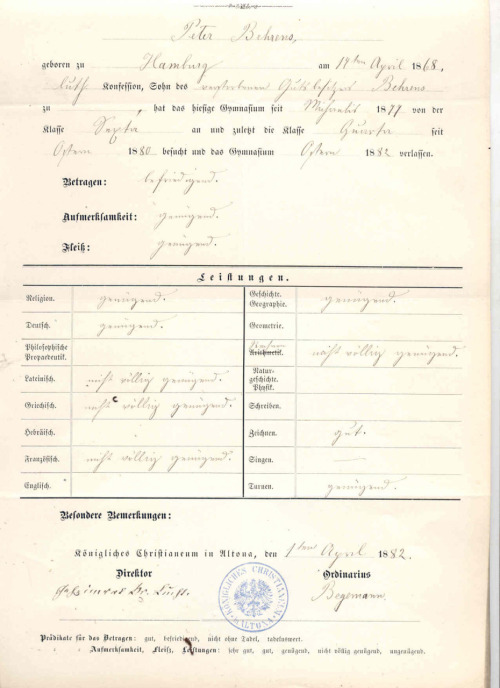In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienen die zum Teil seit dem 16. Jahrhundert überkommenen höheren Bildungsanstalten – vormals hervorgegangen aus Klöstern oder gegründet nach fürstlichem, aber auch städtisch-protestantischem Willen – nicht mehr hinreichend für die modernen Zeiten, in denen die technische und gesellschaftliche Entwicklung eine weiter gestreute höhere Schulbildung erforderte. Man gründete, insbesondere zwischen den 1860er und 1890er Jahren, die modernen, sogenannten „Realgymnasien“, in denen Latein, aber nicht mehr das Griechische, dafür aber die Naturwissenschaften gelehrt wurden und aus denen der heutige Schultyp „Gymnasium“ hervorgegangen ist. Alle diese Aberhunderte von Gymnasien im Land besaßen Bibliotheken, die alten Anstalten seit dem 16. Jahrhundert sogar Sammlungen von 30.000 und mehr Exemplaren. Gleichwohl sind „Gymnasialbibliotheken“ heute nahezu unbekannt. Kaum ein Gymnasium besitzt noch seine Buchsammlung aus vergangenen Jahrhunderten. Wo sind diese Bibliotheken mit insgesamt Millionenbeständen geblieben?
Seit dem 16. Jahrhundert waren die Gymnasialbibliotheken, vor allem im Norden, auch die Stadtbibliotheken, die neben den Rats- und Kirchenbibliotheken mit deren juristischen bzw. theologischen Schwerpunkten nicht nur den Schülern und Lehrern, sondern auch den Bürgern den Wissensbedarf nach der Philologie erfüllten. Die Bildungsidee folgte den Humanisten des späten 15. Jahrhunderts: „ad fontes“, zu den Quellen. Spätestens im 19. Jahrhundert bezogen einige dieser Bibliotheken eigene Häuser und wurden als „Stadtbibliothek“ geführt. So basiert zum Beispiel die Stadtbibliothek Lübeck seit dem 17. Jahrhundert auf den Beständen der Bibliothek des Katharineums, des alten Gymnasiums der Hansestadt. Die Stadt- und Universitätsbibliothek Köln hält die Bibliothek des alten Kölner Gymnasiums, seit Anfang des 19. Jahrhunderts die Kölner Stadtbibliothek, heute als ausgewiesene Sondersammlung.
In den 1920er Jahren ließen wiederholt Gymnasien ihre alten Buchbestände in die nächsten größeren Bibliotheken bringen; die Neuordnung des Schulwesens nach dem Ersten Weltkrieg, aber insbesondere die Knappheit der finanziellen Mittel in den späten 1920er Jahren gaben die Motivation. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, in dessen Zuge auch Gymnasialbibliotheken zerstört worden waren, wurde viele Sammlungen vor dem Zugriff der anrückenden Truppen, vor allem im Osten Deutschlands, versteckt. Der Fall der Bibliothek des Stralsunder Gymnasiums, gegründet 1560, die 1945 bei Nacht und Nebel ins städtische Archiv verbracht worden war, erhielt Aufmerksamkeit dadurch, dass das Stadtarchiv Stralsund im Jahr 2012 diese Bestände in den Handel gab.
Seit den frühen 1950er Jahren bis etwa 1970 fanden auch im Westen Abgaben der gymnasialen Buchsammlungen an die Stadt- Landes- und Staatsbibliotheken oder die örtlichen Archive statt; die Neuordnung des gymnasialen Schulwesens hatte keinen Bedarf an Erinnerung ihrer historischen Zeiten; man brauchte Platz und hatte keine Kapazitäten frei für die Erfassung überkommener Bestände. Ein Beispiel dafür ist die Bibliothek des Bismarckgymnasiums Karlsruhe, einer markgräflichen Gründung von 1586, deren wertvolle Altbestände zwischen 1953 und 1970 ihren Weg in die Badische Landesbibliothek fanden. Das Bibliothekswesen erfasste diese Bestände landauf landab nahezu durchweg ohne jeden Provenienzhinweis und ordnete sie ins Magazin ein; die Digitalisierung der Kataloge seit 2004 erfolgte zumeist anhand der Zettelkataloge, ohne die Exemplare aufzusuchen.
Einige Gymnasialbibliotheken „leben“ noch an ihren angestammten Orten; viele von den verbliebenen überdauerten indes nicht selten vergessen auf Dachböden oder in Kellern. Seit den 1990er Jahren fanden sie zögerlich wieder Beachtung und es stellte sich heraus, dass sie durchweg viel Geld kosten, wofür indes weder der Staat noch die Kommunen und die Länder einen Haushaltstitel haben. Sie werden deshalb meistens von engagierten Lehrern, Schülern, Eltern und Bürgern saniert, gepflegt und behütet, die indes nicht selten gar keine Vorstellung davon haben (haben können), welch einen Schatz diese Buchsammlungen für die Erkenntnis der Bildungs- und Kulturgeschichte unseres Landes darstellen. Das Wissen um diese Sammlungen schützt sie vor dem Vergessen infolge einer an Standards ausgerichteten Ignoranz der Bildungspolitik, die das Wort „humanistisch“ immer gern dann anführt, wenn es nichts kostet.
Über die weitgehend unbekannte Bedeutung historischer Gymnasialbibliotheken habe ich 2010 für den Frühneuzeit-Blog geschrieben. ( http://frueheneuzeit.hypotheses.org/503 ) Die Anregung kam damals von Klaus Graf, der 2005 im „netbib“-Blog eine Liste dieser Sammlungen veröffentlichte; bereits seit 2004 hatte er im selben Blog immer wieder auf historische Gymnasialbibliotheken hingewiesen.
Netbib (kg):
http://log.netbib.de/archives/2005/11/17/inkunabeln-und-handschriften-der-gymansialbibliothek-gotha/
http://log.netbib.de/archives/2005/05/31/budingen-gymnasialbibliothek-nicht-mehr-existent/
http://log.netbib.de/archives/2004/12/31/deutsche-handschriften-in-historischen-schulbibliotheken/
http://log.netbib.de/archives/2004/08/04/schulbibliothek-in-hof/
Eine Recherche der in dieser Liste angeführten Orte ergab seinerzeit für mich ein buntes Bild, was die jeweilige Betreuung – und auch die Präsentation im Netz – betrifft: mal umsorgte ein Mitglied des Kollegiums den Bestand (Konstanz, Hamburg), mal ist’s die Landesbibliothek (Coburg, Speyer), mal war ein Bibliothekar fest angestellt (Stade), mal hatte ein Förderverein einen „Direktor“ installiert (Hadamar), mal hielt ein Pensionär den Laden offen und in Schuss (Seesen). Auch die Präsentation im Netz reichte von bildschön (Rastatt) bis gar nicht (Düsseldorf, wo nur nach eingehender Erforschung der Seite überhaupt ein Hinweis auf den Status einer Bibliothek zu bekommen war); manche hatten auch bereits den virtuellen Zugang eröffnet, durch Fördervereine (Jever) oder durch eine Zentralbibliothek. Jeder machte es nach seinen Möglichkeiten und wie es zu seinem Haus und zu seinem Ort passte. Diese Individualitäten unterstreichen den besonderen Charakter der Sammlungen: keine gleicht der anderen, ihre Geschicke bilden die historischen und bis in die Gegenwart wirkenden Identitäten der Anstalten ab. Gemeinsam veranschaulichen sie indes die Bildungsgeschichte unseres Landes.
Im Leben wie im Internet fand sich bislang kein Ort, diese bildungsgeschichtlich einmaligen Schatzkammern zu würdigen; allein das von Klaus Graf betriebene Blog „Archivalia“ ( http://archiv.twoday.net/ ) widmet dem Thema wiederholt und mit einiger Regelmäßigkeit Einträge:
Historische Schulbibliotheken bei „Archivalia“
Inkunabeln in historischen deutschen Schulbibliotheken (bei: „Archivalia“, Stand 2006)
Eine umfassende Darstellung zur Bedeutung der Gymnasialbibliothek für die Kultur- und Bildungsgeschichte unseres Landes existiert bislang nicht. Seit dem 19. Jahrhundert bis heute sind die Veröffentlichungen zu einzelnen Sammlungen indes so zahlreich, dass die Erschließung nur in einer kommentierten Bibliographie möglich ist; die auch über die überregionale Bedeutung dieser speziellen Sammlungsform Aufschluss geben kann. Ausgangspunkt ist die Erfassung sowohl „toter“ als auch „lebender“ historisch gewachsener gymnasialer Buchsammlungen.
Felicitas Noeske, Hamburg
Literatur:
Reinhard Feldmann: Historische Sammlungen der Schulbibliotheken im Rheinland und in Westfalen. In: Schulbibliothek aktuell 2, 1993; S. 150-156
Matthias Richter, Carl Michael Wiechmann: Das kleine Corpus doctrinae. Bärensprung, 1865
Armin Schlechter: Zum Verkauf der Stralsunder Gymnasialbibliothek. In: Bibliotheksdienst, Bd. 47, 2013, Nr. 2: 97-101
Quelle: http://histgymbib.hypotheses.org/1