Wenn ich als Kind gerade nicht Schriftsteller werden wollte, war definitiv Wissenschaftler mein Berufswunsch. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich hatte da einen verschrobenen Geist vor Augen, der sich 24 Stunden täglich und an sieben Tagen in der Woche um eine Forschungsfrage kümmern kann, die er dann irgendwann löst. Und wenn ich mir jetzt meine tägliche Arbeit so anschaue, muss ich feststellen, dass die Wirklichkeit bei mir - wie bei eigentlich allen Kolleg|inn|en in meinem näheren Umfeld - doch ein wenig anders aussieht.
Ich will hier jetzt gar nicht das große Klagelied anstimmen, dass ja sowieso immer alles auf den Mittelbau abgewälzt wird, der dazu meist noch unter dem Damoklesschwert der Befristung darbt. Nein, ich glaube, insgesamt geht es sicher auch der Professor|inn|enschaft nicht besser, die zwischen Lehre und administrativen Aufgaben auch um Zeit ringen muss, sich mit der eigenen Forschung beschäftigen zu können (was der PHD-Comic ganz nett einfängt, wobei der eher die amerikanischen Hochschullehrer abbildet).
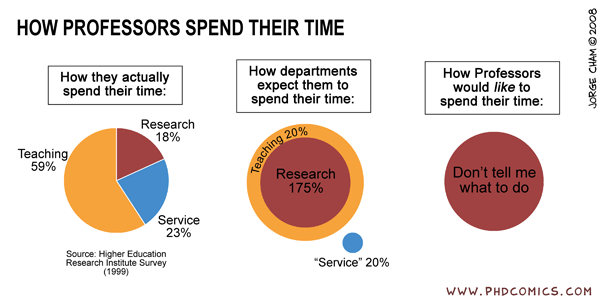
PHD comics by Jorge Cham
www.phdcomics.com
Da meine Aufgaben in letzter Zeit immer mehr zerfaserten, musste ich eine Organisationsstruktur zurechtlegen, die mich überall einigermaßen auf dem Laufenden halten kann, welche Aufgaben dringend der Behandlung bedürfen, ohne aus den Augen zu verlieren, was noch so alles erledigt werden muss. Was habe ich nicht alles ausprobiert - Tafelbilder auf dem Whiteboard hinter mir oder Task-Listen auf Schmierzetteln vor mir festgehalten, e-Mails sortiert, zweistellige Zahlen von Google-Docs angelegt und dazu To-Do-Listen auf unterschiedlichen Plattformen ausprobiert. Momentan bin ich dabei angekommen, auf Evernote je eine Notiz zu allen verschiedenen Aufgaben, die ich im Moment betreue, anzulegen und dort wichtige Termine und ToDos festzuhalten. Momentan liegen in dem Ordner zehn dieser gegliederten Notizzettel. Über jeden dieser Zettel könnte ich eigentlich mal einen Blogpost schreiben, es sind durchweg interessante Aufgaben, denen ich aber leider immer nur einen Teil meiner Zeit opfern kann.
Da muss ich z.B. meine Lehrveranstaltungen vorbereiten, managen und eventuelle Prüfungsleistungen korrigieren. Mit dem Kollegen dessen Dissertation besprechen. Oder den BA-Studiengang Informationsverarbeitung für die Re-Evaluierung neu strukturieren. Den MA-Studiengang als 1-Fach-Master völlig neu konzipieren, Austauschmodule zu anderen Studiengängen entwerfen und absegnen. Mit meinen Kollegen Überlegungen zur strategischen Ausrichtung des Institutes anstellen, mit verwandten Fachbereichen Kooperationen absprechen, überlegen, wie wir uns besser in das Cologne Center for e-Humanities eingliedern, und ob ich dort meine Pflichten als stellvertretender Sprecher irgendwie besser ausfüllen könnte. Mögliche Forschungsprojekte ausdenken, ausgedachte anschieben, angeschobene beantragen, bewilligte beaufsichtigen, weiterdenken, Zwischen- und Abschlussberichte verfassen, Ergebnisse veröffentlichen, diverse Formblätter zur Drittmittelanzeige, zur Vollkostenkalkulation, zur Rechnungsstellung ausfüllen, vom Justiziariat belehrt werden, was der Unterschied zwischen Auftragsforschung und Kooperationsverträgen ist, Meetings ansetzen mit Projektmitarbeiter|inne|n, mit unseren Admins, mit dem gesamten Lehrstuhl, mit dem gesamten Institut, mit der CCeH-Geschäftsführung. Dazu irgendwie auf dem Stand der Forschung bleiben in so hochdifferenzierten und weitläufigen Bereichen wie der Computerlinguistik, der Softwaretechnologie und der Wissenschaftskommunikation.
Noch einmal: Ich will nicht jammern, im Gegenteil bin ich in meinem Job wirklich glücklich (gut, ohne Befristung schliefe ich besser). Man muss halt Kompromisse oder Synergien finden - eine Lehrveranstaltung bspw. an ein Thema koppeln, zu dem man gerade ein Projekt leitet. Projekte anschieben, die kompatibel mit dem eigenen Forschungsvorhaben sind. Teile der eigenen Forschung in davon unabhängig gestellte Projekte einbringen. Delegieren, netzwerken, den Überblick behalten. Ich war nie ein besonders guter Multitasker und ich werde es vermutlich auch nie werden. Mit der Nutzung geeigneter Software (Evernote für mich, Google Drive für die Bearbeitung gemeinsamer Dokumente, mitunter, wenn viel Kleinkram auf einmal kommt, auch eine ToDo-Liste wie Wunderlist) ist es mir aber in Teilen möglich, die Multitasks auf eine Reihe von Einzeltasks aufzuteilen, die mein Hirn nicht überfordern. Auch wenn ich froh sein werde, wenn die aktuellen Notizzettel weniger werden sollten, kann ich so noch eine Weile produktiv (Selbstbild) arbeiten. Immerhin hatte ich ja Zeit, diesen Blogpost zu schreiben. Und bald sind ja auch Weihnachtsferien, in denen man dann all das, was in den letzten Monaten hinten runter gefallen ist, aufarbeiten kann...





