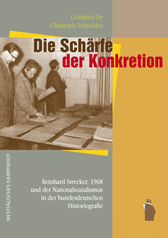Ein Beitrag von Nicolas Cauet.
Mein erster Wikipedia Artikel war die französische Zusammenfassung eines englischen Buchs, das seit über 20 Jahren erschienen ist und dessen Autor auch in Frankreich bekannt ist: Julian Barnes und seinem Werk Flaubert´s Parrot (auf Französisch „Le perroquet de Flaubert“. ) Die Relevanzkriterien waren erfüllt: Die Übersetzung wurde in einem bekannten Verlag veröffentlicht, es gibt zahlreiche andere Bücher desselben Autors und mehrere in zuverlässigen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichte Artikel über das Buch belegen den wissenschaftliche Wert und die Bedeutung meines Artikels.
1) Technische Eindrücke und Probleme
Für die Gestaltung meines Artikels habe ich mich von einem Muster inspirieren lassen, das ich in einem anderen Artikel gefunden habe. Ich fand allerdings schwierig, einen ganz neuen Artikel zu schaffen, denn es wird erst am Ende einer langen Seite angeboten: Man muss schon ein bisschen recherchieren und seinen Willen, einen Artikel zu verfassen, durchsetzen, bevor man zu dieser kleinen bescheidenen Eingabe gelangt! Man kann es auch nicht als Entwurf auf Wikipedia speichern, so dass man m.E. den Artikel eher offline verfassen müsste. Wenn der Artikel in seinem aktuellen Stand nicht die Anforderungen der Online-Enzyklopädie erfüllt, kann er gleich gelöscht werden. Ich habe es zwei Mal erfahren, als ich nur die Seite erstellen wollte. Das hat mich einerseits irritiert, andererseits beruhigt: Die Kontrollverfahren hatten gut und schnell funktioniert.
Die größte Schwierigkeit war aber bei weitem die Syntax. Ich kenne mich in HTML nicht aus und sollte in der französischen Spielwiese ein paar Stunde üben, bevor ich in der Lage war, meinen eigenen Artikel herzustellen. Die französische Version der Spielwiese ist im Übrigen umfangreicher als die deutsche, die nicht gereicht hätte, um meinen Artikel zu verfassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die gewöhnungsbedürftige Wikipedia-Syntax viele Nutzer davon abgebracht hat, bei der Herstellung oder Verbesserung von Artikeln mitzumachen. Ich wundere mich auch, dass die „what you see is what you get“-Version, die besonders benutzerfreundlicher sein wird, noch nicht implementiert ist (EDIT: der Artikel wurde mitte Juli verfasst, seitdem ist die neue Version in Betrieb gekommen).
Die aufwendigste Aufgabe für mich war die Erstellung von Links zu den anderen Wikipedia-Artikeln: Nicht nur muss man Links im eigenen Artikel einbauen, sondern auch in anderen, z.B. auf die WP-Seite zu Julian Barnes. Ich fand das System von Verlinkung zu den Artikeln in anderen Sprachen besonders praktisch, habe aber noch nicht begriffen, wie man auf einen Wikipedia-Artikel in einer anderen Sprache verweist und wie die Kategorien zu finden sind. Möglicherweise könnte ich dann meinen Artikel noch besser verlinken, um mir eine noch größere Leserschaft zu verschaffen! (es ist leider in der französischen Wikipedia nicht möglich zu beobachten, wie viele Leser die Seite aufgerufen haben, aber wenn ich mich auf Statistiken der deutschen Version beziehe, dürfte ich über 100 Leser gehabt haben)
Nachdem mein fertiger Artikel gespeichert wurde, haben die Administratoren nur syntaktische Unstimmigkeiten überarbeitet und der Artikel den passenden Kategorien untergeordnet.
2) Inhaltliche Merkmale
Die Gliederung meines Artikels hat sich an die Richtlinien von Wikipedia für Literaturwerke orientiert: in der Einleitung ein Überblick über die Bedeutung des Werkes in seinem literarischen Umfeld und eine sehr kurze Synopsis, dann eine detaillierte Wiedergabe der Handlung, schließlich die Hauptthemen des Buches aus literaturwissenschaftlicher Sicht.
Problematisch war nur der dritte Teil. Da ich mich mit dem Buch und dessen Autor in einer Hausarbeit auseinandergesetzt hatte, verfügte ich über ein breites Spektrum möglicher Interpretationen. Ich habe den Schwerpunkt auf die Verwandtschaft mit postmodernen Romanen gelegt, womit sich auch die meisten Literaturforscher beschäftigt haben.
Ich habe hingegen absichtlich die Rezeption des Buches unbeachtet gelassen, weil ich einerseits nicht die Möglichkeit (e.g. die Zeit) hatte, genügend in den Archiven von Zeitschriften zu recherchieren, andererseits, weil es nicht viel gebracht hätte, da die meisten Rezensionen eher biographisch waren, was vorrangig für den Hauptartikel zu Barnes relevant gewesen wäre.
Die Quellen, die ich benutzt habe, waren hauptsächlich auf Englisch. Ich habe mich dazu entschlossen, keine freie Übersetzung zu benutzen, weil die Zitate viel zu lang für meinen Artikel gewesen wären. Sie hätten zudem durch die beschränkte Auswahl das Problem der vermeidlichen Subjektivität meines Artikeltextes nicht aufgehoben. Ich habe also lediglich in Fußnoten auf die Artikel verwiesen, auf die ich mich bezogen habe.
Dies soll die Überprüfbarkeit meiner Aussagen gewährleisten, zumindest für diejenigen, die sich ernst mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Den Anderen soll dies als ausreichenden Einblick dienen.
Wer sich ohne zu viel Mühe weiter informieren will, kann auf die Links klicken, die ich hinzugefügt habe: Es gibt in der französischen Wikipedia einen sehr gut geschriebenen Artikel über die postmoderne Literatur, den ich mehrmals verlinkt habe, da er mit meiner Interpretation übereinstimmte. Das ist auch eine sehr gute Ergänzung zu vielen Themen, die in dem Buch von brisanter Bedeutung sind.
Wer noch mehr erfahren will, kann zwei interessante Links zu meinem Thema weiterfolgen. Es handelt sich zwar um die englische Seite des Autors, aber das war die einzige Seite, die mir vertrauenswürdig erschien. Die Admins haben die Verlinkung mit der Kategorie Englische Literatur hergestellt.
3) Prix Médicis essai oder nicht?
Während meiner Arbeit am Artikel habe ich auf amazon.fr gelesen, dass das Buch den französischen Literaturpreis Prix Medicis essai gewonnen habe. Ähnliches stand auch im französischen Artikel über Barnes, jedoch ohne Beleg. Auf der Seite des Autors fand ich aber keine Spur von dieser Auszeichnung, was mir verdächtig schien.
Ich habe also „Prix Médicis“ gegooglet und wurde auf eine gewidmete Seite weitergeleitet. Da stand aber ein anderes Buch, was mich sehr verwirrt hat. Es gibt nämlich einen Wikipedia-Artikel, in dem alle Preisträger erfasst werden. Dieser Artikel wurde am 17. Mai 2013 hergestellt und gibt keine Quelle an.
Auf der Suche nach einer zuverlässigeren Quelle habe ich in den Archiven einer französischen Zeitung einen Artikel von 1986 gefunden, der bestätigte, dass das Buch tatsächlich den Prix Medicis essai gewonnen hatte.
Ich habe eine Nachricht an den Verfasser des WP-Eintrags zum Prix Médicis der nicht stimmenden Wikipedia-Tabelle (der im übrigens auch Admin ist) geschrieben. Dort habe ich das Problem von falschen Informationen und Quellenmangel thematisiert. Daraufhin antwortete er, dass die zuverlässige Quelle die Seite sei, die ihre falschen Informationen aus Wikipedia übernommen habe.
Wir sind also in einem typischen Fall von Verbreitung und Selbstbestätigung einer falschen Information, deren Ursprung unklar ist und die (trotz Korrektur) einen Schatten über die Zuverlässigkeit der ganzen Tabelle wirft, obwohl ich mich für solche einfachen und unbestreitbaren Daten auf Wikipedia gern verlassen hätte.
Am Beispiel dieser kleinen Geschichte gilt also für mich ein vorsichtigerer Umgang mit Wikipedia. Artikel, die gar keine Quellenangabe liefern, sollten gar nicht in Betracht gezogen werden. Dies war vielleicht die größte Lehre, die mir das Verfassen dieses Artikels brachte.
Zum Schluss kann man sagen, dass dieses Seminar mir von Nutzen war, weil ich jetzt besser einschätzen kann, was die Stärke und die Schwäche der Online-Enzyklopädie Wikipedia sind, die ich fast täglich benutze – und weiter benutzen werde, aber vorsichtiger. Ich werde mich vielleicht an die Ergänzung weiterer Artikel beteiligen, aber erst wenn die neue Benutzeroberfläche implementiert ist.
Quelle: http://wppluslw.hypotheses.org/463
 Auditorium Maximum, Universität Göttingen, By Daniel Schwen [CC-BY-SA-2.5 , via Wikimedia Commons
Auditorium Maximum, Universität Göttingen, By Daniel Schwen [CC-BY-SA-2.5 , via Wikimedia Commons