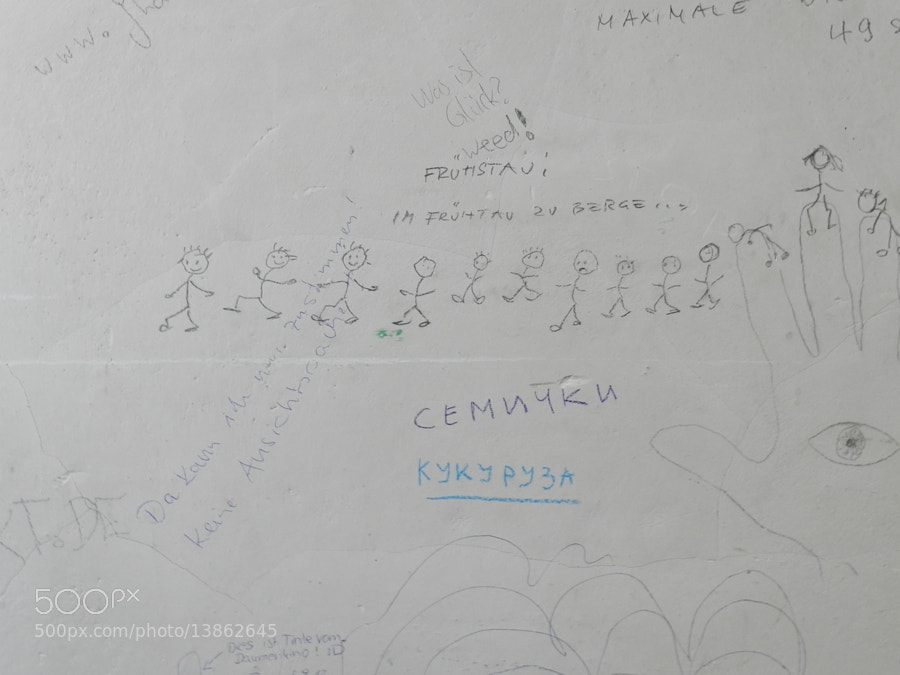Am Sonntag endet die dOCUMENTA (13). Ihre ursprüngliche Intention war es, 1955 das vormals isolierte Deutschland kulturell wieder mit der Welt kurzzuschließen.
So stand sie in ihrer ersten Ausgabe im Zeichen der verfemten deutschen Avantgarde. Reiht man die Ausstellungen seither aneinander, so bilden sie das Rückgrat der künstlerischen Entwicklung der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts.

d (13) by Mizzi Schnyder
1955, im Jahr der ersten Kasseler Weltkunstausstellung, gab Hans Sedlmayr seinen öffentlichen publizistischen Widerstand gegen die Moderne auf.
Inwieweit er damals überblicken konnte, dass der gesellschaftliche Konsens so ziemlich das Gegenteil seiner Position repräsentieren würde, kann derzeit nicht beantwortet werden.

d (13) Geoffrey Farmer by Mizzi Schnyder
Dennoch soll das Anlass genug sein, einige Gedanken zur diesjährigen Ausgabe zu notieren, um von hier aus später in eine Rückschau einzutreten. Die retrospektive Haltung war zugleich eines der Leitthemen der documenta.
Gewagt wurde diese in fiktiven Rückblicken aus einer imaginären Zukunft in unser Heute, wie in den Arbeiten von Adrián Villar Rojas und MOON Kyongwon & JEON Joonho. Ersterer hatte auf der seit dem Mittelalter bestehenden terassenförmig angelegten Weinberganlage Artefakte einer fiktiven Ausgrabung inszeniert.[1]

d (13) Adrián Villar Rojas by Mizzi Schnyder
Der koreanische Beitrag zeigte seine Retrospektive aus der Zukunft in multimedialer Form.[2] Ein Film in Doppelprojektion erzählt die Geschichte zweier Protagonisten. Eines zeitgenössischen, der mit Gegenständen hantiert und einer zukünftigen weiblichen Figur, die diese Relikte auswertet und archiviert. Das Buch beschreibt gegenwärtige Kulturformen. Kombiniert wird dies mit einer Sammlung von Lifestyle-Produkten, die in der postapokalyptischen Welt benötigt werden. Angeregt ist die Arbeit von dem gleichnamigen Buch ‚News from Nowhere’ (1890) von Wiliam Morris, dem Begründer des Arts and Crafts Movement.
Anachronistisch erscheint Michael Rakowitz’ Archiv nachgemeißelter Bücher, bestehend aus den bibliophilen Verlusten, die das Friedericianum im 2. Weltkrieg zu beklagen hatte.[3] Im Rahmen eines Steinmetz-Seminars in Bamiyan, das dazu diente, die handwerklichen Fähigkeiten wiederzubeleben, gerät hier ein anderer Ort in den Fokus, der rezenter Schauplatz grausamer Handlungen ist.
Die Zerstörung von Kulturgut scheint zum Mechanismus moderner Kriegsführung zu gehören. Prominente Beispiele sind die unter Unterbeschussnahme der afghanischen Buddhastatuen, die Zerstörung des Weltkulturerbes in Timbuktu, aber auch die alliierte Bombardierung mitteldeutscher Städte. Der Wissenspeicher Buch als Steinskulptur bildet zwar das Objekt in seinen Dimensionen und Eigenschaften nach, nie wieder jedoch wird man die Seiten umblättern können.

d (13) Michael Rakowitz by Mizzi Schnyder
Ich fragte mich, inwieweit fiktive Rückblicke zwischen 1933 und 1945 ein Innehalten bewirken hätten können. Kann die Kunst heute in der Welt Einhalt gebieten? Kann sie die Welt verändern, oder wird sie dann selbst totalitäre Haltung?

d (13) Theaster Gates by Mizzi Schnyder
Komplementär zur Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit markierte jene mit der realen regionalen nationalsozialistischen Vergangenheit das Herzstück der documenta. Emotional bewegend und zugleich unfassbar ist die Geschichte des Klosters Breitenau. Carolyn Christov-Bakargiev hatte zur künstlerischen Auseinandersetzung mit diesem Ort unweit von Kassel eingeladen. Im 12. Jahrhundert gegründet, bildet eine imposante romanische Basilika das Zentrum der Anlage.[4]
Nach der Reformation und der Auflösung des Klosters wurde in das Langhaus eine „Korrektions- und Landarmenanstalt“ eingebaut. Der Gemeinde dienten währenddessen Chor und Querhaus als Kirche. In dieser räumlichen Konstellation wurde die Basilika während des NS als Konzentrationslager und als Arbeitserziehungslager genutzt.
So setzt sich eine unrühmliche Vergangenheit in einer ungleich grausameren Geschichte nahtlos fort. Ihre Fortsetzung erfuhr sie in Form eines Mädchenerziehungsheimes, das als Resultat der Heimkampagne in den 1970er Jahren aufgelöst wurde. Das Wissen um die nationalsozialistische Geschichte allerdings war bis 1981 restlos aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt.
Breitenau scheint ein paradigmatisches Beispiel zu sein. Die Verdrängung fand hier simultan statt. Durch eine Art segmentierte Wahrnehmung – so lässt sich allenfalls mutmaßen – konnte der Ort gleichzeitig zur religiösen Erbauung wie auch zur Disziplinierung benutzt werden. Diachronisch manifestierte sich das Verdrängen anschließend nicht nur im Verschweigen der Verbrechen, sondern in deren gezielter Auslöschung. So wurde Breitenau nach 1945 wieder zum Kulturgut von allerhöchstem kunsthistorischen Rang.

d (13) Haris Epaminonda und Daniel Gustav Cramer by Mizzi Schnyder
Eine artistic research von 1981, durchgeführt von Studierenden der Gesamthochschule Kassel, deckte diese Vergangenheit auf.[5] Inzwischen selbst historisch wertvoll, dokumentiert die vertonte Diashow die damals angestellten Recherchen zur Vergangenheit Breitenaus. Inzwischen wurde im Kloster eine Gedenkstätte eröffnet und steht der Forschung offen.
Die Arbeit von Gunnar Richter wurde in einem der Pavillons in der Karlsaue gezeigt. Gewissermaßen entschleunigt bewegte sich der Besucher durch das riesige Parkgelände auf verschlungenen Wegen. Und überhaupt verhielt sich das Ausstellungskonzept diesmal widerständig gegen den allgemeinen Kunstkonsum. Kleine separierte architektonische Einheiten provozierten lange Wegzeiten und Warteschlangen, diese wiederum zahlreiche soziale Interaktionen der sonst anonymisierten Masse von Ausstellungsbesuchern.
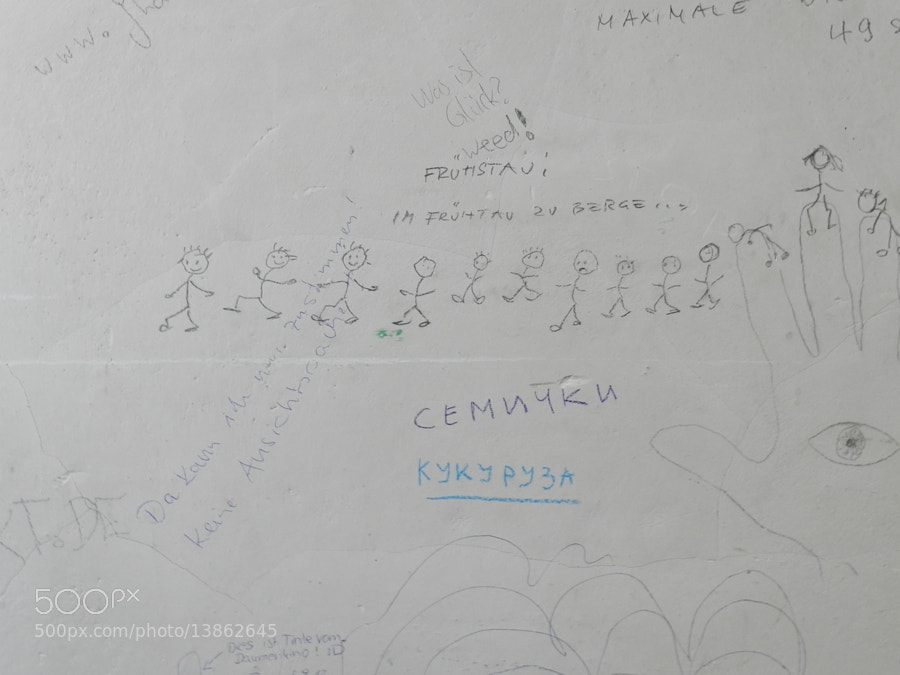
Warten auf Tacita Dean I by Mizzi Schnyder
Können Begriffe wie „Arbeitslager“ oder „Konzentrationslage“ dem Geschehenen gar gerecht werden, sondern bleiben sie Worte, so gibt es Momente, in denen sie sich plötzlich mit erschreckender Bedeutung füllen. Meist sind es Einzelschicksale, die klar machen, dass diese „Worte“ in den meisten Fällen den sicheren Tod bedeuteten. Persönlich erlebte ich einen solchen Moment der Gewissheit mit Charlotte Salomons ‚Leben? Oder Theater?’.[6] Eben noch fabuliert die Anfang Zwanzigjährige über die Liebe, bis das Außen durch Verfolgung, Deportation und Angst die zarten Themen machtvoll verdrängt.

d (13) Charlotte Salomon by Mizzi Schnyder
„Wie gehst du mit deinen Erinnerungen um?“, fragt mich Janet Cardiff in dem Videowalk im Kulturbahnhof.[7]
Deutschland sei für sie das Land der Geister erzählt sie, während in der augmented reality am Bildschirm längst entschwundene Personen und Situationen erscheinen. Das Navigieren zwischen den virtuellen und den realen Personen fordert meine ganze Aufmerksamkeit. Als es im Video schneit, ist mir kalt. Frierend stehe ich schließlich an Gleis 13 und höre mir an, wie von hier aus Menschen in den Tod fuhren und später Opfer zu Tätern wurden.

d (13) Janet Cardiff & George Bures Miller by Mizzi Schnyder
Als mir plötzlich eine ältere Frau in rosa Shirt die Hand auf die Schulter legt, und fragt „Nehmen Sie da auf?“ durchfährt mich ein Schreck, wie ich ihn in Zusammenhang mit Kunstwahrnehmung noch nie erlebt habe.
Eine ähnliche Szene mit Herrn in dunklem Anzug ereignet sich übrigens in einer der letzten Sequenzen des Videowalks. Sie verfehlt ihre Wirkung.

d (13) Janet Cardiff & George Bures Miller by Mizzi Schnyder
Ich gehe zu Gleis 11, weil ich beim Zurückgeben des ipods davon höre, dass es dort eine Arbeit gibt, die für heute das letzte Mal aufgeführt wird. Aus den Lautsprechern quillt Musik, es vermischt sich mit den Quietschen der Züge und den Durchsagen am Bahnhof.[8]
Susan Philipsz lässt hier jede halbe Stunde eine Klanginstallation ertönen, die auf der ‘Studie für Streichorchester’ von Pavel Haas, die 1943 in Theresienstadt entstanden ist, basiert. Die Besucher hören andachtsvoll zu, liegen oder sitzen herum. Es ist 19.45 h, hat 25 Grad und das farbige Licht am Himmel lässt den Kaufunger Wald als schwarze Silhouette am Horizont erscheinen.

d (13) Susan Philipsz by Mizzi Schnyder
Entfernte Orte und Zeiten gewinnen für einzelne unendlich kostbare Augenblicke gegenwärtige Präsenz in dieser documenta. Sie zeigt auf eine Weise, die sich dem pädagogischen Zugang verwehrt, dass die Wunde 2. Weltkrieg noch blutet. Dass dessen posttraumatische Belastungsstörung sich noch aktiviert,[9] genauso wie die unentschärfbaren Blindgänger, die von Zeit zu Zeit in süddeutschen Großstädten hochgehen.[10]

d (13) Tacita Dean by Mizzi Schnyder
An diesem Abend in der Linie 4 sitzt die stupsend-sprechende documenta-Besucherin aus dem Kulturbahnhof schräg gegenüber. Ich erinnere mich an ihre Stimme und das Fünfzigerjahrerosa ihres Oberteils, drehe mich in das dunkle Fenster und der Zug rumpelt nach Westen.
Hier geht es zum kompletten Fotostream>>>
[1] dOCUMENTA (13). Das Begleitbuch, Ostfildern, 20012, S. 440.
[2] Ebenda, S. 190.
[3] Ebenda, S. 110.
[4] Ebenda, S. 294.
[5] Ebenda.
[6] Ebenda, S. 118.
[7] Arbeit von Janet Cardiff & George Bures Miller, siehe: ebenda, S. 334.
[8] Ebenda, S. 360.
[9] Dazu: Carolyn Christov-Bakargiev, Über die Zerstörung von Kunst – oder Konflikt und Kunst, oder Trauma und die Kunst des Heilens, in: dOCUMENTA (13), Das Buch der Bücher, Ostfildern 2012, S. 301-314.
[10] Ich beziehe mich auf die Schwabinger Sprengung vom 28.8.2012.
Quelle: http://artincrisis.hypotheses.org/153