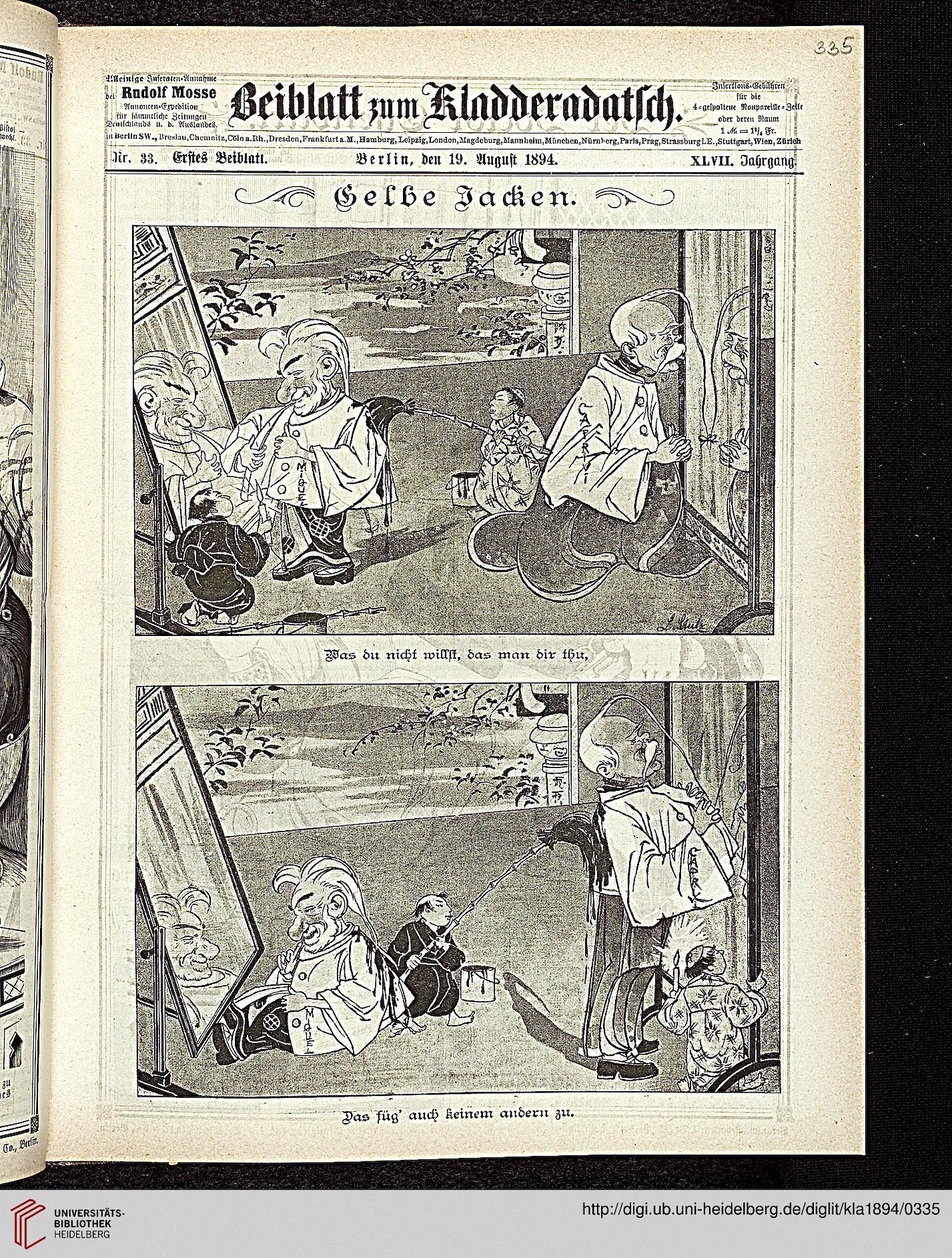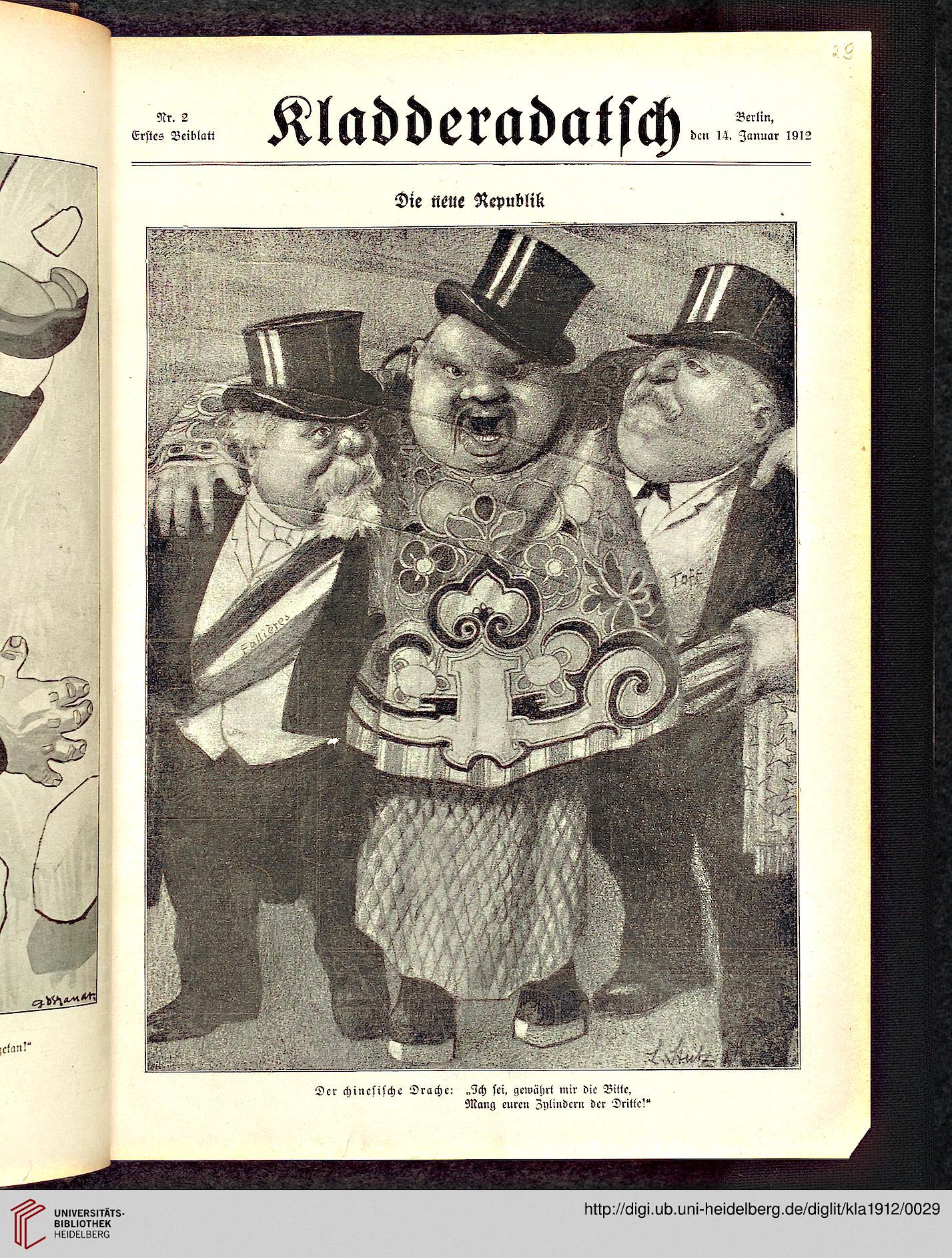Im Beitrag Sühne wurde eine Karikatur zur so genannten “Sühnegesandtschaft” diskutiert, die die Diskrepanz zwischen den Erwartungen an eine Sühnegesandtschaft und dem tatsächlichen Verlauf thematisierte. Nach dem eigentlichen Sühne-Akt überschlugen sich die Kommentare, wie das Ereigniss einzuschätzen wäre und warum sich wer wann wie verhalten hat. Eine sehr prägnante Interpretation findet sich in der Karikatur “Die verkehrten Verbeugungen.” im Kikeriki vom 15. September 1901:

Kikeriki Nr. 74 (15.9.1901) 1 | Quelle: ANNO
Die anonyme Karikatur, die knapp die Hälfte der Titelseite der Nummer ausfüllt, zeigt zwei Figuren: Rechts steht hoch erhobenen Hauptes eine männliche, europäisch markierte Figur, die durch die Pickelhaube als Deutscher und durch die Gesichtszüge (und den “Es-ist-erreicht”-Bart) als deutscher Kaiser identifiziert wird. Links steht eine durch Zopf, Kleidung und Kappe mit Pfauenfeder als ‘asiatisch’ markierte Figur. Der Asiate verbeugt sich und reckt dabei dem Deutschen den verlängerten Rücken entgegen, auf dem ein lachendes Gesicht aufgemalt ist.
Darunter eine kurze Zeile:
Wahrscheinlich hat _diese_ Concession den Prinzen Tschun zur Reise nach Berlin bewogen.
Ohne Wissen um den Kontext erscheint das Bild eher banal und nicht besonders originell.
Was ist daran bemerkenswert, dass ein je nach Blickwinkel lächelndes oder hämisch grinsendes) komisches Männchen einer ebenso merkwürdig adjustierten Figur den Allerwertesten entgegenreckt?
Wie aber kommt man (so der Kontext nicht geläufig ist, darauf, was/wer gemeint sein könnte bzw. gemeint ist?
Es empfiehlt sich ein Blick in überregionale Tageszeitungen vom September 1901 nach Berichten über China und das Deutsche Reich und/oder einen Chinesen beim deutschen Kaiser. Für den Anfang sollten einige Berichte genügen:
- Neuigkeits-Welt-Blatt Nr. 200 (1.9.1901), 1; Nr. 203 (5.9.1901) 1 f.
- Neue Freie Presse Nr. 13301 (5.9.1901) 1-3 (mit Abdruck der beim Sühne-Akt gehaltenen Reden)
- Das Vaterland Nr. 243 (5.9.1901) 1 und 3.
- Die Arbeiter-Zeitung Nr. 243 (5.9.1901) 1.
- Pester Lloyd Nr. 212 (5.9.1901) 3.
Im Neuigkeits-Welt-Blatt heißt es am 5. September 1901:
In dem an den seltsamsten Zwischenfällen überreichen Drama des Kreiges mit _China_ darf die jüngste Episode, die famose _Sühn-Expedition_ des Prinzen _Tschun_ als eine der interessantesten erscheinen, wiewohl sie in ihrem Verlaufe nahe daran war, zu einer Farce herabzusinken. [...] Prinz Tschun weigerte sich, die sichere Schweiz zu verlassen, ehe man in Berlin von dem geforderten “Kotau”[1] Abstand nahm.
Diese echt chinesische Zeremonie besteht in einer dreimaligen tiefen Verbeugung des Oberkörpers und einer neunmaligen Rumpfbeuge, und ihre Durchführung erschien dem chinesischen Prinzen, dem Bruder des Kaisers von China, als eine zu große Demüthigung, obgleich sie in China selbst weder unter Prinzen noch unter Mandarinen etwas Seltsames ist.
Nun ist eine Sühneleistung, die nach dem Ausmaß der Verbeugungstiefe berechnet wird, allerdings eine Forderung, der man auch in den Bevölkerungskreisen Deutschlands wenig Geschmack abgewinnen kann, allein es liegt dem Begehren des deutschen Kaisers doch ein tieferer Sinn zu Grunde. In China spielt eben das Zeremoniell in allen Dingen, namentlich aber im Verkehr mit den Vertretern des Auslandes eine große Rolle. Sollten die chinesischen Machthaber den vollen Ernst ihrer Pflicht, für das begangene Verbrechen des Gesandtenmordes Buße zu thun, erkennen, dann müßte dies auch in einer Form geschehen, die ihrem eigenen, dem chinesischen Zeremoniell entspricht und gerade aus der Weigerung des Prinzen Tschun, sich dieser Forderung zu unterwerfen, kann man den Schluß ziehen, daß es den Chinesen noch immer beliebt, Europa mit den gewohnten Ränken zu begegnen.[2]
Und in der sozialdemokratischen Arbeiter-Zeitung vom selben Tag heißt es:
[...] Dem maßlos eitlen Sinn des deutschen Kaisers mag es schmeicheln, die Chinesen einmal so anschnauzen zu dürfen, wie er es sonst nur mit seinen “Unterthanen” wagen dard; aber ob die erlittene Demüthigung den Chinesen imponiren, sie einschütern wird, ist noch sehr die Frage [...][3]
Damit wird klar, was dem zeitgenössischen Leser im September 1901 niemand erklären musste: Die chinesische Seite hat Abbitte geleistet, doch wäre zu bezweifeln, ob das von der chinesischen Seite allerdings tatsächlich ernst genommen wurde.
―
- Zum “Kotau” s. den Beitrag Kotau – die chinesische Ehrenbezeugung von Georg Lehner auf De rebus sincis.
- Neuig-keits-Welt-Blatt Nr. 203 (5.9.1901) 1 – Online: ANNO.
- Arbeiter-Zeitung Nr. 243 (5.9.1901) 1 – Online: ANNO.
![By Неизвестен (Скан иллюстрации в Punch) [Public domain], via Wikimedia Commons By Неизвестен (Скан иллюстрации в Punch) [Public domain], via Wikimedia Commons](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA_-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4.jpg)