Archiv-August #3.3: Von Feuerbach bis Bredekamp Zur Geschichte zeitgenössischer Bilddiskurse
Archiv-August #3.3: Der dritte Teil des dritten Beitrags unserer Reihe erschien erstmals am 29. Februar 2016. Viel Spaß beim Lesen!
Bilderstreit und iconic turn
Bilddiskurse der Gegenwart um den neuen Status des Bildes
Die Bilddiskurse des wiedervereinigten Deutschlands fokussierten zum einen auf die Frage nach dem Umgang mit den Bildern der unmittelbaren deutschen Vergangenheit, denen der NS-Zeit und der DDR wie denen der jüngsten bundesdeutschen Geschichte, zum anderen stellten sie allgemein die Frage nach dem neuen Status der Bilder in der digitalen Gesellschaft.
[...]
Vortrag: “Popgeschichte als Zeitgeschichte” (Audio)
Muss sich die Zeitgeschichte stärker der Sphäre von Pop zuwenden — und wie lässt sich diese umschreiben? Welche etablierten Verfahren stehen bereits zur Verfügung und wo sind noch Blindstellen? Gibt es neue Methoden und Quellen, die zu Rate gezogen werden müssen? Etliche Initiativen haben sich in den vergangenen Jahren dieser Fragen angenommen. Der Vortrag gibt einen Überblick über diese Diskussion, führt in Grundbegriffe wie Volks- und Massenkultur, das Populäre und Pop ein und arbeitet anhand einer Musik-Aufnahme (aus urheberrechtlichen Gründen aus dem Audio herausgeschnitten) die Verschränkungen zwischen Pop und Geschichte beispielhaft heraus.
Eine Aufnahme der Beatles wird mit Schriftdokumenten aus unterschiedlichen Archiven gelesen. Anhand des Beispiels werden Zugänge der Protest-, Konsum-, Wirtschafts-, Sozial- und Politikgeschichte diskutiert. Popgeschichte wird im Kontrast zu diesen etablierten Verfahren als Perspektive vorgestellt, die ästhetische Ereignisse nicht als Nebensache oder „weicher Faktor” der Geschichte marginalisiert, sondern als relevantes Feld für die Zeitgeschichte der Massendemokratien und Mediengesellschaften des 20. Jahrhunderts versteht, das Differenzen konstituierte und Politiken und Ökonomien hervorbrachte.
[...]
Vortrag: “Popgeschichte als Zeitgeschichte” (Audio)
Muss sich die Zeitgeschichte stärker der Sphäre von Pop zuwenden — und wie lässt sich diese umschreiben? Welche etablierten Verfahren stehen bereits zur Verfügung und wo sind noch Blindstellen? Gibt es neue Methoden und Quellen, die zu Rate gezogen werden müssen? Etliche Initiativen haben sich in den vergangenen Jahren dieser Fragen angenommen. Der Vortrag gibt einen Überblick über diese Diskussion, führt in Grundbegriffe wie Volks- und Massenkultur, das Populäre und Pop ein und arbeitet anhand einer Musik-Aufnahme (aus urheberrechtlichen Gründen aus dem Audio herausgeschnitten) die Verschränkungen zwischen Pop und Geschichte beispielhaft heraus.
Eine Aufnahme der Beatles wird mit Schriftdokumenten aus unterschiedlichen Archiven gelesen. Anhand des Beispiels werden Zugänge der Protest-, Konsum-, Wirtschafts-, Sozial- und Politikgeschichte diskutiert. Popgeschichte wird im Kontrast zu diesen etablierten Verfahren als Perspektive vorgestellt, die ästhetische Ereignisse nicht als Nebensache oder „weicher Faktor” der Geschichte marginalisiert, sondern als relevantes Feld für die Zeitgeschichte der Massendemokratien und Mediengesellschaften des 20. Jahrhunderts versteht, das Differenzen konstituierte und Politiken und Ökonomien hervorbrachte.
[...]
Handschriften der Stadtbibliothek Ulm
Der wertvolle Handschriftenbestand (rund 150 aus Mittelalter und früher Neuzeit) der Stadtbibliothek Ulm ist so gut wie unbekannt, da eine veröffentlichte Erschließung nicht existiert. Bernhard Appenzeller wusste nicht, welcher Lehrstuhl sich derzeit um die Erschließung kümmert, aber nach meinem Besuch fand ich im Internet, dass es wieder einmal Hiram Kümper ist.
Highlights des Altbestands beleuchtet die Website der Bibliothek, den Drucken und der Bibliotheksgeschichte widmet sich knapp der Artikel im Fabian-Handbuch.
Mir wurde gestattet, die völlig unzulängliche Erschließung auf Karteikarten (siehe Bilder) durchzusehen. Während die in den Magazinen des Stadtarchivs untergebrachten Altbestände via Zwangs-Benutzung im Stadtarchiv einem strikten Fotografierverbot unterliegen, konnte ich den erbärmlichen Karteikasten und die Karten unbehelligt ablichten. Neben abgetippten Karten mit meist allzu rudimentären Angaben (siehe Beispiele) gibt es in den Kasten gesteckte Päckchen von fotokopierten Karteikarten aus einem alten handschriftlichen Katalog. Wie man angesichts dieser desaströsen Erschließung sachkundig etwa zum Bestand der frühneuzeitlichen Handschriften Auskunft erteilen kann, ist mir ein Rätsel.
[...]
Handschriften der Stadtbibliothek Ulm
Der wertvolle Handschriftenbestand (rund 150 aus Mittelalter und früher Neuzeit) der Stadtbibliothek Ulm ist so gut wie unbekannt, da eine veröffentlichte Erschließung nicht existiert. Bernhard Appenzeller wusste nicht, welcher Lehrstuhl sich derzeit um die Erschließung kümmert, aber nach meinem Besuch fand ich im Internet, dass es wieder einmal Hiram Kümper ist.
Highlights des Altbestands beleuchtet die Website der Bibliothek, den Drucken und der Bibliotheksgeschichte widmet sich knapp der Artikel im Fabian-Handbuch.
Mir wurde gestattet, die völlig unzulängliche Erschließung auf Karteikarten (siehe Bilder) durchzusehen. Während die in den Magazinen des Stadtarchivs untergebrachten Altbestände via Zwangs-Benutzung im Stadtarchiv einem strikten Fotografierverbot unterliegen, konnte ich den erbärmlichen Karteikasten und die Karten unbehelligt ablichten. Neben abgetippten Karten mit meist allzu rudimentären Angaben (siehe Beispiele) gibt es in den Kasten gesteckte Päckchen von fotokopierten Karteikarten aus einem alten handschriftlichen Katalog. Wie man angesichts dieser desaströsen Erschließung sachkundig etwa zum Bestand der frühneuzeitlichen Handschriften Auskunft erteilen kann, ist mir ein Rätsel.
[...]
Studierendenwissen.de. Datenbank für studentische Hausarbeiten und wissenschaftliche Diskussionsplattform
„Sehnsucht Finnland“ – vom Suchen und Finden einer Nation
von Heide Matz und Anne-Kristin Beinhauer
Stockholm, Paris, Hamm – mit der Sonderausstellung „Sehnsucht Finnland – Skandinavische Meisterwerke um 1900“ feiert das Gustav-Lübcke-Museum in Hamm seine Wiedereröffnung. Die Ausstellung ist der finnischen Kunstszene des späten 19. Jahrhunderts gewidmet.
Der Titel ist Programm: die Sehnsucht und Suche der Finnen nach Selbstständigkeit. Finnland wurde erst im Jahre 1917, und damit vergleichsweise spät, unabhängig. Ein Volk, das sich durch die jahrhundertelange Abhängigkeit von Schweden und Russland stets als Teil von etwas, aber bislang nie als eigenständige Nation begreifen konnte, strebt nach seiner eigenen Identität. „Sehnsucht Finnland“ vereint in seiner Werkauswahl Darstellungen 30 Maler finnischer, sowie schwedischer und russischer Herkunft, und spiegelt damit das Terzett kultureller Einflüsse wider, aus dem Finnland 1917 als eigenständige Nation hervorging. Bekannte Namen wie Akseli Gallén-Kallela, Hugo Simberg, Pekka Halonen sowie Helene Schjerfbeck und Victor Westerholm führen mit ihren Werken durch die Geschichte des Landes an der Peripherie Europas und verdeutlichen das Nationalbestreben sowie die Problematik der Identitätsbildung.
[...]
„Sehnsucht Finnland“ – vom Suchen und Finden einer Nation
von Heide Matz und Anne-Kristin Beinhauer
Stockholm, Paris, Hamm – mit der Sonderausstellung „Sehnsucht Finnland – Skandinavische Meisterwerke um 1900“ feiert das Gustav-Lübcke-Museum in Hamm seine Wiedereröffnung. Die Ausstellung ist der finnischen Kunstszene des späten 19. Jahrhunderts gewidmet.
Der Titel ist Programm: die Sehnsucht und Suche der Finnen nach Selbstständigkeit. Finnland wurde erst im Jahre 1917, und damit vergleichsweise spät, unabhängig. Ein Volk, das sich durch die jahrhundertelange Abhängigkeit von Schweden und Russland stets als Teil von etwas, aber bislang nie als eigenständige Nation begreifen konnte, strebt nach seiner eigenen Identität. „Sehnsucht Finnland“ vereint in seiner Werkauswahl Darstellungen 30 Maler finnischer, sowie schwedischer und russischer Herkunft, und spiegelt damit das Terzett kultureller Einflüsse wider, aus dem Finnland 1917 als eigenständige Nation hervorging. Bekannte Namen wie Akseli Gallén-Kallela, Hugo Simberg, Pekka Halonen sowie Helene Schjerfbeck und Victor Westerholm führen mit ihren Werken durch die Geschichte des Landes an der Peripherie Europas und verdeutlichen das Nationalbestreben sowie die Problematik der Identitätsbildung.
[...]
Tresantis (Hg.): Die Anti-Atom-Bewegung. Geschichte und Perspektiven; 2015
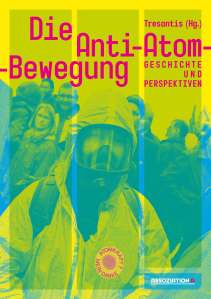 Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten in NRW ist es eine Meldung wert: Im Dreiländereck, kurz hinter Aachen, knapp 100 Kilometer süd-westlich von Düsseldorf, steht auf belgischer Seite in Tihange ein vor sich hin rottendes Atomkraftwerk – in trotz Sicherheitsbedenken bald wieder voller Nutzung. Die Büchse der Pandora direkt vor der Haustür. Die Städteregion Aachen hat jüngst beschlossen, gegen jeden weiteren Betrieb des AKW zu klagen. Zeit, sich über Geschichte und Perspektiven einer autonomen Anti-AKW-Bewegung Gedanken zu machen. Das Herausgeber*innen-Kollektiv Tresantis bringt hierzu Anregendes zusammen.
Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten in NRW ist es eine Meldung wert: Im Dreiländereck, kurz hinter Aachen, knapp 100 Kilometer süd-westlich von Düsseldorf, steht auf belgischer Seite in Tihange ein vor sich hin rottendes Atomkraftwerk – in trotz Sicherheitsbedenken bald wieder voller Nutzung. Die Büchse der Pandora direkt vor der Haustür. Die Städteregion Aachen hat jüngst beschlossen, gegen jeden weiteren Betrieb des AKW zu klagen. Zeit, sich über Geschichte und Perspektiven einer autonomen Anti-AKW-Bewegung Gedanken zu machen. Das Herausgeber*innen-Kollektiv Tresantis bringt hierzu Anregendes zusammen.
Der Weg der Klage war es nie. Ein großer Teil der Anti-AKW-Bewegung beruhte vielmehr auf Selbstorganisation und auf direkter Aktion an den Zufahrtswegen bis hin zu gelegentlicher Militanz an den Bauzäunen. Mit dem Ende 2015 erschienenen Buch „Die Anti-AKW-Bewegung“ hat das Schreib- und Herausgeber*innen-Kollektiv Tresantis jetzt einen druckfrischen, wichtigen Beitrag zur Geschichte und Praxis jenes Teils des anti-atomaren Protestes vorgelegt, der nicht Bestandteil der Eventindustrie der großen Campaigning-Strukturen aus Umwelt- und Naturschutzorganisationen oder Kapitalismus- und Lobby-kritischen Organisationen wie BUND, campact oder attac ist(1). Damit ist eine empfindliche Lücke zur Bewegungsgeschichte gefüllt, die hilft zu begreifen, was es heißt, gegen Atomkraft und gegen eine auf Nukleartechnik fußende Energiepolitik eingetreten und standhaft geblieben zu sein.
[...]
