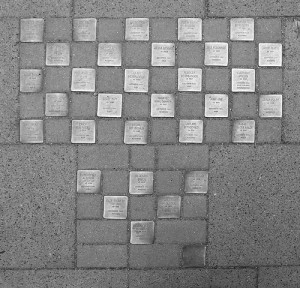23. Histofloxikon, Dritte Lieferung
Nach der ersten und der zweiten, hier nun die dritte Lieferung historischer Floskeln und Allgemeinplätze.
Ein Jahrhundertereignis!
 Es ist eigentlich zu offensichtlich, als dass man besonders viel Zeit dafür verschwenden müsste: Die beständige Ausrufung von Jahrhundertereignissen hat
Es ist eigentlich zu offensichtlich, als dass man besonders viel Zeit dafür verschwenden müsste: Die beständige Ausrufung von Jahrhundertereignissen hat
schon seit geraumer Zeit solch inflationäre Ausmaße angenommen, dass sie sich selbst ad absurdum führt. So viele Jahrhunderte bleiben unserem Planeten gar nicht mehr, dass sie den entsprechenden einschneidenden Ereignissen noch zu entsprechen vermögen. Wenn es sich nicht um eine wirklich dröge Sisyphusarbeit handeln würde, könnte sich eine Auszählung all dieser proklamierten Jahrhundertereignisse einmal lohnen. Beinahe täglich findet irgendwo eines statt.
Eine Kultur geht recht verschwenderisch mit ihrer historischen Zeit um, wenn sie überall solche säkularen Geschehnisse ausmacht. Eine simple Google-Abfrage bringt unter anderem folgende Ergebnisse zutage: 50 Bewohner von Eichsfeld erlebten den Guss einer Glocke in Gescher als Jahrhundertereignis, der Bürgermeister von Waldstetten erklärte den Empfang der frisch gebackenen Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt zum Jahrhundertereignis (der eigentlich nur noch durch einen Papst-Besuch zu toppen sei), in Schwäbisch Gmünd wurde die Einweihung des Einhorn-Tunnels und damit die Freigabe der teuersten Ortsumgehung Deutschlands als ein Jahrhundertereignis gefeiert und im März 2013 erwies sich das Einströmen grönländischer Polarluft nach Ostdeutschland mit entsprechenden Temperatur-Minusrekorden als meteorologisches Jahrhundertereignis. So weit, so bekannt. Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen.
Dass solche Titulierungen nicht die Luxzahl wert sind, mit der sie einem vom Bildschirm entgegenflimmern, muss kaum erwähnt werden. Warum aber diese Sehnsucht, aus Hochwassern, Fußballspielen, Kirchenrenovierungen oder Landesgartenschauen immer gleich einen unumgänglichen Eintrag in die Geschichtsbücher zu machen? Abgesehen davon, dass es sich um einen unübersehbaren Mangel an sprachlicher Differenzierungsfähigkeit handelt (Weltberühmt in Radolfzell!), ist diese Suche nach historischen Superlativen, die sich kaum noch steigern lässt (es sei denn durch Ereignisse, die einem Jahrtausend oder gleich der ganzen Menschheit zur Denkwürdigkeit aufgegeben wären) ein typischer Ausfluss modernistischen und fortschrittsgeschichtlichen Denkens. Vielleicht zeigt sich nirgends deutlicher als gerade bei diesen vermeintlich nebensächlichen, nicht wirklich ernst zu nehmenden historischen Übertreibungen, wie sehr ein überhitztes Geschichtsdenken, das nur noch in olympischen Kategorien zu funktionieren vermag (höher! schneller! weiter!), inzwischen ins Leere läuft.
Geschichte wiederholt sich (nicht)
Kniffliger Fall eines historischen Gemeinplatzes, zumal er in zwei entgegengesetzten Varianten aufzutreten pflegt. Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht – so möchte man voller Überzeugung ausrufen –, schließlich sehen wir uns einem linearen Zeitmodell verpflichtet, bei dem die Zeit aus dem Gestern kommt, um ohne Wenn und Aber in das Morgen fortzuschreiten. Mit einem solchen Verzicht auf die zyklische Wiederkehr des Gewesenen kann sich Geschichte nicht wiederholen. Und wenn selbst der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht zu überzeugen vermag, so kann einen doch die Alltagserfahrung lehren, dass man das Gestern nicht zurückholen kann. Immer wieder ernüchterndes Beispiel: Klassentreffen.
Bevor wir die Wiederholung aber allzu schnell zu den Akten legen, lohnt sich unter Umständen ein genauerer Blick auf das Vokabular. Was war nochmal mit „Geschichte“ und was mit „Wiederholung“ gemeint? Dasjenige, was sich hier nicht wiederholen soll, scheint doch viel eher die Vergangenheit als ein Zeitraum zu sein, in dem wir all diejenigen Geschehnisse unterzubringen pflegen, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen (eben das wäre der zweite Hauptsatz der Thermodynamik auf das Leben von Menschen und Kulturen angewandt). Geschichte ist hingegen bekanntermaßen die Erzählung, die wir uns selbst von dieser Vergangenheit erzählen. Und diese Geschichte lässt sich nicht nur wiederholen, es ist uns sogar ein kulturhistorisch gewachsenes Bedürfnis, diese Erzählung zu repetieren und zu variieren, immer wieder neu aufzufrischen und vielleicht sogar neue Seiten an ihr zu entdecken.
Was uns unmittelbar zur „Wiederholung“ führt. Nicht nur, dass die Wiederholung als Kulturtechnik ganz ungerechtfertigter Weise ein Schattendasein führt, weil sie mit unserem neuheitsversessenen Fortschritts- und Wachstumsdenken so gar nicht in Einklang zu bringen scheint (siehe oben: Jahrhundertereignisse!), sie wird zudem auch noch missverstanden, wenn man damit die Wiederkehr des identisch Gleichen zu bezeichnen meint. Aber die Wiederholung ist keine Kopie. Sie ist tatsächlich eine Wieder-Holung, also der Versuch, etwas erneut hervorzukramen, mit dem man sich schon einmal beschäftigt hat. Die Zeit, die zwischen einer ersten und einer späteren Auseinandersetzung mit einem bestimmten Gegenstand verstrichen ist, setzt aber bereits eine Differenz, die dafür sorgt, dass Wiederholung nicht mit Identität zu verwechseln ist. Schließlich haben sich beide Seiten in der Zwischenzeit gewandelt, der betrachtete Gegenstand sowie das betrachtende Subjekt. Und auch die erneute Beschäftigung wird eine Veränderung dieser Beziehung nach sich ziehen. Wiederholungen sind für die Konstitution unserer Kultur wesentlich bedeutsamer, als wir dies gemeinhin zuzugeben bereit sind.
Vielleicht wäre es daher Zeit für eine neue Floskel: Vergangenheit kann sich nicht wiederholen – Geschichte muss man wiederholen.
Die Vergangenheit ruhen lassen
Wenn die Vergangenheit schon der Container ist, in dem wir all die ehemaligen Aktualitäten unterbringen können, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen (all die zerbrochenen Gläser, die sich nicht mehr zusammensetzen, die Jugendzeiten, die sich nicht noch einmal durchleben, die Ereignisse, die sich nicht mehr revidieren lassen), dann sollte sie doch auch der Ort sein, um all das loszuwerden, was uns bedrücken könnte. Vergessen wir also die Niederlagen, Peinlichkeiten, Beschämungen und Verletzungen, die wir ausgeteilt und empfangen haben, und verbrennen wir sie gemeinsam mit den Kalendern vom letzten Jahr.
Aber wenn das mit der Friedhofsruhe der Vergangenheit so einfach wäre, müsste man sie wohl kaum gesondert beschwören. Man darf eher den Verdacht haben, dass der Wunsch nach einer Vergangenheit, die abgeschlossen und vergessen sein möge, mit der Versicherung einhergeht, nicht erfüllt zu werden. Denn auch hier lehrt uns die Alltagserfahrung, dass man Gewesenes nicht einfach so abschütteln kann, dass die Geschichten uns nicht nur verfolgen, sondern zuweilen unwillentlich überfallen. Das Verlangen, die Vergangenheit ruhen zu lassen, wird also nicht selten dadurch konterkariert, dass die Vergangenheit uns nicht in Ruhe lässt.
Daraus lässt sich vielleicht weniger lernen, dass die Vergangenheit ein eigenständiges Leben unabhängig von unserem Wollen und Wirken führt und gewissermaßen autonom entscheiden könnte, wie und wo und wann sie uns auf die Pelle rückt. Eher könnte sich damit die Einsicht verbinden, dass der Mensch ein polychrones Wesen ist, das zwar in einem Hier und Jetzt existiert, dabei aber immer in der Lage ist, Relationen der unterschiedlichsten Art zu bereits Gewesenem und noch Kommendem aufzubauen. Und es sind diese Relationen, die sich nicht bis ins letzte kontrollieren lassen. Deswegen kann uns mitunter eine Vergangenheit nicht in Ruhe lassen, die schon längst (oder eben gerade nicht) erledigt zu sein scheint. Und deswegen kann uns auch eine Zukunft Angst einjagen (oder Hoffnung machen oder andere Gefühle auslösen), die uns noch gar nicht zur Verfügung steht.
Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtstheorie, Zeit und Geschichte Tagged: Floskel, Gemeinplatz, Geschichte wiederholt sich nicht, Jahrhundertereignis, Vergangenheit ruhen lassen
Quelle: http://achimlandwehr.wordpress.com/2014/04/12/23-histofloxikon-dritte-lieferung/
22. Flache Geschichte
Das missbrauchte Früher
Es gilt von einem Missbrauch zu berichten: Ein Missbrauch, der schon oft beklagt und in zahlreichen Fällen verübt wurde, dessen Alltäglichkeit eigentlich bekannt sein müsste, der sich aber trotzdem beständig wiederholt. Es geht um den Missbrauch an der Vergangenheit für unlautere Zwecke der Gegenwart.
Der Umgang mit der Vergangenheit bietet an sich zahlreiche Möglichkeiten. Leider werden eher wenige davon genutzt. Man könnte die Vergangenheit intensiv und in allen Details untersuchen, man könnte versuchen, mit Hilfe des Gestern ein besseres Heute zu basteln, und manche könnten sogar versucht sein, aus der Vergangenheit etwas zu lernen. Gerade in öffentlichen Schnellschussdebatten, im alltäglichen Gebrauch sowie in standardisierten Geschichtsvermittlungsverfahren herrscht jedoch nicht selten ein anderer Umgang mit der Vergangenheit vor: Man will dort nur bestätigt finden, was man ohnehin schon weiß.
Man muss es sich ja nicht kompliziert machen, wenn man es auch einfach haben kann. Aber wie einfach darf man es sich machen? Wie einfach darf man es sich insbesondere im Umgang mit denjenigen machen, die sich nicht mehr wehren können, weil sie bereits unter der Erde liegen? Und was helfen uns solche Vereinfachungen hier und heute?
Der bequeme Weg ins Gestern
Nehmen wir zur Verdeutlichung ein offensichtliches Beispiel. Die Einteilung in Geschichtsepochen ist eine etablierte und im europäischen Kontext schon seit mehreren Jahrhunderten geübte Praxis, die insbesondere zur Orientierung im historischen Durcheinander hilfreich sein mag, zugleich aber ihre unübersehbaren Schwierigkeiten hat. Diese Schwierigkeiten wurden schon weidlich diskutiert. Denn die Unterteilung in Antike, Mittelalter und Neuzeit (mitsamt allen Substrukturen) teilt das Schicksal aller Formen des Überblicks: Man erhält eine Übersicht über Vieles, muss dabei aber zwangsläufig vieles übersehen.
An dieser Stelle müssen nicht die vielfach geführten Debatten über das Pro und Contra von Epocheneinteilungen nacherzählt werden. Im Falle von übermäßiger Vereinfachung des Gewesenen wird man aber immer auf folgende paradoxe Situation stoßen: Dass Epocheneinteilungen die rückwärtsgewandten Konstrukte der Nachgeborenen sind, versteht sich von selbst. Die Menschen des Mittelalters hatten keine Ahnung davon, dass sie im „Mittelalter“ lebten. Fatal wird diese diskursive Anordnung jedoch dann, wenn die gleichen Nachgeborenen selbstverständlich annehmen, dass sich diese Menschen nun entsprechend des Konstrukts „Mittelalter“ zu benehmen hätten beziehungsweise sich wundern, wenn sie genau das nicht tun! Wenn das stark vereinfachte Abbild einer historischen Rückschau an die Stelle der Komplexität tatsächlicher Verhältnisse gesetzt wird – spätestens dann muss die geschichtswissenschaftliche Staatsanwaltschaft einschreiten und Anklage im Fall von übergroßer Simplifizierung erheben.
Je weiter vergangene Zeiten chronologisch von unserem eigenen Hier und Jetzt entfernt sind, umso schneller sind wir bereit, diese vergangenen Zeiten vergröbernd darzustellen. Auch das lässt sich ganz leicht belegen, wenn wir aktuelle Vorschläge für epochale Einschnitte in der westlich-europäischen Geschichte näher betrachten: Aufgrund von 9/11 ist 2001 der bisher letzte Vorschlag, 1989 ist ebenso ein offensichtlicher Kandidat, davor kann man 1972 (Ölkrise, Bericht des Club of Rome) oder 1968 als mögliche Kandidaten ausmachen, davor tummeln sich 1945 und 1914. Allein im (verlängerten) 20. Jahrhundert also sechs mögliche Epochenumbrüche. Davor muss man bereits ins Jahr 1789 springen, um einen nächsten epochalen Orientierungspunkt auszumachen, dann sind es wieder drei Jahrhunderte bis etwa 1500, dann gibt es einen Riesensprung bis etwa 500 – und danach verliert sich das Ganze in den Untiefen der Geschichte. Kompliziert ist also immer nur da, wo wir selbst sind. Davor wird es einfacher – zu einfach! Und wenn die Konstrukte, die wir fabrizieren, so übermächtig werden, dass sie den Blick auf die Vergangenheit nicht erhellen, sondern ihn verstellen, dann kann man nur sagen: Schafft die Epochen ab! Dann brauchen wir einen anderen, angemesseneren Blick auf vergangene Zeiten.
Was solcherart produziert wird, ist eine flache Geschichte, die keine Winkel und Kanten hat, keinen Widerstand bietet, sondern problemlos unseren Erwartungen unterworfen wird. Geschichte wird zweidimensional. Das ist in etwa so, als würden wir die Vielfalt einer Landschaft mit der Landkarte verwechseln, die wir von ihr angefertigt haben. Flache Geschichte ist die bequeme Möglichkeit, sich von all den Kompliziertheiten und Komplexitäten zu verabschieden, die eine intensive (und damit auch zeit- und arbeitsaufwändige) Beschäftigung mit der Vergangenheit mit sich bringt. Flache Geschichte ist die gut ausgebaute Autobahn zur historischen Erkenntnis. Aber wieviel Ignoranz verträgt die Vergangenheit, bevor sie zur Parodie verkommt?
Eine Ethik der Geschichtsschreibung
Der Ruf der akademischen Geschichtsschreibung mag nicht immer der beste sein, und dafür gibt es auch den einen oder anderen Grund: schlechter Stil, zum Beispiel, oder übergroße Spezialisierung. Aber die akademische Geschichtsschreibung übernimmt die wichtige, wenn auch nicht immer dankbare Aufgabe des Verkomplizierers, um der allenthalben vorhandenen Komplexitätsreduktion entgegenzuwirken. Und zumindest in dieser Rolle ist sie unverzichtbar. Sie muss uns vor Augen halten, dass die Dinge nicht so schlicht gestrickt sind, wie wir sie uns zuweilen machen.
Es geht also um nicht mehr und nicht weniger als um die Eindämmung der Arroganz der Gegenwart gegenüber der Vergangenheit. Wir müssen ihm begegnen, diesem hochnäsigen, modernisierungstheoretisch unterfütterten Auftritt eines Hier und Jetzt, das meint, den Höhepunkt menschlicher Entwicklungsfähigkeit erreicht zu haben und vom hohen Ross auf dieses ominöse „Früher“ herabblicken zu können, um mit einem teils bedauernden, teils süffisanten Seufzer zu konstatieren: Die waren eben noch nicht so weit wir.
Wir brauchen daher nichts weniger als eine Ethik der Geschichtsschreibung. Es geht um die Mahnung an eine hinreichende Komplexität historischer Darstellungen. Vollständigkeit kann dabei gar nicht das Ziel sein, aber eine Form der Behandlung des Gestern, die dem Vergangenen gerecht wird, sollte schon geboten sein. Man kann das in eine einfache geschichtsethische Testfrage gießen: Wollen wir so von der Zukunft behandelt werden, wie wir gerade selbst die Vergangenheit behandeln?
Stellen wir die Vergangenheit als nicht vereinfachter dar, als wir unsere eigene Gegenwart dargestellt wissen wollen. Denn ist das nicht das Schöne am Umgang mit der Vergangenheit: dass es am Ende immer komplizierter, verwickelter, bunter und damit auch erkenntnisreicher ist, als man sich das im Vorhinein ausgemalt hat?
Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtstheorie Tagged: Epoche, Geschichtsethik, Geschichtstheorie, Komplexität, Vereinfachung
Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2014/04/02/22-flache-geschichte/
21. Sarkozy und die Terminkalender
Unordnung und spätes Leid
Nicolas Sarkozy hätte gerne seine Vergangenheit zurück. Bekommt er aber nicht. Der französische Kassationshof hat als höchste gerichtliche Instanz entschieden, dass die Vergangenheit des ehemaligen französischen Präsidenten wenn auch kein nationaler Erinnerungsort, so doch zumindest Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen ist. Also bleibt diese Vergangenheit vorerst in der Obhut des Staates – dessen Stärke bei der Verfolgung von Straftätern Sarkozy als aktiver Politiker, vor allem agiler Innenminister immer wieder so gern betont hat. Ganz Populist, sprach er damals davon, die Jugendkriminalität aus den banlieues herauskärchern zu wollen. Nun ist ihm der Hochdruckreiniger selbst auf den Fersen.
Es gibt ja auch einiges zu tun, selbst wenn im Moment noch nicht klar ist, was strafrechtlich davon übrigbleiben wird. Den Überblick über die Affären und Untersuchungsverfahren kann man derzeit leichthin verlieren. Hier ist nicht der Ort, um das im Detail nachzuerzählen – zumal noch nicht mit letzter Sicherheit geklärt ist, was denn nun tatsächlich wann passiert ist. Auf jeden Fall geht es um Geld und Wahlkämpfe, um dubiose Freundschaften und befremdliche Kanäle für Spenden und Informationen. Der Prozess wegen illegaler Parteispenden der L’Oreal-Erbin Ingrid Bettencourt wurde aus Mangeln an Beweisen bereits eingestellt, aber da steht ja noch der Verdacht im Raum, vom lybischen Diktator Gaddafi Geld angenommen zu haben (auch keine politische „Freundschaft“, mit der man aktuell noch in Verbindung gebracht werden möchte…). Zudem kam beim Abhören des Mobiltelefons von Sarkozy der Verdacht auf, er hätte Informationen von einem Mitarbeiter des französischen Kassationshofes erhalten. Schließlich ist auch noch nicht geklärt, wie Bernard Tapie zu der erheblichen Entschädigungssumme von 403 Millionen Euro kam – wobei sich der den Sozialisten nahestehende Tapie vor und nach dieser Entscheidung auffallend oft mit dem konservativen Sarkozy traf. Delikat ist schließlich auch Sarkozys ehemaliger Berater Patrick Buisson, der hunderte von Gesprächen mit seinem Chef mitschnitt. Wie praktisch, wenn man der Polizei das Mitlauschen abnimmt, indem man sich die lebende Abhöranlage gleich ins Haus holt.
Synchronisation von Unterschiedlichem
Um Ordnung in diesen Wust zu bekommen, interessieren sich die Ermittlungsbehörden nun für die Vergangenheit Sarkozys in ihrer dokumentierten Form: für seine Terminkalender. So ein Terminkalender ist ein seltsam‘ Ding. Eine Ansammlung weitgehend leerer Blätter, nur versehen mit den wichtigsten Informationen zu den Tagen, Wochen und Monaten. Ansonsten nichts. Und dafür darf man auch noch Geld bezahlen. Gut, spätestens mit den elektronischen Kalendern hat sich das mit dem Bezahlen erledigt, aber das formale Prinzip ist sich gleich geblieben. Und elektronische Kalender, so würde ich mal vermuten, gehen in Regierungskreisen gar nicht. Da könnte man deren Inhalt an alle Geheimdienste dieser Welt gleich selbst übermitteln. Also werden die so genannten politischen „Entscheider“ dieser Welt (einer der hässlichsten Neologismen der Welt) ihre Termine schön abhörsicher auf Papier führen.
Dank Sarkozy wird der Terminkalender endlich einmal in das Rampenlicht gestellt, das ihm gebührt. Dieses ansonsten so unscheinbare und selbstverständliche Medium ist eine der interessantesten Erfindungen der europäischen Kulturgeschichte, weil es Indiz für ein ganz bestimmtes Zeitwissen ist, das sich keineswegs von selbst versteht. Zeit als verfügbare und beplanbare Ressource hat sich – nimmt man die Existenz von Terminkalendern als Indiz – nicht vor dem späten 17. Jahrhundert als Idee durchgesetzt. Damit wurde es möglich, unterschiedliche Dinge zur gleichen Zeit zu synchronisieren – zum Beispiel Treffen mit diversen Wahlkampfspendern.
Werbepause
Wir unterbrechen unsere Argumentation an dieser Stelle für einen kurzen Werbeblock: Vielleicht nicht ganz passend zur französischen Staatsaffäre, aber durchaus passend zum größeren thematischen Zusammenhang möchte ich gänzlich unbescheiden an dieser Stelle auf mein neues Buch aufmerksam machen: Geburt der Gegenwart. Eine Geschichte der Zeit im 17. Jahrhundert. Zugegeben, es handelt nicht von Sarkozy oder sonstigen mehr oder minder tagesaktuellen Angelegenheiten. Tatsächlich konzentriert es sich mit dem 17. Jahrhundert sogar auf einen Zeitraum, der nun tatsächlich verhältnismäßig weit weg von unserer eigenen Gegenwart zu sein scheint. Aber Aktualität bemisst sich ja nicht nur nach diachroner Nähe oder Ferne, sondern nach Relevanz für unser Hier und Heute! Und da denke ich, dass uns das 17. Jahrhundert einiges zu bieten hat. Zum Beispiel den Terminkalender! Und die Gegenwart! Beides wurde nämlich, so versuche ich in diesem Buch zu zeigen, im Verlauf des 17. Jahrhunderts „erfunden“, mit Folgen, die Sarkozy gerade zu spüren bekommt. Wie man im 17. Jahrhundert mit Zeit umgegangen ist, was das mit uns heute zu tun hat und was (Termin-)Kalender uns darüber verraten können – das und einiges mehr wird in diesem Buch verhandelt. Ende der Werbepause.
Illusion des Kalenders
Wenn nun die französische Polizei die Terminkalender von Sarkozy beschlagnahmt hat, dann könnte es allerdings sein, dass die Hoffnungen auf ein eindeutiges Ermittlungsergebnis enttäuscht werden. Denn Terminkalender teilen die Schwierigkeiten aller Medien, die uns aus einer Vergangenheit überliefert sind. Sie stellen zwar bestimmte Verbindungen zwischen gegenwärtigen und vergangenen Wirklichkeiten her, diese müssen aber keineswegs eindeutig sein. Wenn in den Terminkalendern von Sarkozy ein Treffen mit Bettencourt, Tapie oder Gaddafi eingetragen ist, muss es dann zwangsläufig um Parteispenden gegangen sein? Vielleicht wurden mit guten Freunden auch nur ein paar Beziehungsprobleme diskutiert? Vielleicht hat das Treffen auch gar nicht stattgefunden, denn nur weil ein terminkalendarischer Eintrag vorhanden ist, muss dem nicht zwangsläufig ein Ereignis in der außerkalendarischen Welt entsprechen. Wir haben es also mit bestimmten Übertragungsleistungen zu tun, die das historische Material erbringt, bei denen das Ausgangsmaterial aber auch jedes Mal verändert wird, ohne dass sich die Transformationen bis ins Letzte ausleuchten lassen. Erst unser Zeit- und Geschichtsverständnis bastelt aus Gründen der Nachvollziehbarkeit daraus im Nachhinein eine eindeutige Erzählung.
Und auch hierbei spielt der Kalender wieder eine wesentliche Rolle. Denn er gibt mit seinem strengen zeitlichen Nacheinander der Illusion weitere Nahrung, wir hätten es bei unserem eigenen Leben mit einem stringenten „Lebenslauf“ zu tun. Wenn man nur Tag für Tag etwas hineinschreibt, ergibt sich quasi von selbst eine Geschichte. [1] Aber nicht weil diese Geschichte tatsächlich so passiert ist, sondern weil wir diese Geschichte so erzählen. Helmut Kohl hat mit seinen Erinnerungen unter anderem vorgemacht, wie das geht. Nicht zuletzt deswegen sind die Terminkalender für Sarkozy so wichtig. Sicherlich geht es um Dokumente, die im Moment aus juristischen Gründen für ihn problematisch werden könnten. Darüber hinaus geht es aber auch um die Deutungsmacht über seine Biographie und seine Präsidentschaft. Jetzt könnte es nämlich sein, dass diese nicht mehr bei ihm selbst liegt, sondern von anderen übernommen wird. Wenn Sarkozy also irgendwann die Terminkalender wieder ausgehändigt bekommt, wird er dadurch wohlmöglich nicht mehr seine Vergangenheit zurückbekommen. Er könnte stattdessen eine bereits fertig geschriebene, aber nicht seinen Interessen entsprechende Geschichte vorgesetzt bekommen.
[1] Michael Rutschky: Das Merkbuch. Eine Vatergeschichte, Berlin 2012.
Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtsmedien, Geschichtspolitik Tagged: Nikolas Sarkozy, Terminkalender, Zeit
Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2014/03/17/21-sarkozy-und-die-terminkalender/
20. Histofloxikon, Zweite Lieferung
Vor kurzem begonnen, hier nun weitergeführt: das Lexikon historischer Floskeln und Allgemeinplätze.
Das wird Geschichte machen!
Nein, wird es nicht! Es wird auch nicht Geschichte schreiben oder wie sonstige alternative Formulierungen dafür auch immer lauten mögen. Wer oder was die Geschichte „macht“, würde sicherlich einer etwas ausführlicheren Erörterung bedürfen. Man kann aber mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Geschichtemachen nicht wie Kuchenbacken funktioniert. Jetzt wird Kuchen gebacken! – eine solche Aussage darf man, in Abhängigkeit von der Seriosität der Sprechenden, als durchaus ernsthafte Ankündigung verstehen, deren Erfüllung in der Zukunft (falls überhaupt) üblicherweise nur Unwesentliches im Weg steht. Bei der Aussage, etwas werde Geschichte machen, ist die temporale Relationierung etwas komplizierter. Immerhin versucht man damit, in der Gegenwart eine zukünftige Vergangenheit zu bestimmen. Man möchte also den Nachfahren vorsichtshalber schon einmal vorschreiben, welche Geschichte sie zu erzählen haben werden. Das wird nur in Ausnahmefällen funktionieren. Denn entweder erweist sich vermeintlich Epochemachendes für die Nachgeborenen als irrelevant – oder sie machen es tatsächlich zu einem Teil ihrer Geschichte, dann aber, weil sie sich dazu entschieden haben, und nicht weil es von welchen Vorfahren auch immer dekretiert wurde.
Zugegeben, die Chance aktuelle Ereignisse als „historisch“ einstufen zu können, wächst mit der diskursiven Macht der Sprecher/innen. Bestimmte Aussagen sind schwerer zu überhören als andere. Aber auch mit einer hinreichenden Menge an Machtfülle gibt es keine Erfüllungsgarantie.
Steht nur noch die Frage im Raum, wann diese Unsitte, ja eigentlich arrogante Attitüde ihren Anfang genommen hat, in der Gegenwart bereits die Geschichte von morgen festlegen zu wollen. Eine mögliche Antwort betrifft einen üblichen Verdächtigen: Als Goethe am 20. September 1792 bei der Kanonade von Valmy zugegen war, bei der die französische Revolutionsarmee sich gegen Preußen durchsetzen konnte, soll er bekanntlich gesagt haben, dass von diesem Ereignis eine neue Epoche der Weltgeschichte ausgehen werde und die Anwesenden später einmal sagen könnten, sie seien dabei gewesen. So behauptete er zumindest später. Denn dass er sein „Das wird Geschichte machen!“ bei dieser Gelegenheit gesagt haben soll, dokumentierte er selbst erst Jahrzehnte später, als er um 1820 seine „Kampagne in Frankreich“ schrieb. Die Moral von der Geschicht‘? Was morgen gestern sein wird, wissen wir heut‘ noch nicht.
In die Geschichte eingehen
Hängt ganz eng mit dem Geschichtemachen und Geschichteschreiben zusammen, ist aber aufgrund der zumeist passivischen Verwendung – etwas wird in die Geschichte eingehen – anders gelagert. Spricht man davon, dass etwas Geschichte machen werde, präsentiert sich diese „Geschichte“ als ein weißes, noch zu beschreibendes Blatt Papier, für das aber die Arbeitsnotizen bereits hier und heute gesammelt werden. Wenn jemand oder etwas jedoch in die Geschichte eingehen soll, dann scheint es sich bei dieser „Geschichte“ eher um einen exklusiven Klub zu handeln, zu dem nun wahrlich nicht jeder und alles Zutritt hat. Die Einlassbedingungen sind streng, aber hat man es erst einmal am Türsteher vorbei geschafft, darf man sich der Unsterblichkeit erfreuen – zumindest im angenommenen Gedächtnis der Nachgeborenen. Eine Unsterblichkeit allerdings mit häufig begrenztem Haltbarkeitsdatum. Man wird aus diesem Klub üblicherweise nicht mit großem Tamtam rausgeschmissen, man kann seine Mitgliedschaft aber durch ein leise dahindämmerndes Vergessen verlieren. Das wäre dann der Moment, in dem die nächste Floskel zum Einsatz kommen kann: „Das ist Geschichte!“
Die „Geschichte“, in die etwas eingehen soll, gemahnt an einen Aufbewahrungsort toter Wirklichkeiten, an eine Lagerhalle vergangenen Geschehens, in der man verstauen kann, was man aktuell nicht mehr benötigt, das sich aber aus Gründen der Bildung, Selbstvergewisserung und Identitätsbildung vielleicht noch einmal verwenden lässt. Eine solche Geschichte ist tote Geschichte. Sie entspricht der Art und Weise, wie nicht wenige Museumsbesucher mit diesen Containern des Gestern umgehen: Eine gewisse Bildungsbeflissenheit oder der schiere Zwang (Stichwort: Schulausflug) nötigen einen dazu, entsprechende Einrichtungen zu besuchen – aber mit dem eigenen Leben hat das wenig bis gar nichts zu tun. Wenn in einer Kultur die dominierende Auffassung von Geschichte darauf hinausläuft, dass es sich nur um das tote Gestern anstatt um die recht lebendige Anordnung unterschiedlicher Zeiten im Hier und Heute handelt, dann dürfte diese Kultur ein Problem haben.
Das ist der Lauf der Geschichte
Einspruch! Ist er nicht! Man kann im mehr oder minder akademischen Gerede und Geschreibe über das Historische so oft und so viel gegen die Zielgerichtetheit des historischen Prozesses (auch noch im Singular!) anschreiben wie man möchte, die Teleologie scheint einfach nicht auszurotten zu sein. Wohlgemerkt, damit sollen bei weitem nicht nur diejenigen angesprochen sein, die unbeleckt von tiefergehenden geschichtstheoretischen Weihen davon ausgehen, es gebe einen Sinn und ein Ziel der Geschichte, sondern vor allem diejenigen, die es eigentlich besser wissen sollten, aber von solchen Floskeln weiterhin fröhlich Gebrauch machen.
Hatten wir schon „die Geschichte“ als unbeschriebenes Blatt Papier und als exklusiven Klub, dann erweist sich „der Lauf der Geschichte“ als eine Fortbewegung auf Eisenbahnschienen. Es gibt gewisse historische Gesetzmäßigkeiten, so lässt sich dieser Ausspruch verstehen, die ein Ausscheren nach rechts oder links nicht vorsehen. Der historische Weg zum Zielbahnhof wird auf diese Weise zum Schicksal erhoben, denn ist der Fahrschein erst einmal gelöst, kann man nicht mal eben die Fahrtrichtung ändern. Ungewiss ist dann höchstens noch – ganz wie bei der Deutschen Bahn – wann der Zug tatsächlich einläuft.
Solche Formulierungen mögen durchaus nachvollziehbar, weil unmittelbar einsichtig sein, sie lassen im Zusammenhang einer Untersuchung historischer Floskeln aber vor allem Rückschlüsse auf das dahinter liegende Zeitmodell zu. Und wie schon im ersten Teil des Histofloxikons festgestellt, wird vielfach immer noch von temporalen Vorstellungen ausgegangen, die dem Zeitstrahl entsprechen. Durchaus naheliegend, auf diesem Strahl einen Lauf der Geschichte zu vermuten oder dort Schienen zu verlegen und irgendwo ein – wenn auch unvorstellbar weit entferntes – Ziel anzunehmen. Selbst wenn dieses Ziel nicht mehr heilsgeschichtlich verbürgt ist, so gibt es doch ausreichend säkularisierte Alternativen, welche die Funktion des einstigen christlichen Paradieses übernommen haben (Kommunismus, Weltfrieden, Wohlstand für alle).
Wenn man nun die ketzerische Frage stellte, was mit einer Welt denn weiter geschehen solle, in der tatsächlich der utopische Zustand erreicht wäre, dass alle in Sicherheit und Zufriedenheit leben würden, so könnte das zu (mindestens) zwei Reaktionen führen: entweder läge der Vorwurf des blanken Zynismus nahe oder man sollte beginnen, ganz grundsätzlich das eigene/vorherrschende Zeitmodell zu überdenken.
Einsortiert unter:Geschichte und Wirklichkeit, Geschichtskultur, Geschichtstheorie Tagged: Das wird Geschichte machen, Der Lauf der Geschichte, Floskel, Gemeinplatz, In die Geschichte eingehen
Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2014/03/01/20-histofloxikon-zweite-lieferung/
19. Histofloxikon, Erste Lieferung
 Sie hat schon einige Tage auf dem Buckel, die berühmte, vielleicht sogar berüchtigte Sapir-Whorf-Hypothese vom linguistischen Relativismus (wahlweise auch Determinismus). Und wahrscheinlich muss man diese Debatte nicht gesondert bemühen, um zu der Einsicht zu gelangen, dass Sprechen, Denken und Wirklichkeit irgendwie miteinander zusammenhängen. Eine verflixt komplizierte Beziehung ist das. Aber keine Sorge, ich werde mich nicht anheischig machen, diese Dreiecksgeschichte hier mal eben klären zu wollen. Vielmehr soll dieser Hinweis nichts anderes sein als eben das: ein Hinweis. Und zwar um auf einen Problemzusammenhang aufmerksam zu machen, der uns tagtäglich begegnet (Von wegen: „Die Sonne geht auf“). Vergangene Zustände sind ja in einem besonderen Maße dafür anfällig, durch sprachliche Anordnung überhaupt erst geformt zu werden, schließlich sind sie vergangen, stehen also nicht mehr anders als sprachlich (oder sonstwie zeichenförmig) zur Verfügung. Und ungefähr das wollten Sapir und Whorf wohl zum Ausdruck bringen, dass die Art und Weise, wie wir über die Dinge sprechen, unser Denken über diese Dinge prägt. Die wissenschaftliche Diskussion beharrt zwar zurecht darauf, dass die Verhältnisse etwas komplizierter sind als in der angenommenen Einbahnstraße von „Sprache prägt Denken“. Aber dass die Diskussion immer noch geführt wird, ist schon wieder ein Hinweis: dass an diesem Problem nämlich etwas dran ist.
Sie hat schon einige Tage auf dem Buckel, die berühmte, vielleicht sogar berüchtigte Sapir-Whorf-Hypothese vom linguistischen Relativismus (wahlweise auch Determinismus). Und wahrscheinlich muss man diese Debatte nicht gesondert bemühen, um zu der Einsicht zu gelangen, dass Sprechen, Denken und Wirklichkeit irgendwie miteinander zusammenhängen. Eine verflixt komplizierte Beziehung ist das. Aber keine Sorge, ich werde mich nicht anheischig machen, diese Dreiecksgeschichte hier mal eben klären zu wollen. Vielmehr soll dieser Hinweis nichts anderes sein als eben das: ein Hinweis. Und zwar um auf einen Problemzusammenhang aufmerksam zu machen, der uns tagtäglich begegnet (Von wegen: „Die Sonne geht auf“). Vergangene Zustände sind ja in einem besonderen Maße dafür anfällig, durch sprachliche Anordnung überhaupt erst geformt zu werden, schließlich sind sie vergangen, stehen also nicht mehr anders als sprachlich (oder sonstwie zeichenförmig) zur Verfügung. Und ungefähr das wollten Sapir und Whorf wohl zum Ausdruck bringen, dass die Art und Weise, wie wir über die Dinge sprechen, unser Denken über diese Dinge prägt. Die wissenschaftliche Diskussion beharrt zwar zurecht darauf, dass die Verhältnisse etwas komplizierter sind als in der angenommenen Einbahnstraße von „Sprache prägt Denken“. Aber dass die Diskussion immer noch geführt wird, ist schon wieder ein Hinweis: dass an diesem Problem nämlich etwas dran ist.
Mir gibt das die Möglichkeit, ein kleines lexikalisches Vorhaben in einen viel zu großen Zusammenhang einzuordnen, einer kleinen Spielerei einen ungemein schweren, goldenen Rahmen umzuhängen. Man könnte das Ganze bezeichnen als Histofloxikon: das Lexikon historischer Floskeln und Allgemeinplätze. Nicht sehr viel mehr als eine gänzlich unsystematische Sammlung einiger Alltagsweisheiten, die in Bezug auf Vergangenheit und Geschichte immer wieder Verwendung finden und offensichtlich nicht auszurotten sind. Zugleich aber Formeln, die unser Denken über Geschichte und Vergangenheit zu einem erheblichen Grad prägen und bei unreflektierter, allzu häufiger Verwendung zu nicht geringen Schwierigkeiten führen können. Auf Risiken und Nebenwirkungen ist im Folgenden einzugehen.
Sich in die Geschichte hineinversetzen
Eine meiner Lieblingsfloskeln. Üblicherweise vermeide ich es in der Begegnung mit anderen Menschen, meine akademische Spezialisierung allzu offensiv zu verlautbaren, um genau diesem Satz zu entgehen. Gelingt leider nicht immer. In einem Gespräch insistierte einmal ein behandelnder Arzt auf genauere Kenntnis meiner wissenschaftlichen Profession. Auf das Bekenntnis hin, dass ich Historiker sei, folgte eine kurze Pause, ein tiefes Durchatmen und ein (verschämter? irritierter? nachdenklicher? gar neidischer?) Blick zu Boden. Dann mir wieder ins Gesicht gesehen und die Frage gestellt, die mich sprachlos machte: Ob ich denn dann noch so viel mit dieser Welt zu tun hätte?
Nein! Natürlich nicht! Denn als professioneller Temponaut ziehe ich mir üblicherweise morgens nach dem Frühstück meinen Zeitanzug an (während sich Astronauten in einen Raumanzug zwängen müssen), um mit meiner Zeitmaschine in mein derzeitiges Arbeits- und Beobachtungsfeld der Vergangenheit hinabzugleiten. Beam me back, Scotty! Pünktlich zum Abendessen bin ich wieder zurück.
Wenn auch nicht gar so naiv, aber eine gewisse Form der Gegenwartsentrücktheit wird historisch arbeitenden Menschen mit schöner Regelmäßigkeit unterstellt. Viel schlimmer aber ist, dass im Alltagsverständnis nicht selten von der Beschäftigung mit der Geschichte eben eine solche Zeitentrückung erwartet und erhofft wird. Dann kommen sie zum Einsatz, diese bedenklichen Floskeln vom Hineinversetzen oder gar Sich-Versenken in vergangene Zustände.
Die Zeitmaschinenvorstellung ist im Zusammenhang mit historischem Arbeiten nicht auszurotten. Unsere unzureichende Vorstellung von „der Zeit“ als einer unilinearen Dimension, auf der man zumindest theoretisch hinauf- und hinabgleiten könne, nährt bis zum heutigen Tag die Illusion, dass die Konstruktion einer Zeitmaschine nur ein technisches Problem sei. Aber wenn das erst einmal gelöst wäre … Bis dahin müssen wir uns eben mit den zweitbesten Lösungen zufriedengeben, können Mittelaltermärkte veranstalten, historische Schlachten nachstellen, können uns in abgrundtief schlechten historischen Romanen dem „Strudel der Ereignisse“ hingeben oder in Fernseh-Doku-Fictions Geschichte „wieder lebendig“ werden lassen. Die Auseinandersetzung mit anderen Zeiten verkommt solcherart zum historischen Disney-Park und verzichtet auf jegliche Form der Kritik. Warum man sich aber nicht in die Vergangenheit hineinversetzen kann, mag eine andere Floskel verdeutlichen.
Einen Blick in die Vergangenheit werfen
Das ist abgemilderte Version des Zurückbeamens in die Historie: Man will nicht mehr selbst im Gestern anwesend sein (da warten ja Schmutz, Krankheiten, lebensbedrohliche Gefahren und schlechte Umgangsformen – kennt man ja aus den „lebendig erzählten“ Historienfilmen), man möchte nur einen kurzen Blick durch den Türspalt der Zeiten wagen. Die Vergangenheit wird auf diese Weise zum problemlos beobachtbaren Gestern, zum zeitlichen Nachbarn von Gegenüber, bei dem man mal eben schnell vorbeischauen könnte, um zu sehen, wie es denn damals so war. Anstatt über die Straße zu gehen, konsultiert man die „Quellen“ (eine weitere, höchst problematische Metapher), um etwas über die Vergangenheit zu erfahren.
Aber die erkenntniskritische Frage sei erlaubt, ob wir durch das historisch überlieferte Material hindurchsehen, um einen Blick in die Vergangenheit zu erhaschen, oder ob uns der Blick auf das alte Papier (oder Bild oder Objekt) nicht in der Gegenwart festhält, um die Frage zu provozieren, welche Relationen dieses überlieferte Material mit einer jeweiligen Gegenwart eingeht.
Man kann die Sache auch etwas kosmischer angehen: Es wird zuweilen behauptet, die einzige Möglichkeit, um der Vergangenheit tatsächlich ansichtig zu werden, sei ein Blick in den nächtlichen Sternenhimmel. Denn bekanntermaßen sehen wir dort oben nicht den gegenwärtigen Zustand des Universums, sondern nur das Licht, das seit unvorstellbar langer Zeit unterwegs ist, um uns von Sternen zu künden, die möglicherweise überhaupt nicht mehr existieren. Also sehen wir dort die Vergangenheit. Tatsächlich? Auch hier sollte man etwas genauer sein. Zunächst einmal sehen wir dort Licht sehr unterschiedlichen Alters, weil das Licht des Mondes nur wenige Sekunden, das Licht der Sonne wenige Minuten, das Licht des Andromeda-Nebels aber mehrere Millionen Jahre alt braucht, um bei uns einzutreffen. All diese verschiedenen Lichtzustände kommen in unserer Gegenwart, und nur in unserer Gegenwart in genau der gegebenen Form zusammen, um ein buntes, temporales Durcheinander zu ergeben, das unser Hier und Jetzt prägt. Sodann sollte man auch die Bewegungsrichtung nicht außer Acht lassen, mit der wir es zu tun haben. Denn nicht wir werfen unseren Blick zu den Sternen, sondern deren Licht kommt zu uns. Wir blicken also nicht in die Vergangenheit, sondern müssen warten, bis diese Vergangenheit uns erreicht, um unser gegenwärtiges Bild vom Sternenhimmel zu konstituieren. Schließlich und endlich haben wir es mit dem Licht als einem Medium zu tun, das Informationen über vergangene Zustände von anderen Sternen transportiert, das aber nicht „die Vergangenheit selbst“ ist.
Nicht anders sieht es mit historischen Dokumenten aus, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise daran beteiligt sind, die temporale Verweisstruktur unserer Gegenwart zu konstituieren. Dieses historische Material haben wir nicht aus der Vergangenheit geholt, sondern es ist in unserer Gegenwart übriggeblieben, und es trägt als medialer Träger dazu bei, Relationen einer Gegenwart zu ihren Vergangenheiten zu ermöglichen, ohne „die Vergangenheit“ zu sein.
To be continued …
Einsortiert unter:Geschichte und Wirklichkeit, Geschichtskultur, Geschichtstheorie Tagged: Einen Blick in die Vergangenheit werfen, Floskel, Gemeinplatz, Sich in die Geschichte hineinversetzen
Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2014/02/23/19-histofloxikon-erste-lieferung/
2015 | 100 Jahre Völkermord an den Armeniern | Herausforderung für den Geschichtsunterricht
 Deportation von Armeniern aus Kharpert, April 1915 (Public Domain, Wikimedia Commons)
Deportation von Armeniern aus Kharpert, April 1915 (Public Domain, Wikimedia Commons)
Das Gedenkjahr 2014 holt den Ersten Weltkrieg ins öffentliche Bewusstsein zurück. In der hiesigen breiten medienöffentlichen Beschäftigung mit der vermeintlichen „Urkatastrophe“ (Kriege sind keine Katastrophen, sondern von Menschen verursacht) fällt allerdings auf, dass (zumindest bislang) nur wenig kontrovers debattiert wird. Beispielsweise sorgt die durch Clarks „Schlafwandler“ erneut aufgerollte Kriegsschuldfrage längst nicht mehr für so große Aufregung wie noch vor einem halben Jahrhundert die Fischer-Kontroverse. Auch das gelegentliche Bemühen, Parallelen zwischen 1914 und 2014 herzustellen, verfängt nicht wirklich.
Das kann sich 2015, wenn sich im April der Beginn des Völkermords an den Armeniern zum 100. Mal jährt, ändern. Die gezielte Tötung von hunderttausenden Armeniern bei Todesmärschen und Massakern (die Schätzung der Opferzahlen reicht von 300.000 bis 1.500.000; häufig angenommen wird eine Zahl zwischen 800.000 und 1.000.000) in den Jahren 1915/16 wird heute von den meisten Historikern als Völkermord bezeichnet. Die Anerkennung dieses Genozids im Sinne der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (von 1948) ist umstritten; bisher 22 Staaten haben die Massentötungen offiziell in diesem Sinne anerkannt, außerdem auch internationale Organisationen wie die UN-Menschenrechtskommission und das Europäische Parlament. Die deutsche Bundesregierung hat (trotz verschiedener Anträge im Bundestag) eine solche Anerkennung bislang nicht ausgesprochen (ein wichtiger Hintergrund hierfür: das Deutsche Reich war seinerzeit Bündnispartner des Osmanischen Reichs). Der Streitpunkt (auch im Zusammenhang mit einem möglichen EU-Beitritt) liegt besonders in der Verweigerung der Türkei, die Ereignisse während des Ersten Weltkriegs als Völkermord zu bezeichnen. Um sich einen Überblick über die ideologischen Hintergründe zu verschaffen, die zur Vertreibung der Armenier führten – der Prozess “der Transformation des osmanischen Vielvölkerstaates zu einem türkischen Nationalstaat” – und die zugleich wichtige Ursache für die bis heute andauernde Leugnung in der Türkei bilden, kann der Beitrag Nationale Vision und Gewaltpolitik: Der Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915/16 von Mihran Dabag als Einstieg dienen. Zugleich zeichnet sich in den letzten Jahren aber auch ab, dass in der türkischen Gesellschaft zunehmend kontrovers über die Ereignisse von 1915/16 debattiert wird.
Auf der Fachdidaktischen Tagung für Geschichte und Politik des Volksbunds
Deutsche Kriegsgräberfürsorge und des niedersächsischen Kultusministeriums in Hannover im Februar 2012, auf der Mihran Dabag o.g. Vortrag hielt, wurde auch die Frage diskutiert, ob und wie sich der Völkermord an den Armeniern angemessen im Geschichtsunterricht behandeln lässt. Auf die besondere Problematik angesichts häufig vieler türkischstämmiger Schüler/innen in den Klassenzimmern wurde bereits vielfach hingewiesen, beispielsweise in einer Ausgabe der Zeitschrift des Geschichtslehrerverbandes Geschichte für heute (aus 2013) oder auch auf einer Themenseite von Planet Wissen. Zum politischen Streit kam es 2002, als das Land Brandenburg den Völkermord an den Armeniern in den Lehrplan aufnahm. Aus didaktischer Sicht desaströs wäre – kommt der Armenier-Genozid im Unterricht zur Sprache - eine gegenseitige, nationalen Zuschreibungen folgende Vorwurfshaltung: euer Holocaust hier, euer Armenier-Genozid dort. Bemerkenswert ist – um solche Stereotype aufzubrechen – der Beitrag Völkermord an den Armeniern von Martin Stupperich, den er ebenfalls auf der Tagung in Hannover vorgestellt hat. Stupperich konstatiert sich “widersprechende nationale Selbstbilder [...] Haben wir auf deutscher Seite ein selbstkritisches Narrativ, so finden wir auf türkischer Seite ein heroisierendes.” (S. 1f.) Stupperich schlägt (für den Oberstufenunterricht) erstens eine Rekonstruktion der Massentötungen aus den Akten des Auswärtigen Amtes vor. Zweitens verfolgt er ein Unterrichtskonzept (ab S. 13), das die heutigen Auseinandersetzungen und Debatten über die Anerkennung des Völkermordes zum Gegenstand macht. Überzeugend an diesem Vorgehen ist der Anspruch, die emotional aufgeladene Debatte zu verstehen und die Interessenlagen der Akteure nachzuvollziehen. Hierfür lassen sich insbesondere geschichtskulturelle Materialien wie z.B. Presseartikel heranziehen. In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Rezeptionsgeschichte des Holocaust in Deutschland vergleichen. Erst die Auseinandersetzung mit geschichtspolitischen Debatten lässt die kontroverse Berteilung der Vergangenheit und die perspektivische, nicht selten nationalistisch verengte Bedingtheit der hart aufeinandertreffenden Positionen deutlich werden. Eine solche Beschäftigung mit dem Armenier-Genozid könnte insbesondere während der 2015 erwartbaren medienöffentlichen Debatte einen wichtigen Beitrag zum interkulturellen Lernen leisten. Es wäre dabei erstens erstrebenswert, Lernangebote und konkrete Materialien (auch online) zur Verfügung zu stellen. Zweitens wäre ein Austausch über – sicher gelegentlich schwierige – konkrete Umsetzungen und Erfahrungen der Thematisierung des Armenier-Genozids im Geschichtsunterricht notwendig.
empfohlene Zitierweise Pallaske, Christoph (2014):2015 | 100 Jahre Völkermord an den Armeniern | Herausforderung für den Geschichtsunterricht In: Historisch denken | Geschichte machen | Blog von Christoph Pallaske, vom 20.1.2014. Abrufbar unter URL: http://historischdenken.hypotheses.org/2343, vom [Datum des Abrufs].
17. Magazinierte Geschichte
 Popularität vs. Seriosität?
Popularität vs. Seriosität?
Regelmäßig bringen sie das Neueste von gestern und vorgestern in den Zeitschriftenhandel: Geschichtsmagazine. Sie erfreuen sich bei einer anhaltend großen Leserschaft einer ebenso anhaltend großen Beliebtheit. In den Bahnhofsbuchhandlungen liegen sie nicht irgendwo versteckt, hinten in der Ecke aus, sondern finden sich prominent am Eingang platziert, zu großen Stapeln aufgehäuft. Aber auch in jedem Kiosk um die Ecke kann man sie finden, diese Hefte, die eine informative und unterhaltsame Reise in die Vergangenheit versprechen. Der Markt für Geschichtsmagazine scheint so gut bestellt zu sein, dass sich schon seit einigen Jahren gleich mehrere von ihnen Konkurrenz machen können.
Neben den Zeitschriften „Damals“ (verkaufte Exemplare 22.779) und „G/Geschichte“ (27.719), die dieses Geschäft schon seit Längerem betreiben und, ebenso wie „P.M. History“ (45.893), auf eine Heftgestaltung gemischten Inhalts setzen, sind es vor allem die großen Verlage, die dieses Segment für sich in Anspruch nehmen. Am prominentesten ist wohl „Geo Epoche“ aus dem Haus Gruner + Jahr (109.320), ein Magazin, das von sich behauptet, die Nummer 1 unter den populären historischen Zeitschriften zu sein. Aber auch „Der Spiegel“ (84.019) und „Die Zeit“ warten seit einiger Zeit mit eigenen Geschichtsmagazinen auf (Alle Verkaufszahlen laut IVW 3. Quartal 2013).
Aus wissenschaftlicher Perspektive sind Geschichtsmagazine durch eine unübersehbare Ambivalenz geprägt. Einerseits kann man sich nur freuen über die Aufmerksamkeit, die historische Themen in der Öffentlichkeit genießen. Vergleichbare populäre Zeitschriften zur Linguistik, Literaturwissenschaft oder Soziologie gibt es nicht. Andererseits wird gerade diese Popularität zuweilen mit dem Verlust wissenschaftlicher Seriosität und Komplexität erkauft.
Aber mir soll es hier nicht um die schon x-fach erörterten Spannungen zwischen wissenschaftlichen Ansprüchen und ihrer Aufbereitung für ein größeres Publikum gehen. Denn gegen solche Formen der Popularisierung zu polemisieren, halte ich offen gestanden für ein Luxusproblem – besser eine komplexitätsreduzierte Übersetzung als gar keine Wahrnehmung. Nein, was ich am Phänomen ‚Geschichtsmagazin‘ viel interessanter finde, ist die aktuelle Geschichtskultur, die sich darin manifestiert. Wenn sich eine Gesellschaft derart für Vergangenes interessiert, dass sie nicht nur in Fernseh-, sondern auch in Heftformaten eifrig darauf zurückgreift – welche Form nimmt dieses Vergangene dann an? Denn Popularisierungen funktionieren üblicherweise über Kreuz: Eine bestimmte Nachfrage soll befriedigt werden, und zwar so, dass sie sich nicht zuletzt auch wirtschaftlich rechnet. Zugleich besteht (zumindest theoretisch) die Möglichkeit, neue Angebote zu machen und Bedürfnisse zu wecken, die bisher möglicherweise noch gar nicht formuliert werden konnten.
Bildlichkeit vs. Genauigkeit?
Die Inhalte der Geschichtsmagazine lassen sich – kaum überraschend – nicht über einen Kamm scheren. Bei den Artikeln ist so ziemlich alles dabei, was man in textlichen Gemischtwarenläden erwarten darf. Vom eher unbeholfenen Artikel des bemühten Volontärs über die schmissig-journalistische Reportage bis zur nüchternen Auseinandersetzung der universitär bestallten Historikerin findet man Erfreuliches und weniger Erbauliches.
Eines ist aber unbedingte Voraussetzung: Die Themen müssen bildfähig sein. Ohne Bebilderung geht gar nichts. Man müsste es noch genauer nachrechnen (was ich nicht getan habe), aber nach meiner Schätzung wird etwa die Hälfte eines Heftumfangs durch Abbildungen eingenommen. Und durch Karten. Insbesondere „Geo Epoche“ nutzt Karten (zusätzlich zu sehr vielen Bildern) ausgiebig, um deutlich zu machen, dass Geschichte nicht nur in der Zeit und im Text, sondern auch im Raum und im Bild stattfindet. Damit haben Geschichtsmagazine eine Möglichkeit, die vielen historischen Büchern aus Kostengründen fehlen, wenn sie so ausgiebig auf Abbildungen zurückzugreifen. Dafür liegen die Preise dann aber auch schon auf dem Niveau von schmalen Büchern. Zuweilen führt diese Visualisierungspraxis zu zweifelhaften Auswüchsen, so wenn Historiengemälde aus dem 19. Jahrhunderts zur Illustration mittelalterlicher Verhältnisse herangezogen werden oder wenn im Heft über den Amerikanischen Bürgerkrieg von „Geo Epoche“ Fotografien digital koloriert wurden, „um ihre Anschaulichkeit zu verstärken“ [1]. Geschichtstuning für Fortgeschrittene.
Es wäre interessant, eine Redaktionssitzung zur Erstellung eines solchen Heftes belauschen zu können, um zu erfahren, nach welchen Gesichtspunkten die einzelnen Beiträge ausgesucht werden. Man kann aber auch ohne entsprechende Abhörprotokolle von den abgedruckten Artikeln auf die übergeordneten Prinzipien schließen: Zunächst geht es um Überblickswissen, das den Rahmen bereiten soll für die Schilderung bestimmter Ereignisse, für Menschlich-Biographisches und für Aspekte des Alltagslebens, die einen wesentlichen Teil des Inhalts ausmachen. Nicht minder interessant sind aber die Themenbereiche, die nur am Rande vorkommen oder auch ganz ausgelassen werden: Es sind all diejenigen, die wenig Anschauliches zu bieten haben, die strukturelle Grundlagen in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder Kultur betreffen. Befürchtet man hier möglicherweise Langeweile in der Geschichtsunterhaltung – obwohl es gerade hier in einem doppelten Sinn ‚grundlegend‘ werden könnte?
Nicht selten scheinen sich die Artikel aus der ‚Übersetzung‘ wissenschaftlicher Forschung (und dickleibiger Bücher) in Artikelform zu speisen. Insofern liegt hier ein prototypischer (und überhaupt nicht abwertend gemeinter) Fall von Popularisierung wissenschaftlichen Wissens vor. Zweifelsfalten kriechen allerdings auf die Denkerstirn, wenn im Kleingedruckten darauf verwiesen wird, begriffliche Unterschiede nicht ganz so genau zu nehmen. Da wird dann beispielsweise aus Gründen der sprachlichen Varianz die Sklaverei mit Leibeigenschaft, Knechtschaft und Unfreiheit in einen begrifflichen Topf geschmissen. Das ist keine Popularisierung mehr, sondern ziemlich grobe Ungenauigkeit [2].
Distanz als Differenz!
Treten wir aber einen Schritt zurück, sehen von den konkreten Heftinhalten ab und betrachten das größere Themenspektrum. Dann fällt auf, dass Bewährtes aufbereitet, etablierte Themen besetzt und das ohnehin bereits – zumindest ungefähr – Bekannte abgehandelt wird. Klassische Themen, die auch schon den schulischen Geschichtsunterricht prägten, werden vielfach wieder aufgegriffen: das antike Rom, Napoleon, der Nationalsozialismus, die Kreuzritter oder der Erste Weltkrieg – Länder, Menschen, Abenteuer. Man weiß also immer, was man bekommt, Überraschungen bleiben die Ausnahme. Damit bleibt aber leider auch die Möglichkeit ungenutzt, die ausgetretenen Pfade zumindest ein wenig zu verlassen, Vergangenes nicht immer schon von vornherein zu reduzieren auf große Persönlichkeiten, große Ereignisse oder große Reiche. Vielleicht ginge es auch einmal anders. Warum lassen sich denn nicht einmal Themenhefte entwerfen, die vermeintlich Abseitiges, Schräges, Unbeachtetes behandeln? Warum nicht etwas über die Geschichte des Schattens, des Spaziergangs oder der Börsenspekulation? Warum nicht eine genauere Betrachtung der Alpenfurcht und -begeisterung, familiärer Hierarchien oder der Sprache der Diplomatie? Etwa weil die Popularisierung immer nur so weit getrieben werden darf, wie das Zielpublikum bereits vorangeschritten ist? Sicherlich geben bei kommerziellen Unternehmen wie Geschichtsmagazinen die Auflagen den Ton an, weshalb sich immer das am besten verkauft, was ohnehin schon bekannt ist. Aber vielleicht gibt es ja thematische Nachfragen, von denen noch niemand etwas wusste, die gerade deswegen geweckt werden könnten, weil sie eben nicht das immer schon Bekannte aufwärmen?
Ich gebe zu, das ist recht idealistisch gedacht – wahrscheinlich zu idealistisch. Begnügt man sich bis zur Änderung dieses Zustands mit der regelmäßig dargebotenen Hausmannskost, so zeigen die Geschichtsmagazine eine dominierende Vorstellung von der Vergangenheit an, die zwar kein eindimensionales, aber doch recht übersichtliches Set an Funktionen aufweist: Erstens findet sich ein affirmatives Geschichtsbild, das auf Identifizierung, wenn nicht gar auf Identitätsbildung setzt. Hierzu dienen Klassikerthemen wie die Geschichte der jungen Bundesrepublik, noch eher aber biographische Zugänge – Stichwort: Vorbilder. Zweitens findet sich ein historischer Exotismus, der das Fremdartige hervorhebt. Das Mittelalter bietet sich hierfür schon seit Längerem als ideale Spielwiese an, denn hier kann man vermeintlich ohne Hemmungen allen Phantasien von sex’n’crime’n’powerplay frönen. Die dritte Variante ist gewissermaßen die negative Umkehrung der ersten, insofern sie auf Betroffenheit setzt und damit zu einer Identifizierung ex negativo anleiten möchte. Paradethema ist natürlich der Nationalsozialismus, aber alle Formen kriegerischer Auseinandersetzung, gesellschaftlicher Unterdrückung oder ethnischer Verfolgung können dazu herhalten.
Gegen solche Formen der Historisierung ist per se nichts zu sagen. Sie versäumen aber eine wichtige, wenn nicht sogar die wesentliche Qualität historischer Beschäftigung: Sie nutzen die zeitliche Distanz gerade nicht dazu, um Differenz zu thematisieren, um Selbstkritik zu üben und die Grundlagen gegenwärtiger Verhältnisse zu analysieren. Ein Geschichtsmagazin, das eben diese Möglichkeiten nutzt, würde ich gerne einmal lesen wollen – nur um es wohl nach der ersten Nummer wieder eingehen zu sehen.
[1] Geo Epoche, Nr. 60 (2013): Der Amerikanische Bürgerkrieg, S. 13.
[2] Geo Epoche, Nr. 60 (2013): Der Amerikanische Bürgerkrieg, S. 5.
Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtsmedien Tagged: Bild, Geschichtsmagazin, Popularisierung, Visualisierung
Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2013/12/30/17-magazinierte-geschichte/
17. Magazinierte Geschichte
Popularität vs. Seriosität?
Regelmäßig bringen sie das Neueste von gestern und vorgestern in den Zeitschriftenhandel: Geschichtsmagazine. Sie erfreuen sich bei einer anhaltend großen Leserschaft einer ebenso anhaltend großen Beliebtheit. In den Bahnhofsbuchhandlungen liegen sie nicht irgendwo versteckt, hinten in der Ecke aus, sondern finden sich prominent am Eingang platziert, zu großen Stapeln aufgehäuft. Aber auch in jedem Kiosk um die Ecke kann man sie finden, diese Hefte, die eine informative und unterhaltsame Reise in die Vergangenheit versprechen. Der Markt für Geschichtsmagazine scheint so gut bestellt zu sein, dass sich schon seit einigen Jahren gleich mehrere von ihnen Konkurrenz machen können.
Neben den Zeitschriften „Damals“ (verkaufte Exemplare 22.779) und „G/Geschichte“ (27.719), die dieses Geschäft schon seit Längerem betreiben und, ebenso wie „P.M. History“ (45.893), auf eine Heftgestaltung gemischten Inhalts setzen, sind es vor allem die großen Verlage, die dieses Segment für sich in Anspruch nehmen. Am prominentesten ist wohl „Geo Epoche“ aus dem Haus Gruner + Jahr (109.320), ein Magazin, das von sich behauptet, die Nummer 1 unter den populären historischen Zeitschriften zu sein. Aber auch „Der Spiegel“ (84.019) und „Die Zeit“ warten seit einiger Zeit mit eigenen Geschichtsmagazinen auf (Alle Verkaufszahlen laut IVW 3. Quartal 2013).
Aus wissenschaftlicher Perspektive sind Geschichtsmagazine durch eine unübersehbare Ambivalenz geprägt. Einerseits kann man sich nur freuen über die Aufmerksamkeit, die historische Themen in der Öffentlichkeit genießen. Vergleichbare populäre Zeitschriften zur Linguistik, Literaturwissenschaft oder Soziologie gibt es nicht. Andererseits wird gerade diese Popularität zuweilen mit dem Verlust wissenschaftlicher Seriosität und Komplexität erkauft.
Aber mir soll es hier nicht um die schon x-fach erörterten Spannungen zwischen wissenschaftlichen Ansprüchen und ihrer Aufbereitung für ein größeres Publikum gehen. Denn gegen solche Formen der Popularisierung zu polemisieren, halte ich offen gestanden für ein Luxusproblem – besser eine komplexitätsreduzierte Übersetzung als gar keine Wahrnehmung. Nein, was ich am Phänomen ‚Geschichtsmagazin‘ viel interessanter finde, ist die aktuelle Geschichtskultur, die sich darin manifestiert. Wenn sich eine Gesellschaft derart für Vergangenes interessiert, dass sie nicht nur in Fernseh-, sondern auch in Heftformaten eifrig darauf zurückgreift – welche Form nimmt dieses Vergangene dann an? Denn Popularisierungen funktionieren üblicherweise über Kreuz: Eine bestimmte Nachfrage soll befriedigt werden, und zwar so, dass sie sich nicht zuletzt auch wirtschaftlich rechnet. Zugleich besteht (zumindest theoretisch) die Möglichkeit, neue Angebote zu machen und Bedürfnisse zu wecken, die bisher möglicherweise noch gar nicht formuliert werden konnten.
Bildlichkeit vs. Genauigkeit?
Die Inhalte der Geschichtsmagazine lassen sich – kaum überraschend – nicht über einen Kamm scheren. Bei den Artikeln ist so ziemlich alles dabei, was man in textlichen Gemischtwarenläden erwarten darf. Vom eher unbeholfenen Artikel des bemühten Volontärs über die schmissig-journalistische Reportage bis zur nüchternen Auseinandersetzung der universitär bestallten Historikerin findet man Erfreuliches und weniger Erbauliches.
Eines ist aber unbedingte Voraussetzung: Die Themen müssen bildfähig sein. Ohne Bebilderung geht gar nichts. Man müsste es noch genauer nachrechnen (was ich nicht getan habe), aber nach meiner Schätzung wird etwa die Hälfte eines Heftumfangs durch Abbildungen eingenommen. Und durch Karten. Insbesondere „Geo Epoche“ nutzt Karten (zusätzlich zu sehr vielen Bildern) ausgiebig, um deutlich zu machen, dass Geschichte nicht nur in der Zeit und im Text, sondern auch im Raum und im Bild stattfindet. Damit haben Geschichtsmagazine eine Möglichkeit, die vielen historischen Büchern aus Kostengründen fehlen, wenn sie so ausgiebig auf Abbildungen zurückzugreifen. Dafür liegen die Preise dann aber auch schon auf dem Niveau von schmalen Büchern. Zuweilen führt diese Visualisierungspraxis zu zweifelhaften Auswüchsen, so wenn Historiengemälde aus dem 19. Jahrhunderts zur Illustration mittelalterlicher Verhältnisse herangezogen werden oder wenn im Heft über den Amerikanischen Bürgerkrieg von „Geo Epoche“ Fotografien digital koloriert wurden, „um ihre Anschaulichkeit zu verstärken“ [1]. Geschichtstuning für Fortgeschrittene.
Es wäre interessant, eine Redaktionssitzung zur Erstellung eines solchen Heftes belauschen zu können, um zu erfahren, nach welchen Gesichtspunkten die einzelnen Beiträge ausgesucht werden. Man kann aber auch ohne entsprechende Abhörprotokolle von den abgedruckten Artikeln auf die übergeordneten Prinzipien schließen: Zunächst geht es um Überblickswissen, das den Rahmen bereiten soll für die Schilderung bestimmter Ereignisse, für Menschlich-Biographisches und für Aspekte des Alltagslebens, die einen wesentlichen Teil des Inhalts ausmachen. Nicht minder interessant sind aber die Themenbereiche, die nur am Rande vorkommen oder auch ganz ausgelassen werden: Es sind all diejenigen, die wenig Anschauliches zu bieten haben, die strukturelle Grundlagen in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder Kultur betreffen. Befürchtet man hier möglicherweise Langeweile in der Geschichtsunterhaltung – obwohl es gerade hier in einem doppelten Sinn ‚grundlegend‘ werden könnte?
Nicht selten scheinen sich die Artikel aus der ‚Übersetzung‘ wissenschaftlicher Forschung (und dickleibiger Bücher) in Artikelform zu speisen. Insofern liegt hier ein prototypischer (und überhaupt nicht abwertend gemeinter) Fall von Popularisierung wissenschaftlichen Wissens vor. Zweifelsfalten kriechen allerdings auf die Denkerstirn, wenn im Kleingedruckten darauf verwiesen wird, begriffliche Unterschiede nicht ganz so genau zu nehmen. Da wird dann beispielsweise aus Gründen der sprachlichen Varianz die Sklaverei mit Leibeigenschaft, Knechtschaft und Unfreiheit in einen begrifflichen Topf geschmissen. Das ist keine Popularisierung mehr, sondern ziemlich grobe Ungenauigkeit [2].
Distanz als Differenz!
Treten wir aber einen Schritt zurück, sehen von den konkreten Heftinhalten ab und betrachten das größere Themenspektrum. Dann fällt auf, dass Bewährtes aufbereitet, etablierte Themen besetzt und das ohnehin bereits – zumindest ungefähr – Bekannte abgehandelt wird. Klassische Themen, die auch schon den schulischen Geschichtsunterricht prägten, werden vielfach wieder aufgegriffen: das antike Rom, Napoleon, der Nationalsozialismus, die Kreuzritter oder der Erste Weltkrieg – Länder, Menschen, Abenteuer. Man weiß also immer, was man bekommt, Überraschungen bleiben die Ausnahme. Damit bleibt aber leider auch die Möglichkeit ungenutzt, die ausgetretenen Pfade zumindest ein wenig zu verlassen, Vergangenes nicht immer schon von vornherein zu reduzieren auf große Persönlichkeiten, große Ereignisse oder große Reiche. Vielleicht ginge es auch einmal anders. Warum lassen sich denn nicht einmal Themenhefte entwerfen, die vermeintlich Abseitiges, Schräges, Unbeachtetes behandeln? Warum nicht etwas über die Geschichte des Schattens, des Spaziergangs oder der Börsenspekulation? Warum nicht eine genauere Betrachtung der Alpenfurcht und -begeisterung, familiärer Hierarchien oder der Sprache der Diplomatie? Etwa weil die Popularisierung immer nur so weit getrieben werden darf, wie das Zielpublikum bereits vorangeschritten ist? Sicherlich geben bei kommerziellen Unternehmen wie Geschichtsmagazinen die Auflagen den Ton an, weshalb sich immer das am besten verkauft, was ohnehin schon bekannt ist. Aber vielleicht gibt es ja thematische Nachfragen, von denen noch niemand etwas wusste, die gerade deswegen geweckt werden könnten, weil sie eben nicht das immer schon Bekannte aufwärmen?
Ich gebe zu, das ist recht idealistisch gedacht – wahrscheinlich zu idealistisch. Begnügt man sich bis zur Änderung dieses Zustands mit der regelmäßig dargebotenen Hausmannskost, so zeigen die Geschichtsmagazine eine dominierende Vorstellung von der Vergangenheit an, die zwar kein eindimensionales, aber doch recht übersichtliches Set an Funktionen aufweist: Erstens findet sich ein affirmatives Geschichtsbild, das auf Identifizierung, wenn nicht gar auf Identitätsbildung setzt. Hierzu dienen Klassikerthemen wie die Geschichte der jungen Bundesrepublik, noch eher aber biographische Zugänge – Stichwort: Vorbilder. Zweitens findet sich ein historischer Exotismus, der das Fremdartige hervorhebt. Das Mittelalter bietet sich hierfür schon seit Längerem als ideale Spielwiese an, denn hier kann man vermeintlich ohne Hemmungen allen Phantasien von sex’n’crime’n’powerplay frönen. Die dritte Variante ist gewissermaßen die negative Umkehrung der ersten, insofern sie auf Betroffenheit setzt und damit zu einer Identifizierung ex negativo anleiten möchte. Paradethema ist natürlich der Nationalsozialismus, aber alle Formen kriegerischer Auseinandersetzung, gesellschaftlicher Unterdrückung oder ethnischer Verfolgung können dazu herhalten.
Gegen solche Formen der Historisierung ist per se nichts zu sagen. Sie versäumen aber eine wichtige, wenn nicht sogar die wesentliche Qualität historischer Beschäftigung: Sie nutzen die zeitliche Distanz gerade nicht dazu, um Differenz zu thematisieren, um Selbstkritik zu üben und die Grundlagen gegenwärtiger Verhältnisse zu analysieren. Ein Geschichtsmagazin, das eben diese Möglichkeiten nutzt, würde ich gerne einmal lesen wollen – nur um es wohl nach der ersten Nummer wieder eingehen zu sehen.
[1] Geo Epoche, Nr. 60 (2013): Der Amerikanische Bürgerkrieg, S. 13.
[2] Geo Epoche, Nr. 60 (2013): Der Amerikanische Bürgerkrieg, S. 5.
Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtsmedien Tagged: Bild, Geschichtsmagazin, Popularisierung, Visualisierung
Quelle: http://achimlandwehr.wordpress.com/2013/12/30/17-magazinierte-geschichte/
16. Erinnerung ans Vergessen
Gegen Jahresende ballen sich die Erinnerungszumutungen. Allenthalben muss memoriert werden, was in den vergangenen elf Monaten geschehen ist. Deswegen ist der Dezember üblicherweise auch so ein ereignisloser Monat, in dem nichts – oder fast nichts – geschieht. Schließlich sind alle so intensiv mit Erinnern beschäftigt. So wie auf kollektiver Ebene die Jahresrückblicke einander die Klinke in die Hand geben, wird auch im Privaten dem Gewesenen gedacht, werden die familiären Chroniken in kondensierter Form unters befreundete Volk gebracht, werden Bilder und Filme und Sonstiges, das sich an diversen Orten angesammelt haben, fein säuberlich sortiert. Ein Jahr vorbei, das nächste kann kommen.
Gegen diese Form der Erinnerungsarbeit wäre wohl gar nichts zu sagen, wenn sie auf den Dezember beschränkt bliebe. Aber man muss zuweilen den Eindruck haben, dass ein nicht ganz unerheblicher Teil des gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens auch während der übrigen elf Monate für das Erinnern draufgeht. Gedenktage, Erinnerungsorte, Kranzabwurfstellen wo man hinschaut. Geschichte (was auch immer das sein soll) wird nahezu im Minutentakt zelebriert. Kaum ein Tag des Jahres, der nicht mit Erinnerungs- und Gedenkmarkierungen belegt ist, gerne auch mehrfach.
Da stellt sich die Frage, ob das nicht des Guten zu viel ist. Tut man der ‚Erinnerungsarbeit‘ einen Gefallen, wenn man sie zum dauerhaften Automatismus erstarren lässt? Sollte der Wert des Erinnerns – das ja gerade im deutschen Kontext immer ein mahnendes Erinnern an die Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts ist – nicht gerade in einer pointierten Prägnanz anstatt in einer industrialisierten Dauerveranstaltung liegen? Lebt nicht auch die ‚Erinnerungsarbeit‘ wie jede gute Arbeit davon, auch mal eine Pause einzulegen?
Eine memoriale Zwickmühle
Knifflige Fragen, nicht zuletzt weil damit ja nicht nur, und noch nicht einmal vornehmlich, historische Probleme angesprochen sind. Zwar wird in der öffentlichen Wahrnehmung das historische Geschäft vielfach mit der Notwendigkeit zum Erinnern identifiziert (Medien, Politik, Interessenverbände und einschlägige Persönlichkeiten der Geschichtswissenschaft tragen das Ihre dazu bei, um diesen Eindruck zu bestärken). Tatsächlich handelt es sich aber nicht um ein geschichtswissenschaftliches, sondern um ein gesellschafts- und identitätspolitisches Phänomen. Die erinnerungsmäßige Zwickmühle ist daher schnell ausgemacht: Einerseits führt das Zuviel an Erinnerung zu Überdruss, andererseits steht die politische und moralische Notwendigkeit des Erinnerns außer Frage, so dass es niemand wagt, die Erinnerungsintensität ein wenig zu drosseln, will man nicht als Relativierer und Revisionist dastehen.
Sicherlich ist Erinnerung wichtig. Auch abgesehen von der historisch-moralischen Plumpheit, dass sich die deutsche Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht wiederholen darf, kann man erkennen, was passiert, wenn das gesellschaftliche Erinnern vergessen wird. Zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft. Ein Problem, das sich in derzeitigen ökonomischen Praktiken identifizieren lässt, ist die nahezu programmatische Erinnerungslosigkeit. Krise war gestern – was zählt, ist der mögliche Gewinn von morgen. Das ökonomische Zeitmodell basiert auf einer Scheuklappentechnik, die weder nach rechts noch nach links und schon gar nicht nach hinten schaut.
Probleme der Erinnerungskultur
Woher dann aber trotzdem dieser diffuse Eindruck, dass mit der Erinnerungskultur irgendetwas nicht stimmt? Weshalb nervt Erinnerung, obwohl sie ‚richtig‘ ist? Ein Blick in ein neues Buch von Aleida Assmann kann bei der Beantwortung helfen [1]. „Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur“ versucht Assmann mit gewichtigen Argumenten auszuräumen. Implizit wird aber deutlich, wieso dieses Unbehagen nicht von ungefähr kommt.
Problem 1: Bloß weil die ‚Erinnerungspraxis‘ an sich gut und begrüßenswert ist, bedeutet das nicht, dass es auch die Ergebnisse der konkreten ‚Erinnerungsarbeit‘ immer sein müssen. Aufgrund der moralischen Aufladung fällt es schwer, dem Gedenken vorzuwerfen, es sei qualitativ schlecht. Assmann hebt in ihrem Buch ausführlich die Fernsehserie „Unsere Mütter, unsere Väter“ als ein wertvolles Beispiel jüngster Erinnerungskultur hervor. Wenn ich hingegen der Meinung bin, dass es sich um eine bedauerliche Form der Verharmlosung handelt, weil aufrechte, moralisch integre, junge deutsche Menschen vorgeführt werden, die zufällig auch überhaupt nicht antisemitisch sind, die noch nicht einmal für Krieg und Verbrechen verantwortlich gemacht werden können, weil sie Opfer übermächtiger, anonymer historischer Kräfte sind – zweifle ich dann schon die Bedeutung von Erinnerungskultur an sich an?
Problem 2 hängt unmittelbar damit zusammen: Erinnerungskultur entzieht sich tendenziell der Beurteilung, weil sie sich immer schon auf der moralisch richtigen Seite weiß. Das macht kritisches Nachfragen schwierig, zuweilen sogar verdächtig.
Problem 3: Erinnerungskultur geht nicht selten mit einer vulgärpsychologischen Dauerpathologisierung einher. Stichwort ‚Trauma‘! Da insbesondere die Deutschen, aber auch der Rest Europas und der Welt immer noch ‚traumatisiert‘ sind von Judenmord und Zweitem Weltkrieg und allen anderen Grausamkeiten, die die Geschichte der letzten hundert Jahre zu bieten hat, und zwar traumatisiert bis in die Enkel- und Urenkelgeneration hinein, muss – so der memoriallogische Schluss – notwendigerweise erinnert werden. Die Traumadiagnose wird zum Passepartout, das durch seine Dauerverwendung jegliche Aussagekraft verliert. Das ist bedauerlich, insbesondere für die tatsächlich Traumatisierten, hier und anderswo.
Problem 4: Erinnerungskultur ist nicht nur ein Geschäft, sie ist eine Industrie, die allein schon aus Gründen des eigenen wirtschaftlichen Überlebens nicht daran interessiert sein kann, die Memorialfrequenz zu verringern. Zu viele Jobs, Institutionen sowie öffentliche und private Gelder stecken in diesem Bereich, der sich nach wie vor über mangelnde Nachfrage nicht beschweren kann.
Diese erinnerungskulturelle Infrastruktur ist aber zugleich verstrickt in eine Überschuss-, und damit auch Überdrussproduktion, mit der sie sich – so meine Vermutung – keinen Gefallen tut. Sie könnte zum Eigentor werden. Was, wenn sich niemand mehr aus eigenem Antrieb aktiv erinnern will, weil ja schon immer passiv für einen erinnert wird? Dann geschieht eben doch das, was Aleida Assmann bestreitet, dann wird das Datum im Kalender eben doch zu einer „allgemeinen und gleichförmigen Erinnerungsverordnung“ (19).
Die größte Katastrophe?
Für das Vergessen Werbung zu machen, ist gar nicht nötig. Vergessen geschieht ohnehin beständig und ganz von selbst. An das Vergessen zu erinnern, soll auch gar nicht dazu auffordern, das Erinnern nun zu vergessen. Das ließe sich kaum dekretieren, und wäre zudem ein Missverständnis des Vergessens. Vergessen ist nämlich – entgegen landläufiger Meinung – nicht das Gegenteil von Erinnern, ist keine Vernichtung oder Auslöschung memorialer Inhalte. Daran wird man durch ein Buch aufmerksam gemacht, das fast gleichzeitig mit demjenigen von Assmann erschienen ist: „Die Formen des Vergessens“ von Marc Augé [2]. Vergessen erweist sich demnach nicht nur als überlebensnotwendig, sondern als Formvorgabe der Erinnerung und als produktive Praxis, mit der Kulturen ihre Wirklichkeit gestalten. Das Vergessen bleibt unterbelichtet, wenn es nur als Schattenseite der Erinnerungskultur verstanden wird. Denn das Verhältnis von Erinnern und Vergessen gestaltet sich nicht nach der Logik von Gewinn und Verlust, sondern nach der Differenz von Aktualität und Potentialität. Vergessen löst das Erinnerte nicht auf (denn ansonsten könnte man ja nicht wissen, dass man es vergessen hat), sondern es deaktualisiert bestimmte Wissensbestände.
Eines Morgens wurde ich an der von mir regelmäßig frequentierten Bushaltestelle von hungernden Menschen aus der Sahel-Zone angeblickt. Sie befanden sich auf einem Plakat der Diakonie Katastrophenhilfe, begleitet von dem Satz „Die größte Katastrophe ist das Vergessen“. Auch wenn die Intention dieser Kampagne richtig ist, so stimmt doch der Satz nicht. Man kann den Hunger auf der Welt nicht ‚vergessen‘. Man kann ihn nicht beachten, kann ihn beiseiteschieben oder verdrängen, aber ‚vergessen‘ kann man ihn nicht. Die größten Katastrophen sind daher Irrelevanz, Bedeutungslosigkeit, Unachtsamkeit.
Auf diesem Weg in den Aufmerksamkeitsverlust könnte sich die Erinnerungskultur befinden, wenn sie beliebig und unterschiedslos alles als der Erinnerung wert einstuft und das Vergessen verbietet. Einerseits produziert sie dadurch selbst Vergessen, nämlich in all denjenigen historischen Themenfeldern, die nicht Teil der Erinnerungskultur sind. Andererseits könnte sie selbst über kurz oder lang mit Deaktualisierung bestraft werden, wenn sie immer mehr vom Immergleichen einfordert.
[1] Aleida Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention, München 2013
[2] Marc Augé: Die Formen des Vergessens, Berlin 2013
Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtspolitik Tagged: Aleida Assmann, Erinnerung, Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur, Marc Augé, Vergessen
Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2013/12/18/16-erinnerung-ans-vergessen/