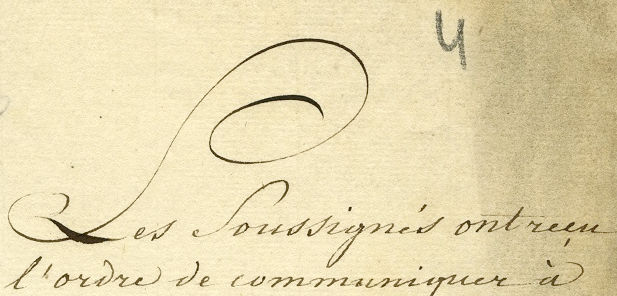Meisners in sich geschlossenes Lehrgebäude forderte in seinem Anspruch auf Allgemeingültigkeit die Kritik heraus. Solche Kritik wurde in den 1950er-Jahren unter zwei Aspekten geübt: Systemimmanent durch eine funktionale Betrachtung von Akten und mit einem radikal anderen Ansatz, der von den Strukturen der Überlieferung im Archiv ausgeht.
Beide Ansätze entstanden an der Archivschule Marburg, der 1949 gegründeten Ausbildungsstätte für den Archivdienst in der Bundesrepublik. Vom innerdeutschen Systemkonflikt blieb der aktenkundliche Disput mit Meisner in Ost-Berlin zum Glück verschont. Auch im Westen behielten Meisners Werke ihre Stellung als zentrale Referenz – schon weil die Marburger Schule, wenn man sie so nennen mag, keine eigenen Lehrbücher hervorbrachte.
Kurt Dülfer: Form follows function
Der Archivrat am Staatsarchiv Marburg Kurt Dülfer (1908–1973) lehrte in den 1950er-Jahren Aktenkunde an der Archivschule und an der Philipps-Universität. Er hatte schon 1951 in einer Rezension Meisners Fixierung auf Preußen im Ancien Régime und auf den Rechtscharakter von Urkunden und Akten kritisiert.
In seinem großen Aufsatz ging Dülfer (1957) nicht wie Meisner von der Sphäre der Fürstenkorrespondenz aus, sondern vom normalen Schriftgut der inneren Verwaltung, und löste Meisners statische Systematik in einer fließenden historischen Entwicklung der Aktenformen auf:
“‘Urkunde’ und ‘Acta’ […] entstammen der Gerichtssphäre und erhielten erst nachträglich die allgemeine Bedeutung des Begriffes, den wir ihnen heute beilegen.” (Dülfer 1957: 21)
Die Begriffsgeschichte zeigt für die Zeit zwischen 1500 und 1700 die Durchsetzung der Aktenführung im modernen Sinne an (Dülfer 1957: 19, 23–25). Von einem an den Formen festzumachenden scharfen Gegensatz zwischen Urkunden und Aktenstücken kann keine Rede sein, auch weil sich das moderne Schreiben aus dem mittelalterlichen Mandat entwickelt hat und in der jüngsten Zeit einfache Schreiben vielfach die Rolle von Urkunden übernommen haben (Dülfer 1957: 35–37).
Dülfer ersetzte die Form als Kriterium zur systematischen Bestimmung eines Aktenstücks durch die Funktion, ein im Grunde inhaltliches Kriterium: Was beabsichtigte der Verfasser eines Schriftstücks im Verhältnis zum Empfänger?
“Eine Abschrift einer Urkunde, die zur Kenntnis und Erinnerung bestimmter Fragen hergestellt wird, hat ihre Bedeutung nicht als Urkunde, sondern als ein Schriftstück der Erinnerung. […] Eine Denkschrift kann zur Vorlage in der Öffentlichkeit oder bei wenigen Personen oder zum Zweck der eigenen Klärung bestimmt sein. Je nach dieser Funktion richtet sich ihre Einordnung in eine bestimmte Gruppe. Mit jedem Schriftstück verfolgt sein Aussteller einen bestimmten Zweck, er überträgt ihm eine Funktion. Damit tritt neben das Formprinzip die Erkenntnis von Zweck und Absicht eines Schriftstückes.” (Dülfer 1957: 27 f.)
Auf dieser Grundlage kam Dülfer (1957: 49–52) zu einer Einteilung des Behördenschriftguts, die auf auf der Beziehung der Korrespondenten aufbaute. Er unterschied
- Verkehrsschriftstücke an einen Empfänger, und zwar
- offene Schreiben an einen unbestimmten Kreis und
- geschlossene Schreiben an bestimmte Personen, sowie
- Memorienschreibwerk zur Aufzeichnung von Informationen für den Verfasser selbst.
“Offen” und “geschlossen” hat also nichts mit dem physischen Verschluss eines Schreibens zu tun, sondern meint den “Publizitätswillen” des Verfassers!
Dieses System erschien Dülfer (1957: 53) flexibel genug, um darunter neben Urkunden und anderen Schriftstücken auch Karten und Amtsbücher subsumieren. In Kenntnis der weiter unten zu schildernden Amtsbuchdebatte wird man ihm in diesem Punkt nicht mehr folgen wollen.
Dülfer bezog die möglichen Funktionalitäten des Schriftverkehrs auf das Modell einer hierarchischen Behörde: Bericht an den Vorgesetzten, Weisung an den Untergebenen, Mitteilung auf gleicher Ebene. Man mag sich also fragen, wo in der Praxis der Unterschied zu Meisners hierarchischer Klassifikation liegt. Man muss sich aber auch darin erinnern, dass die systematische Bestimmung ein Schriftstück nicht nur einsortieren, sondern auch Erkenntnisse liefern sollte.
Wenn Form und Funktion eines Stücks auseinander fallen, ob eine “Urkunde in Form eines Schreibens” oder aber ein Schreiben in “Funktion einer Urkunde” (Dülfer 1957: 28) vorliegt: Daraus lassen sich daraus Schlüsse über die Absicht und die Gewohnheiten des Verfassers ziehen. Wer das für Erbsenzählerei hält, sollte die Fallstudien zum Verhältnis von Kabinettsorder und Handschreiben von Korn (1973) und Moormann (1980) lesen.
Johannes Papritz: Was hat man sich dabei nur gedacht?
Archivare mag es verblüffen, den Namen Johannes Papritz (1898–1992) an dieser Stelle zu lesen. Der Meister der Strukturanalyse hat sich auch mit noch eher konventioneller Aktenkunde befasst. Papritz war seit 1954 in Personalunion Direktor des Staatsarchivs Marburg und der Archivschule und lehrte dort das Fach Archivwissenschaft, das er im Grunde selbst begründet hat.
Papritz (1959) führte Dülfers Frage nach der Funktion einen wichtigen Schritt weiter. Das Absender-Empfänger-Verhältnis setzt natürlich einen Empfänger voraus. Was aber, wenn es keinen gab? Wie schon Meisner hatte sich Dülfer auf den externen Schriftverkehr konzentriert und die große Masse der für die eigenen Akten bestimmten Aufzeichnungen an den Rand gerückt. Papritz ging von der einfachen Tatsache aus, dass Institutionen nicht alle ihre Handlungen verschriftlichen – eine unangenehme Wahrheit, die Archivbenutzer gern verdrängen.
Die Behörde braucht ein Motiv, um Zeit und Geld in die Aktenführung zu investieren. Die Mitteilung an Entfernte, unter deren Stern die Meisnersche Systematik steht, ist nur ein Motiv unter anderen. Informationen können ebenso als Gedächtnisstütze, zur Festlegung der eigenen Meinung, zur Wahrung von Interessen, zur Wirtschaftsführung und zur Ordnung des Geschäftsbetriebs schriftlich niedergelegt werden. Die Urkunde und ihr Rechtscharakter sind kein Wert an sich, sondern, wie auch das Amtsbuch, nur Ausprägungen des Motivs der Rechtssicherung (Papritz 1957: 341–343).
Das ist klar und einsichtig, wird aber bei Papritz von einer Absicht getragen, die auf die schiefe Bahn führt: Behördenschriftgut wird als reine Dokumentation betrachtet, als Sammlung von Informationsträgern. Dass die Schriftstücke Arbeitswerkzeuge der Verwaltung waren und aus kontinuierlichen Handlungen entstanden sind, kann so aus dem Blick geraten.
Nach Papritz (1957: 340) entspringt der Entwurf zu einem externen Schreiben, der bei den eigenen Akten verbleibt, nicht dem Motiv der Mitteilung an Entfernte, sondern dient als Gedächtnisstütze. Das ist logisch unanfechtbar, bringt einer Historischen Hilfswissenschaft aber keinen Erkenntnisgewinn. Meisner sieht in einem solchen Entwurf selbstverständlich die Entstehungsstufe eines Mitteilungsschreibens und hätte es niemals anders bestimmt.
Auf die systematische Klassifikation kam es Papritz (1957: 348) aber auch nicht an:
“Die ordnende Betrachtung der Motive, denen das in den Archiven bewahrte Schriftgut seine Entstehung verdankt, mag ihren Wert in sich tragen, geradezu entscheidende Bedeutung aber hat eine solche begriffliche Klärung, wenn man die Organisationsformen der Schriftgutkörper erforschen will.”
Damit ist die Naht zwischen der Aktenkunde als Historischer Hilfswissenschaft und der Archivwissenschaft erreicht: Die eine rekonstruiert aus der Entstehung von Schriftstücken Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten, die andere analysiert, unter anderem, die Strukturen, in denen die heutige archivalische Überlieferung vorliegt.
Ernst Pitz: Begründung der Amtsbuchkunde
Ernst Pitz (1928–2009) absolvierte die Archivschule unter Papritz’ Ägide und war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seiner stark erweiterten Dissertation am Staatsarchiv Wolfenbüttel tätig. Pitz (1959: 446–480) stellt mustergültig dar, wie nacheinander
- die Ausbildung der städtischen Ratsverfassung Motive zur Verschriftlichung in Form von Bucheinträgen schafft,
- aus einer ursprünglichen Buchreihe durch Serienspaltung inhaltlich spezialisierte Bücher werden,
- unter dem Rat nachgeordnete Ämter mit eigener Buchführung entstehen,
- schließlich eine Aktenführung auf Einzelblättern die gebundenen Bücher ergänzt.
Ohne die 1953 eingereichte Manuskript-Fassung zu kennen, die sich auf Lübeck als Gegenstand beschränkte, darf man unterstellen, dass Papritz’ auf die Erkenntnis von Strukturen ausgerichtete Lehre in der Archivwissenschaft die endgültige Fassung beeinflusst hat. Pitz (1957: 466) versteht sein Handwerk als Aktenkunde, doch in radikaler Umwertung:
“Das erste Ziel der Aktenkunde, den in den Akten aufbewahrten Bestand der Akten aus sich zu erklären, ist damit erreicht.”
Das ist, gelinde gesagt, strittig. Pitz’ vorrangiges Interesse galt dem Papier als Endprodukt von Handlungen. Wie Papritz setzte er sich von der traditionellen genetischen Betrachtung der Entstehung von Schriftstücken ab:
“Die Konzepte namentlich nehmen unsere Aufmerksamkeit nicht als Vorstufen der Ausfertigungen in Anspruch, sondern nur als Schriftstücke, die von einer vollzogenen Amtshandlung Kunde geben, und das gleiche gilt für alle Urkunden.” (Pitz 1959: 29)
Hier begegnet auch wieder die Unterscheidung von Akten und Urkunden, doch ebenfalls in einer neuen, inhaltlichen Definition:
“Wendet man mit Meisner die Prinzipien der Urkundenlehre auf die Akten an (indem man von dem einzelnen Schriftstück ausgeht), so gelangt man zu einem systematischen Gebäude; legt man den Unterschied zwischen Urkunden und Akten, daß jene als Einzelstücke für sich verständlich sind, diese dagegen nur in Zusammenhängen […], zugrunde, so gelangt man zu einem die Entwicklung der Aktenbestände erfassenden Gebäude.” (Pitz 1959: 26)
Ein Stück weit muss Meisner hier als Pappkamerad dienen, auf den eingedroschen wird. Pitz Untersuchungsgegenstand ist ebenso speziell wie Meisners Brandenburg-Preußen: spätmittelalterliche städtische Amtsbücher, und er verallgemeinert seine Ergebnisse ebenfalls zu schnell. Dass man mit Meisners Instrumentarium keine Amtsbücher untersuchen kann, zwingt nicht dazu, diese Methodologie insgesamt zu verwerfen.
Pitz hat nicht die Aktenkunde revolutioniert, sondern als Sondergebiet die Amtsbuchkunde begründet, die eng mit der Kodikologie zusammenhängt. Die physische Struktur des Buchs erzwingt und ermöglicht andere Techniken der Verschriftlichung, die Küchhilfswissenschaftlich nicht mit Aktenführung aus Einzelschriftstücken über einen Kamm geschoren werden dürfen.
Die Amtsbuchkunde hat mittlerweile eine eigene Forschungsliteratur hervorgebrachte (Pätzold 1998, Kloosterhuis 2004). Der kodikologische Aspekt der Arbeit mit diesen Büchern wurde unübertroffen plastisch von Quirin (1991: 83-103) dargestellt.
Ahasver von Brandt: Stumpfes Werkzeug
Warum hat diese ergiebige Diskussion, Meisners Repliken eingeschlossen, außerhalb eines kleinen Kreises von Archivaren eigentlich so wenig Widerhall gefunden?
Ahasver von Brandt (1909-1977), Stadtarchivar von Lübeck, aber kein Absolvent der preußischen Archivarsausbildung, überging in seinem “Werkzeug des Historikers”, das bekanntlich Generationen von Studenten geprägt hat, Meisners Lehre bis auf ihren untauglichen Teil, die Unterscheidung von Akten und Urkunden nach dem Rechtscharakter. Es ist abstrus, “jede[n] politische[n] Beschluss” zum “Rechtsgeschäft” zu erklären, “in einem weiten Sinne”, um weiter einen unreflektierten Urkundenbegriff anwenden zu können (von Brandt 1963: 127).
Er ordnet die Amtsbücher einfach den Akten zu und verwendet den meisten Platz für ein Propädeutikum der Archivrecherche. Was tiefgreifend rezipiert wurde, war Papritz’ archivwissenschaftliche Strukturlehre. Wie so ein Aktenstück eigentlich aussieht, aus welchen Teilen es sich zusammensetzt, selbst in welchen Stufen es nach Küch entsteht, verrät von Brandt (1963: 125–139) seinen Lesern in den Proseminaren nicht. War ihm die neuzeitliche Hilfswissenschaft eine lästige Verpflichtung zur linken Hand?
So verbirgt seit über 50 Jahren das “Werkzeug des Historikers” den Gegenstand und die Methoden der Aktenkunde mehr als es darin einführt.
Literatur
Außer den mit * gekennzeichneten werden alle Titel auch in der Basisbibliografie zur Aktenkunde nachgewiesen.
*Brandt, Ahasver v. 1963. Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften. 3. Aufl. Stuttgart. [Ursprünglich 1958]
*Dülfer, Kurt 1951. [Rezension zu] Heinrich Otto Meisner, Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. In: Der Archivar 4. Sp. 41–45. #Online?
Dülfer, Kurt 1957. Urkunden, Akten und Schreiben in Mittelalter und Neuzeit. Studien zum Formproblem. In: Archivalische Zeitschrift 53. S. 11–53.
Kloosterhuis, Jürgen 2004. Mittelalterliche Amtsbücher: Strukturen und Materien. In: Friedrich Beck/Eckart Henning, Hg. 2004. Die archivalischen Quellen. 4. Aufl. Köln u. a. S.53–73.
Korn, Hans-Enno 1972. Kabinettsordres: Ein Kapitel Aktenkunde. In: Der Archivar 26. Sp. 225–332.
Online
Moormann, Wolf-Dieter 1980. Braunschweigische Kabinettsorders. In: Archivalische Zeitschrift 76. S. 57–68.
Papritz, Johannes 1959. Die Motive der Entstehung archivischen Schriftgutes. In: Comitè des Mélanges Braibant, Hg. 1959. Mélanges offerts par ses confrères étrangers à Charles Braibant. Brüssel. S. 337–348.
Pätzold, Stefan 1998. Amtsbücher des Mittelalters: Überlegungen zum Stand ihrer Erforschung. In: Archivalische Zeitschrift. 81. S. 87–111.
Pitz, Ernst 1959. Schrift- und Aktenwesen der städtischen Verwaltung im Spätmittelalter: Köln, Nürnberg, Lübeck. Beitrag zur vergleichenden Städteforschung und zur spätmittelalterlichen Aktenkunde. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 45. Köln.
*Quirin, Heinz 1991. Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte. 4. Aufl. Ndr. Stuttgart. [Ursprünglich 1950]
Quelle: http://aktenkunde.hypotheses.org/344