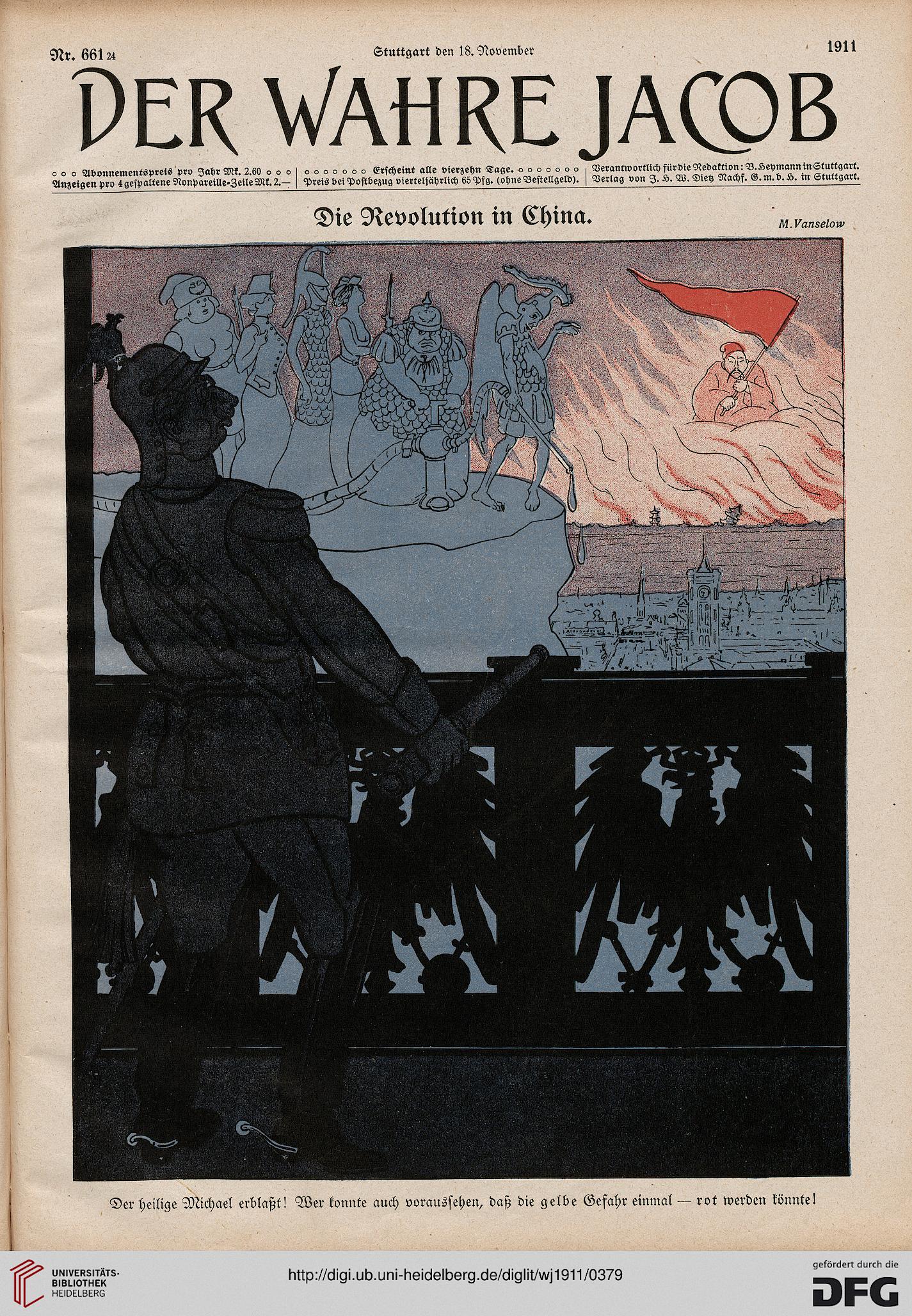|
| Eamonn de Valera |
Um die Wirren des Bürgerkriegs endlich hinter sich zu lassen, beschloss die nun regierende
Fianna Fàil, die IRA zu legalisieren und einen Schlussstrich zu ziehen, indem man Amnesien für politische Gewalttaten der Vergangenheit aussprach. Die Wahlen von 1932 gewann Fianna Fàil entscheidend gegen ihre Gegner der Gründerpartei
Cumann na nGaedheal, indem sie von deren laissez-faire-Politik abrückte und stattdessen ein staatlich gesteuertes Industrialisierungsprogramm, die Schaffung von Jobs und die Errichtung eines sozialen Netzes propagierte. Sie forderte außerdem die vollständige Unabhängigkeit vom britischen Empire, anstatt im bisherigen Dominion-Status zu verbleiben. Bis weit ins 20. Jahrhundert ist die Fianna Fàil die natürliche Regierungspartei Irlands geblieben.
In den 1930er Jahren erwuchs ihr jedoch Konkurrenz am rechten Rand. Die "
Army Comrades Associaton", die sich bald als "
National Guard" taufte und deren Anhänger wegen ihrer Uniformierung "Blauhemden" genannt wurden, versuchten zwar nicht, die Macht auf parlamentarischem Wege zu erobern (wie es Hitlers Nationalsozialisten 1933 tun würden), sondern orientierten sich mehr am Vorbild von Mussolinis italienischen Schwarzhemden. Gleichwohl gefährdeten sie die innere Sicherheit, weil sie sich beständig mit der IRA Scharmützel und offene Straßenschlachten lieferten, was gleichzeitig einen ohnehin vorhandenen Linksruck der IRA beförderte, die man bald nur noch als linksextrimistische Terrororganisation beschreiben konnte (eine Entwicklung, die in Nordirland bereits vorher verlaufen war). Als die Blauhemden 1933 in einer Nachahmung von Mussolinis "Marsch auf Rom" einen erfolglosen Angriff auf die Dáil unternommen, wurde die Organisation von Präsident de Valera verboten. Das Gespenst einer faschistischen Machtübernahme zerstob damit in Irland genausoschnell wie in Großbritannien, wo Mosley mit seiner faschistischen Partei ein ähnlich unrühmliches Ende fand.
 |
| Abzeichen der Blauhemden |
Es zeigte sich bald, dass de Valeras entschiedenes Durchgreifen gegen die Blauhemden auch den anderen inneren Unruheherd begünstigte. Nachdem die IRA nun vor allem gegen Repräsentanten des Systems vorging und diese ermorderte, erließ de Valera 1936 auch ein Verbot der IRA, das 1939 mit drakonischen Maßnahmen verschärft und durchgesetzt wurde. Die irische Politik löste sich damit endgültig von der bewaffneten Durchsetzung und bewegte sich ab sofort auf verfassungsrechtlicheren Pfaden. Dazu passte, dass de Valera dem Land 1937 eine neue Verfassung gab. Sie wurde mit einfachem Plebiszit bestätigt und schaffte viele der früheren Provisorien ab, darunter auch die Titel der Regierungsorgane (Präsident statt Governor-General, Government statt Exeucutive Council, etc.). Eine Republik war das Land aber offiziell immer noch nicht, sondern Königreich im Vereinigten Königreich Großbritanniens.
Das sollte sich bald ändern, denn der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schuf für Großbritannien eine Reihe wesentlich dringenderer Probleme als die irische Politik. Irland erklärte sich für neutral - was viele im Land als wichtigen Schritt zur echten Unabhängigkeit empfanden - arbeitete aber im Geheimen mit den Alliierten zusammen, was so weit ging, dass Pläne für den Fall einer deutschen Invasion ausgearbeitet wurden. In diesem Fall (von der Wehrmacht mit üblich deutscher Kreativität "Fall Grün" getauft) wäre die irische Armee alliiertem Kommando unterstellt worden. Dies stellte für Irland sicher, dass die siegreichen Alliierten das Land nicht als Feind betrachten würden. Die IRA dagegen sah die Ereignisse als Chance, die Briten aus Nordirland zu vertreiben und begann eine neue Terrorkampagne. Sie plante sogar, die Nazis um Hilfe zu bitten, wozu es freilich nie kam. De Valera griff hart durch, internierte alle bekannten IRA-Anführer und hängte diverse Terroristen. Die kurze IRA-Terrorwelle kam damit schnell wieder zum Erliegen, ohne große Auswirkungen zu haben.
 |
| Sitzungssaal des Dàil |
1949 erklärte Irland sich endgültig zur Republik, was nach den geltenden Regularien des Commonwealth einen automatischen Ausschluss zur Folge hatte (da man ja das Oberhaupt der Krone von England nicht anerkannte). Dies war kein Ausschlussgrund; Indien etwa, das 1947 seine Unabhängigkeit als Republik erklärt hatte, trat danach wieder ein. Irland tat dies jedoch nicht, und die britische Regierung erklärte öffentlich, das Land fortan als Ausland zu betrachten. Erst 1962 jedoch wurde in Irland auch formell die englische Krone als Staatsoberhaupt abgelöst und die vakante Repräsentanz im britischen Parlament aufgegeben.
Die irische Wirtschaftspolitik hoher Schutzzölle und des Versuchs des Aufbaus eigener Industrie unter de Valera scheiterte in diesen Jahren jedoch. Obwohl Irland aus dem Zweiten Weltkrieg dank seiner Neutralität mit wesentlich besserer Wirtschaftslage herausgegangen war, stagnierte die Wirtschaft stark, während der Rest Europas einen Aufschwung erlebte. Dies führte 1958 zum Regierungswechsel. De Valera, der seit rund 20 Jahren Regierungschef gewesen war, wurde abgelöst, und mit ihm seine Wirtschaftspolitik. Irland senkte radikal die Zölle, investierte in Infrastruktur und erlebte bald hohe Wachstumsraten, die es an den europäischen Standard aufschließen ließen und die das Land verkrüppelnde Emigrationsraten deutlich senkten.
 |
| Charles de Gaulle |
Auf der internationalen Bühne spielte Irland im Kalten Krieg praktisch keine Rolle. Ohne Zugehörigkeit zu einem der beiden Blöcke, aber mit starken Bindungen an die angelsächsische Welt verwehrte ihr die UdSSR bis 1955 die Anerkennung in der UNO. Danach war das große außenpolitische Projekt Irlands die Aufnahme in die Europäische Union, von der man sich - gerade dank der begonnenen Freihandelspolitik der niedrigen Zölle - deutliche Wachstumsimpulse erhoffte. Das Land wurde aber zur Geisel Frankreichs eigener Großmachtpolitik unter Charles de Gaulles in jener Zeit, der die geplante Aufnahme Großbritanniens aus machtpolitischen Gründen mit seinem Veto blockierte. Auch Irlands Aufnahme fiel unter dieses Veto, da die Insel wegen ihrer starken Anbindungen zur britischen Wirtschaft wirtschaftlich kaum von Großbriannien zu trennen war.
Eine der wichtigsten Reformen, die Irland in dieser Zeit vornahm, war die Schulgeldfreiheit. Sie gehörte in das größere Bündel der Infrastrukturmaßnahmen, war aber wesentlich mit dafür verantwortlich, dass die Gesellschaft den Sprung von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft schaffte. Breiten Schichten wurde erstmals der Zugang zu höherer Bildung ermöglicht, was gleichzeitig für eine Bewegung der Bevölkerung sorgte. Viele Menschen begannen vom Land in die Stadt zu ziehen, und das soziale Klima liberalisierte sich (wenngleich die starke katholische Ausrichtung des Landes es im europäischen Vergleich immer noch illiberal erscheinen lässt, besonders in Fragen wie der Abtreibung).
 |
| Parade des Orange Order |
In der Zwischenzeit hatte Nordirland seine eigenen Probleme. Die weit reichende Diskriminierung der katholischen Minderheit durch die wirtschaftliche Elite der Protestanten fand praktisch eine Insitutionalisierung; zahlreiche Gesetze benachteiligten die Katholiken und schlossen sie von Staatsämtern aus. Gleichzeitig wurde durch Wahlmanipulation ihre Bedeutung verringert. Protestantische Opposition gegen die Ulster Unionist Party konnte keine große Bedeutung erreichen, weil sie zersplittert und über ihre Ziele uneins war.
Effektiv befand sich Nordirland von 1925 bis 1965 unter einer kontinuierlichen und ruhigen Kontrolle der Unionisten, die allerdings immer wieder von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Katholiken und Protestanten kurz erschüttert wurde. Der schlimmste Zusammenstoß dieser Art fand 1935 statt, als der
Orange Order bei einem Umzug von seiner Route abwich und durch ein katholisches Viertel zog. Erwartungsgemäß kam es zu einem Ausbruch von Gewalt mit neun Toten und zahlreichen Verletzten, der von der Regierung als Vorwand für Repressalien gegen die Katholiken genutzt wurde. Insgesamt blieb Nordirland ein Pulverfass, das kontinuierlich nicht explodierte. Die Unionisten schienen die Situation im Griff zu haben.
 |
| Parlament in Belfast |
Ein Wandel wurde schließlich von innerhalb der Ulster Unionist Party erreicht, als Viscount Brookeborough von Terence O'Neill als Premierminister abgelöst wurde. Letzterer kam 1963 an die Macht, als auch die Republik Irland einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Der gemeinsame Weg zur Industrialisierung verbesserte die Beziehungen der beiden Irlands, und O'Neill bemühte sich sehr darum, die Beziehungen zwischen Katholiken und Protestanten zu verbessern. Radikale innerhalb Nordirlands selbst arbeiteten jedoch von beiden Seiten gegen ihn: weder der
Orange Order noch die IRA hatten ernsthaftes Interesse an Frieden, und auch innerhalb der Partei selbst gab es heftige Kritik. Regierungsmitglieder wurden auf Versammlungen tätlich angegriffen. Doch all diese Unruhe war nichts gegen den Ärger, der ab 1969 über Nordirland hereinbrechen sollte.
Literaturhinweise:
Richard English - Armed Struggle - The history of the IRA T. R. Dwyer - Michael CollinsMichael Collins (DVD, Spielfilm)The Wind that shakes the Barley (DVD, Spielfilm)