17. Magazinierte Geschichte
 Popularität vs. Seriosität?
Popularität vs. Seriosität?
Regelmäßig bringen sie das Neueste von gestern und vorgestern in den Zeitschriftenhandel: Geschichtsmagazine. Sie erfreuen sich bei einer anhaltend großen Leserschaft einer ebenso anhaltend großen Beliebtheit. In den Bahnhofsbuchhandlungen liegen sie nicht irgendwo versteckt, hinten in der Ecke aus, sondern finden sich prominent am Eingang platziert, zu großen Stapeln aufgehäuft. Aber auch in jedem Kiosk um die Ecke kann man sie finden, diese Hefte, die eine informative und unterhaltsame Reise in die Vergangenheit versprechen. Der Markt für Geschichtsmagazine scheint so gut bestellt zu sein, dass sich schon seit einigen Jahren gleich mehrere von ihnen Konkurrenz machen können.
Neben den Zeitschriften „Damals“ (verkaufte Exemplare 22.779) und „G/Geschichte“ (27.719), die dieses Geschäft schon seit Längerem betreiben und, ebenso wie „P.M. History“ (45.893), auf eine Heftgestaltung gemischten Inhalts setzen, sind es vor allem die großen Verlage, die dieses Segment für sich in Anspruch nehmen. Am prominentesten ist wohl „Geo Epoche“ aus dem Haus Gruner + Jahr (109.320), ein Magazin, das von sich behauptet, die Nummer 1 unter den populären historischen Zeitschriften zu sein. Aber auch „Der Spiegel“ (84.019) und „Die Zeit“ warten seit einiger Zeit mit eigenen Geschichtsmagazinen auf (Alle Verkaufszahlen laut IVW 3. Quartal 2013).
Aus wissenschaftlicher Perspektive sind Geschichtsmagazine durch eine unübersehbare Ambivalenz geprägt. Einerseits kann man sich nur freuen über die Aufmerksamkeit, die historische Themen in der Öffentlichkeit genießen. Vergleichbare populäre Zeitschriften zur Linguistik, Literaturwissenschaft oder Soziologie gibt es nicht. Andererseits wird gerade diese Popularität zuweilen mit dem Verlust wissenschaftlicher Seriosität und Komplexität erkauft.
Aber mir soll es hier nicht um die schon x-fach erörterten Spannungen zwischen wissenschaftlichen Ansprüchen und ihrer Aufbereitung für ein größeres Publikum gehen. Denn gegen solche Formen der Popularisierung zu polemisieren, halte ich offen gestanden für ein Luxusproblem – besser eine komplexitätsreduzierte Übersetzung als gar keine Wahrnehmung. Nein, was ich am Phänomen ‚Geschichtsmagazin‘ viel interessanter finde, ist die aktuelle Geschichtskultur, die sich darin manifestiert. Wenn sich eine Gesellschaft derart für Vergangenes interessiert, dass sie nicht nur in Fernseh-, sondern auch in Heftformaten eifrig darauf zurückgreift – welche Form nimmt dieses Vergangene dann an? Denn Popularisierungen funktionieren üblicherweise über Kreuz: Eine bestimmte Nachfrage soll befriedigt werden, und zwar so, dass sie sich nicht zuletzt auch wirtschaftlich rechnet. Zugleich besteht (zumindest theoretisch) die Möglichkeit, neue Angebote zu machen und Bedürfnisse zu wecken, die bisher möglicherweise noch gar nicht formuliert werden konnten.
Bildlichkeit vs. Genauigkeit?
Die Inhalte der Geschichtsmagazine lassen sich – kaum überraschend – nicht über einen Kamm scheren. Bei den Artikeln ist so ziemlich alles dabei, was man in textlichen Gemischtwarenläden erwarten darf. Vom eher unbeholfenen Artikel des bemühten Volontärs über die schmissig-journalistische Reportage bis zur nüchternen Auseinandersetzung der universitär bestallten Historikerin findet man Erfreuliches und weniger Erbauliches.
Eines ist aber unbedingte Voraussetzung: Die Themen müssen bildfähig sein. Ohne Bebilderung geht gar nichts. Man müsste es noch genauer nachrechnen (was ich nicht getan habe), aber nach meiner Schätzung wird etwa die Hälfte eines Heftumfangs durch Abbildungen eingenommen. Und durch Karten. Insbesondere „Geo Epoche“ nutzt Karten (zusätzlich zu sehr vielen Bildern) ausgiebig, um deutlich zu machen, dass Geschichte nicht nur in der Zeit und im Text, sondern auch im Raum und im Bild stattfindet. Damit haben Geschichtsmagazine eine Möglichkeit, die vielen historischen Büchern aus Kostengründen fehlen, wenn sie so ausgiebig auf Abbildungen zurückzugreifen. Dafür liegen die Preise dann aber auch schon auf dem Niveau von schmalen Büchern. Zuweilen führt diese Visualisierungspraxis zu zweifelhaften Auswüchsen, so wenn Historiengemälde aus dem 19. Jahrhunderts zur Illustration mittelalterlicher Verhältnisse herangezogen werden oder wenn im Heft über den Amerikanischen Bürgerkrieg von „Geo Epoche“ Fotografien digital koloriert wurden, „um ihre Anschaulichkeit zu verstärken“ [1]. Geschichtstuning für Fortgeschrittene.
Es wäre interessant, eine Redaktionssitzung zur Erstellung eines solchen Heftes belauschen zu können, um zu erfahren, nach welchen Gesichtspunkten die einzelnen Beiträge ausgesucht werden. Man kann aber auch ohne entsprechende Abhörprotokolle von den abgedruckten Artikeln auf die übergeordneten Prinzipien schließen: Zunächst geht es um Überblickswissen, das den Rahmen bereiten soll für die Schilderung bestimmter Ereignisse, für Menschlich-Biographisches und für Aspekte des Alltagslebens, die einen wesentlichen Teil des Inhalts ausmachen. Nicht minder interessant sind aber die Themenbereiche, die nur am Rande vorkommen oder auch ganz ausgelassen werden: Es sind all diejenigen, die wenig Anschauliches zu bieten haben, die strukturelle Grundlagen in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder Kultur betreffen. Befürchtet man hier möglicherweise Langeweile in der Geschichtsunterhaltung – obwohl es gerade hier in einem doppelten Sinn ‚grundlegend‘ werden könnte?
Nicht selten scheinen sich die Artikel aus der ‚Übersetzung‘ wissenschaftlicher Forschung (und dickleibiger Bücher) in Artikelform zu speisen. Insofern liegt hier ein prototypischer (und überhaupt nicht abwertend gemeinter) Fall von Popularisierung wissenschaftlichen Wissens vor. Zweifelsfalten kriechen allerdings auf die Denkerstirn, wenn im Kleingedruckten darauf verwiesen wird, begriffliche Unterschiede nicht ganz so genau zu nehmen. Da wird dann beispielsweise aus Gründen der sprachlichen Varianz die Sklaverei mit Leibeigenschaft, Knechtschaft und Unfreiheit in einen begrifflichen Topf geschmissen. Das ist keine Popularisierung mehr, sondern ziemlich grobe Ungenauigkeit [2].
Distanz als Differenz!
Treten wir aber einen Schritt zurück, sehen von den konkreten Heftinhalten ab und betrachten das größere Themenspektrum. Dann fällt auf, dass Bewährtes aufbereitet, etablierte Themen besetzt und das ohnehin bereits – zumindest ungefähr – Bekannte abgehandelt wird. Klassische Themen, die auch schon den schulischen Geschichtsunterricht prägten, werden vielfach wieder aufgegriffen: das antike Rom, Napoleon, der Nationalsozialismus, die Kreuzritter oder der Erste Weltkrieg – Länder, Menschen, Abenteuer. Man weiß also immer, was man bekommt, Überraschungen bleiben die Ausnahme. Damit bleibt aber leider auch die Möglichkeit ungenutzt, die ausgetretenen Pfade zumindest ein wenig zu verlassen, Vergangenes nicht immer schon von vornherein zu reduzieren auf große Persönlichkeiten, große Ereignisse oder große Reiche. Vielleicht ginge es auch einmal anders. Warum lassen sich denn nicht einmal Themenhefte entwerfen, die vermeintlich Abseitiges, Schräges, Unbeachtetes behandeln? Warum nicht etwas über die Geschichte des Schattens, des Spaziergangs oder der Börsenspekulation? Warum nicht eine genauere Betrachtung der Alpenfurcht und -begeisterung, familiärer Hierarchien oder der Sprache der Diplomatie? Etwa weil die Popularisierung immer nur so weit getrieben werden darf, wie das Zielpublikum bereits vorangeschritten ist? Sicherlich geben bei kommerziellen Unternehmen wie Geschichtsmagazinen die Auflagen den Ton an, weshalb sich immer das am besten verkauft, was ohnehin schon bekannt ist. Aber vielleicht gibt es ja thematische Nachfragen, von denen noch niemand etwas wusste, die gerade deswegen geweckt werden könnten, weil sie eben nicht das immer schon Bekannte aufwärmen?
Ich gebe zu, das ist recht idealistisch gedacht – wahrscheinlich zu idealistisch. Begnügt man sich bis zur Änderung dieses Zustands mit der regelmäßig dargebotenen Hausmannskost, so zeigen die Geschichtsmagazine eine dominierende Vorstellung von der Vergangenheit an, die zwar kein eindimensionales, aber doch recht übersichtliches Set an Funktionen aufweist: Erstens findet sich ein affirmatives Geschichtsbild, das auf Identifizierung, wenn nicht gar auf Identitätsbildung setzt. Hierzu dienen Klassikerthemen wie die Geschichte der jungen Bundesrepublik, noch eher aber biographische Zugänge – Stichwort: Vorbilder. Zweitens findet sich ein historischer Exotismus, der das Fremdartige hervorhebt. Das Mittelalter bietet sich hierfür schon seit Längerem als ideale Spielwiese an, denn hier kann man vermeintlich ohne Hemmungen allen Phantasien von sex’n’crime’n’powerplay frönen. Die dritte Variante ist gewissermaßen die negative Umkehrung der ersten, insofern sie auf Betroffenheit setzt und damit zu einer Identifizierung ex negativo anleiten möchte. Paradethema ist natürlich der Nationalsozialismus, aber alle Formen kriegerischer Auseinandersetzung, gesellschaftlicher Unterdrückung oder ethnischer Verfolgung können dazu herhalten.
Gegen solche Formen der Historisierung ist per se nichts zu sagen. Sie versäumen aber eine wichtige, wenn nicht sogar die wesentliche Qualität historischer Beschäftigung: Sie nutzen die zeitliche Distanz gerade nicht dazu, um Differenz zu thematisieren, um Selbstkritik zu üben und die Grundlagen gegenwärtiger Verhältnisse zu analysieren. Ein Geschichtsmagazin, das eben diese Möglichkeiten nutzt, würde ich gerne einmal lesen wollen – nur um es wohl nach der ersten Nummer wieder eingehen zu sehen.
[1] Geo Epoche, Nr. 60 (2013): Der Amerikanische Bürgerkrieg, S. 13.
[2] Geo Epoche, Nr. 60 (2013): Der Amerikanische Bürgerkrieg, S. 5.
Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtsmedien Tagged: Bild, Geschichtsmagazin, Popularisierung, Visualisierung
Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2013/12/30/17-magazinierte-geschichte/
17. Magazinierte Geschichte
Popularität vs. Seriosität?
Regelmäßig bringen sie das Neueste von gestern und vorgestern in den Zeitschriftenhandel: Geschichtsmagazine. Sie erfreuen sich bei einer anhaltend großen Leserschaft einer ebenso anhaltend großen Beliebtheit. In den Bahnhofsbuchhandlungen liegen sie nicht irgendwo versteckt, hinten in der Ecke aus, sondern finden sich prominent am Eingang platziert, zu großen Stapeln aufgehäuft. Aber auch in jedem Kiosk um die Ecke kann man sie finden, diese Hefte, die eine informative und unterhaltsame Reise in die Vergangenheit versprechen. Der Markt für Geschichtsmagazine scheint so gut bestellt zu sein, dass sich schon seit einigen Jahren gleich mehrere von ihnen Konkurrenz machen können.
Neben den Zeitschriften „Damals“ (verkaufte Exemplare 22.779) und „G/Geschichte“ (27.719), die dieses Geschäft schon seit Längerem betreiben und, ebenso wie „P.M. History“ (45.893), auf eine Heftgestaltung gemischten Inhalts setzen, sind es vor allem die großen Verlage, die dieses Segment für sich in Anspruch nehmen. Am prominentesten ist wohl „Geo Epoche“ aus dem Haus Gruner + Jahr (109.320), ein Magazin, das von sich behauptet, die Nummer 1 unter den populären historischen Zeitschriften zu sein. Aber auch „Der Spiegel“ (84.019) und „Die Zeit“ warten seit einiger Zeit mit eigenen Geschichtsmagazinen auf (Alle Verkaufszahlen laut IVW 3. Quartal 2013).
Aus wissenschaftlicher Perspektive sind Geschichtsmagazine durch eine unübersehbare Ambivalenz geprägt. Einerseits kann man sich nur freuen über die Aufmerksamkeit, die historische Themen in der Öffentlichkeit genießen. Vergleichbare populäre Zeitschriften zur Linguistik, Literaturwissenschaft oder Soziologie gibt es nicht. Andererseits wird gerade diese Popularität zuweilen mit dem Verlust wissenschaftlicher Seriosität und Komplexität erkauft.
Aber mir soll es hier nicht um die schon x-fach erörterten Spannungen zwischen wissenschaftlichen Ansprüchen und ihrer Aufbereitung für ein größeres Publikum gehen. Denn gegen solche Formen der Popularisierung zu polemisieren, halte ich offen gestanden für ein Luxusproblem – besser eine komplexitätsreduzierte Übersetzung als gar keine Wahrnehmung. Nein, was ich am Phänomen ‚Geschichtsmagazin‘ viel interessanter finde, ist die aktuelle Geschichtskultur, die sich darin manifestiert. Wenn sich eine Gesellschaft derart für Vergangenes interessiert, dass sie nicht nur in Fernseh-, sondern auch in Heftformaten eifrig darauf zurückgreift – welche Form nimmt dieses Vergangene dann an? Denn Popularisierungen funktionieren üblicherweise über Kreuz: Eine bestimmte Nachfrage soll befriedigt werden, und zwar so, dass sie sich nicht zuletzt auch wirtschaftlich rechnet. Zugleich besteht (zumindest theoretisch) die Möglichkeit, neue Angebote zu machen und Bedürfnisse zu wecken, die bisher möglicherweise noch gar nicht formuliert werden konnten.
Bildlichkeit vs. Genauigkeit?
Die Inhalte der Geschichtsmagazine lassen sich – kaum überraschend – nicht über einen Kamm scheren. Bei den Artikeln ist so ziemlich alles dabei, was man in textlichen Gemischtwarenläden erwarten darf. Vom eher unbeholfenen Artikel des bemühten Volontärs über die schmissig-journalistische Reportage bis zur nüchternen Auseinandersetzung der universitär bestallten Historikerin findet man Erfreuliches und weniger Erbauliches.
Eines ist aber unbedingte Voraussetzung: Die Themen müssen bildfähig sein. Ohne Bebilderung geht gar nichts. Man müsste es noch genauer nachrechnen (was ich nicht getan habe), aber nach meiner Schätzung wird etwa die Hälfte eines Heftumfangs durch Abbildungen eingenommen. Und durch Karten. Insbesondere „Geo Epoche“ nutzt Karten (zusätzlich zu sehr vielen Bildern) ausgiebig, um deutlich zu machen, dass Geschichte nicht nur in der Zeit und im Text, sondern auch im Raum und im Bild stattfindet. Damit haben Geschichtsmagazine eine Möglichkeit, die vielen historischen Büchern aus Kostengründen fehlen, wenn sie so ausgiebig auf Abbildungen zurückzugreifen. Dafür liegen die Preise dann aber auch schon auf dem Niveau von schmalen Büchern. Zuweilen führt diese Visualisierungspraxis zu zweifelhaften Auswüchsen, so wenn Historiengemälde aus dem 19. Jahrhunderts zur Illustration mittelalterlicher Verhältnisse herangezogen werden oder wenn im Heft über den Amerikanischen Bürgerkrieg von „Geo Epoche“ Fotografien digital koloriert wurden, „um ihre Anschaulichkeit zu verstärken“ [1]. Geschichtstuning für Fortgeschrittene.
Es wäre interessant, eine Redaktionssitzung zur Erstellung eines solchen Heftes belauschen zu können, um zu erfahren, nach welchen Gesichtspunkten die einzelnen Beiträge ausgesucht werden. Man kann aber auch ohne entsprechende Abhörprotokolle von den abgedruckten Artikeln auf die übergeordneten Prinzipien schließen: Zunächst geht es um Überblickswissen, das den Rahmen bereiten soll für die Schilderung bestimmter Ereignisse, für Menschlich-Biographisches und für Aspekte des Alltagslebens, die einen wesentlichen Teil des Inhalts ausmachen. Nicht minder interessant sind aber die Themenbereiche, die nur am Rande vorkommen oder auch ganz ausgelassen werden: Es sind all diejenigen, die wenig Anschauliches zu bieten haben, die strukturelle Grundlagen in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder Kultur betreffen. Befürchtet man hier möglicherweise Langeweile in der Geschichtsunterhaltung – obwohl es gerade hier in einem doppelten Sinn ‚grundlegend‘ werden könnte?
Nicht selten scheinen sich die Artikel aus der ‚Übersetzung‘ wissenschaftlicher Forschung (und dickleibiger Bücher) in Artikelform zu speisen. Insofern liegt hier ein prototypischer (und überhaupt nicht abwertend gemeinter) Fall von Popularisierung wissenschaftlichen Wissens vor. Zweifelsfalten kriechen allerdings auf die Denkerstirn, wenn im Kleingedruckten darauf verwiesen wird, begriffliche Unterschiede nicht ganz so genau zu nehmen. Da wird dann beispielsweise aus Gründen der sprachlichen Varianz die Sklaverei mit Leibeigenschaft, Knechtschaft und Unfreiheit in einen begrifflichen Topf geschmissen. Das ist keine Popularisierung mehr, sondern ziemlich grobe Ungenauigkeit [2].
Distanz als Differenz!
Treten wir aber einen Schritt zurück, sehen von den konkreten Heftinhalten ab und betrachten das größere Themenspektrum. Dann fällt auf, dass Bewährtes aufbereitet, etablierte Themen besetzt und das ohnehin bereits – zumindest ungefähr – Bekannte abgehandelt wird. Klassische Themen, die auch schon den schulischen Geschichtsunterricht prägten, werden vielfach wieder aufgegriffen: das antike Rom, Napoleon, der Nationalsozialismus, die Kreuzritter oder der Erste Weltkrieg – Länder, Menschen, Abenteuer. Man weiß also immer, was man bekommt, Überraschungen bleiben die Ausnahme. Damit bleibt aber leider auch die Möglichkeit ungenutzt, die ausgetretenen Pfade zumindest ein wenig zu verlassen, Vergangenes nicht immer schon von vornherein zu reduzieren auf große Persönlichkeiten, große Ereignisse oder große Reiche. Vielleicht ginge es auch einmal anders. Warum lassen sich denn nicht einmal Themenhefte entwerfen, die vermeintlich Abseitiges, Schräges, Unbeachtetes behandeln? Warum nicht etwas über die Geschichte des Schattens, des Spaziergangs oder der Börsenspekulation? Warum nicht eine genauere Betrachtung der Alpenfurcht und -begeisterung, familiärer Hierarchien oder der Sprache der Diplomatie? Etwa weil die Popularisierung immer nur so weit getrieben werden darf, wie das Zielpublikum bereits vorangeschritten ist? Sicherlich geben bei kommerziellen Unternehmen wie Geschichtsmagazinen die Auflagen den Ton an, weshalb sich immer das am besten verkauft, was ohnehin schon bekannt ist. Aber vielleicht gibt es ja thematische Nachfragen, von denen noch niemand etwas wusste, die gerade deswegen geweckt werden könnten, weil sie eben nicht das immer schon Bekannte aufwärmen?
Ich gebe zu, das ist recht idealistisch gedacht – wahrscheinlich zu idealistisch. Begnügt man sich bis zur Änderung dieses Zustands mit der regelmäßig dargebotenen Hausmannskost, so zeigen die Geschichtsmagazine eine dominierende Vorstellung von der Vergangenheit an, die zwar kein eindimensionales, aber doch recht übersichtliches Set an Funktionen aufweist: Erstens findet sich ein affirmatives Geschichtsbild, das auf Identifizierung, wenn nicht gar auf Identitätsbildung setzt. Hierzu dienen Klassikerthemen wie die Geschichte der jungen Bundesrepublik, noch eher aber biographische Zugänge – Stichwort: Vorbilder. Zweitens findet sich ein historischer Exotismus, der das Fremdartige hervorhebt. Das Mittelalter bietet sich hierfür schon seit Längerem als ideale Spielwiese an, denn hier kann man vermeintlich ohne Hemmungen allen Phantasien von sex’n’crime’n’powerplay frönen. Die dritte Variante ist gewissermaßen die negative Umkehrung der ersten, insofern sie auf Betroffenheit setzt und damit zu einer Identifizierung ex negativo anleiten möchte. Paradethema ist natürlich der Nationalsozialismus, aber alle Formen kriegerischer Auseinandersetzung, gesellschaftlicher Unterdrückung oder ethnischer Verfolgung können dazu herhalten.
Gegen solche Formen der Historisierung ist per se nichts zu sagen. Sie versäumen aber eine wichtige, wenn nicht sogar die wesentliche Qualität historischer Beschäftigung: Sie nutzen die zeitliche Distanz gerade nicht dazu, um Differenz zu thematisieren, um Selbstkritik zu üben und die Grundlagen gegenwärtiger Verhältnisse zu analysieren. Ein Geschichtsmagazin, das eben diese Möglichkeiten nutzt, würde ich gerne einmal lesen wollen – nur um es wohl nach der ersten Nummer wieder eingehen zu sehen.
[1] Geo Epoche, Nr. 60 (2013): Der Amerikanische Bürgerkrieg, S. 13.
[2] Geo Epoche, Nr. 60 (2013): Der Amerikanische Bürgerkrieg, S. 5.
Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtsmedien Tagged: Bild, Geschichtsmagazin, Popularisierung, Visualisierung
Quelle: http://achimlandwehr.wordpress.com/2013/12/30/17-magazinierte-geschichte/
Die Ferchl-Sammlung zur Geschichte der Lithographie – zu einer vergessenen Sammlung des 19. Jahrhunderts
Vorbemerkung
Die Lithographie war im 19. Jahrhundert eines der am häufigsten verwendeten Verfahren für farbige Drucke. Die Geschichte der Lithographie hat auch eine starke bayerische Komponente. Sie wurde in München durch Alois Senefelder (1771-1834) erfunden und wurde intensiv durch die bayerische Vermessungsverwaltung verwendet. Noch heute verwahrt das nunmehrige Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in München in seinem Steinkeller mehr als 26.000 Steinplatten mit Kartenblättern (Flurkarte, topographischer Atlas). Verwendet wurde für die Steine vielfach der ebenfalls der aus Bayern stammende Solnhofer Plattenkalk.
Eher durch Zufall kam der Verfasser dieses Beitrags zu diesem Thema. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Mitarbeiter des Bavarica-Referenten der Bayerischen Staatsbibliothek erreichte ihn im August 2013 eine Nutzeranfrage zur Geschichte einer lithographiegeschichtlichen Sammlung des Franz Maria Ferchl, die sich zeitweise vollständig in der königlichen Hof- und Staatsbibliothek in München befand; ein Aspekt der Bestandsgeschichte der Bayerischen Staatsbibliothek, der bisher weitgehend unbekannt war.[1]
Der Beitrag bietet eine Zusammenfassung des derzeitigen Standes der Recherchen zur Geschichte der Sammlung.
Die Person Ferchl
Franz Maria Ferchl (1792-1862)[2] war ein Münchner Privatgelehrter und Sammler, der mit Senefelder und seiner Familie befreundet war. Die Freundschaft ergab sich daraus, dass bereits Ferchls Vater Anton, Hoforganist und Klavierlehrer, Senefelder und seinen Kinder Musikunterricht erteilt hatte. Anton Ferchl begann mit der Sammlung von Zeugnissen zur Geschichte der Lithographie, die sein Sohn fortsetzte.
Franz Maria Ferchls historisches Interesse beschränkte sich nicht nur auf die Geschichte der Lithographie. Er war in vielen Bereichen – v. a. auch der Numismatik – tätig, u. a. auch im Umfeld des Historischen Vereins von Oberbayern, dessen Gründungsmitglied er 1837 war und in dessen Vereinszeitschrift („Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte“) er mehrfach publizierte.
Ferchl sammelte systematisch Objekte zu Senefelder und zur Entwicklung der Lithographie und baute somit eine umfassende Sammlung früher lithographischer Drucke auf („Inkunabeln der Lithographie“). Zu dieser Sammlung gehörten außerdem der Schädel und der rechte Arm Senefelders, die 1846 mit Erlaubnis der Nachkommen exhumiert wurden.
Außerdem verfasste er handschriftliche „Annalen der Lithographie“, die das Schaffen Senefelders minutiös dokumentierten. Deren Drucklegung – 1857 stand diese angeblich unmittelbar bevor[3] – kam nicht zustande.
Ferchl versuchte vehement, den Ruhm Senefelders zu sichern, was immer wieder zu Auseinandersetzungen führte.[4] Hyacinth Holland, der Verfasser des ADB-Artikels über Ferchl, bezeichnet ihn kritisch als einen „in seinem Privatleben nicht anziehenden Mann“.[5]
Schicksal seiner Sammlung
Erstmalig wurde der Ankauf der Ferchlschen Sammlung durch den Staat 1847 diskutiert, als Ferchl versuchte, für das Inventar der Sammlung („Inkunabeln der Lithographie“) einen Druckkostenzuschuss zu erhalten. Die Akademie der Wissenschaften, die ein entsprechendes Gutachten erstellt, befürwortete darüber hinaus den Erwerb der Sammlung durch die königliche Hof- und Staatsbibliothek. Die Bibliothek verwies in ihrer Antwort vom 23. September 1847 indes darauf, dass ihr sogar die nötigen Mittel zum Druck des Handschriften Katalogs fehlten.[6]
In der Folgezeit kam es zu einer längeren, wohl dem Kaufpreis geschuldeten Diskussion über den Verkauf der Sammlung an den Staat. 1856 veröffentlichte Ferchl das genannte Inventar endlich im Druck,[7] zeitgleich begann die Zerschlagung seiner Sammlung in drei Teile zerteilt, die unterschiedliche Schicksale erlitten:[8]
- Die 1857 vom Staat an gekauften „Inkunabeln der Lithographie“ sowie weitere Realien zur Lithographie-Geschichte, z. B. den 1846 exhumierten Schädel und Armknochen Senefelders, die Totenmaske, eine Büste sowie seine erste Steindruckpresse und seine Handpresse.[9]
- Die vor 1857 an Fidelis Butsch verkauften Dubletten der „Inkunabeln“, die 1865 an Heinrich Brockhaus weiter veräußert wurden.
- Die zunächst in Familienbesitz verbliebenen „Annalen der Lithographie“
1. Der in Staatsbesitz gelangte Teil der Sammlung
Der 1857 vom Königreich Bayern für 3.000 fl erworbene Teil der Sammlung umfasste nach Carl Wagner frühe lithographische Drucke (gebundene und Einzelblätter), die Druckerpressen, die Totenmaske sowie den Schädel und den rechten Arm Senefelders.[10] Die Übergabe an die Akademie der Wissenschaften und das Generalkonservatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates erfolgte am 23. Mai 1857.[11] Mit Schreiben vom 30. Mai 1857 folgte das zuständige Staatsministerium des für Kirchen- und Schulangelegenheiten einem Antrag des Generalkonservatoriums und überwies die vollständige Sammlung an die Königliche Hof- und Staatsbibliothek mit der Auflage, diese dort in einem eigenen Zimmer aufzustellen. Die Sammlung sollte dabei im Eigentum des Generalkonservatoriums verbleiben.[12] Die Überführung in die Bibliothek erfolgte am 9. Juni 1857.[13] Die Sammlung blieb auch in den Folgejahren in einem eigenen Zimmer.[14]
In der Ausstellung zum hundertjährigen Jubiläum der Lithographie, die 1895 in Paris stattfand, wurden einige frühe Lithographien aus der Ferchl-Sammlung ausgestellt.[15] Dort erregten die Stücke „allgemeine Bewunderung“.[16]
Ein Artikel in der Allgemeinen Zeitung am 6. Februar 1898 zeigt, dass sich damals die Sammlung noch in der Hof- und Staatsbibliothek befand, aber nur unzureichend präsentiert wurde. Der anonyme Autor brachte für eine Neuaufstellung der Sammlung das bisherige Nationalmuseum ins Spiel, für das nach dem Neubau eine neue Nutzung gesucht wurde. Ebenso wollte er dort die Maillinger-Sammlung untergebracht sehen. Als prädestiniert für die Übernahme der Ferchl-Sammlung sah er das Kupferstichkabinett an, doch fehle diesem an Platz. Die Unterbringung an der Hof- und Staatsbibliothek war für ihn unbefriedigend, da ein eigner Raum mangle und vor allem die Sammlung mit den Aufgaben der Bibliothek nicht in Zusammenhang stünde.[17]
Um 1905 wurde die Sammlung, die bis dahin in der Hof- und Staatsbibliothek geschlossen verblieben war,[18] auf verschiedene Einrichtungen verteilt:
a) Die Totenmaske Senefelders und die Druckergeräte wurden 1905 dem zwei Jahre zuvor gegründeten Deutschen Museum übergeben.[19] Dort befinden sie sich immer noch. Das Deutsche Museum besitzt die Stangenpresse, die Handpresse sowie das Konvolut Werkzeuge und Farben Senefelders bis heute.[20] Auch die Totenmaske befindet sich noch dort.[21]
b) Schädel und rechter Arm kamen laut Wagner an die anatomische Sammlung des histologischen-embryologischen Instituts in München[22] bzw. die „Königliche Anatomie“[23]. Bei dieser Einrichtung handelt es sich um die heutige “Anatomische Anstalt” der Ludwig-Maximilians-Universität München, die auch um eine Anatomische Sammlung verfügt.[24] Hans-Jürgen Imiela berichtete 1993, dass Schädel und Arm 1944 bei den Bombenangriffen auf München verbrannt seien. Er beruft sich dabei auf eine telefonische Auskunft der „Staatssammlung“, die mitgeteilt hätte, dass nur wenige Affenschädel und altbayerische Schädel des Mesolithikums den 2. Weltkrieg überstanden hätten.[25] Damit ist klar, dass er fälschlich bei der „Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie“ angefragt hat.[26] Die Anatomische Anstalt teilte am 11. September 2013 auf Anfrage mit, dass „niemandem bekannt [ist], dass dieser Schädel hier im Hause ist bzw. gewesen ist.“[27]
c) Im Sommer 1905 gab die Hof- und Staatsbibliothek die Einzelblätter der Sammlung an die Staatliche Graphische Sammlung – also das ehemalige, mittlerweile reorganisierte Kupferstichkabinett – ab, in der Hof- und Staatsbibliothek verblieben nur die gebundenen Werke.[28] Es handelte sich um 1500 Blätter, von denen zwei Drittel im Zweiten Weltkrieg verbrannten.[29] 400 Blätter wurden jedoch als Dubletten an die Bibliothek zurückgegeben.[30] In den 1960er Jahren wurden von der Staatsbibliothek ferner Mappenwerke mit losen Einblattdrucken an die Staatliche Graphische Sammlung abgeben.[31]
d) Die in der Hof- und Staatsbibliothek verbliebenen Drucke blieben nicht als geschlossener Fonds erhalten, sondern wurden auf verschiedene Fächer aufgeteilt:
- Ein Teil der Sammlung befindet sich im ca. 1903/05 durch Georg Leidinger angelegten Fach „Lithographa“. Die Entstehung dieses Fachs fällt dabei in eine Zeit, in der auch andere Spezialfächer (Einbandsammlung, Rariora, Exlibris) in der Handschriftenabteilung angelegt bzw. deutlich ausgebaut wurden.[32] Dieses Fach enthält aber nicht nur die Sammlung Ferchl, sondern auch andere seltene Lithographien. Im Repertorium sind Hinweise auf die Provenienz nicht durchgängig vorhanden.[33]
- Der zweite Teil der Sammlung wurde unter die Notendrucke („Musica practica“) eingereiht. Soweit aus den Unterlagen erkennbar, ist dies erst in den 1960er Jahren schrittweise zwischen Neuerwerbungen erfolgt. Über den Dienstkatalog lassen sich derzeit 55 Musikdrucke aus der Sammlung Ferchl nachweisen. Nachweise sind zwar auch im OPAC zu finden, sie sind allerdings nicht recherchierbar.[34]
2. Sammlung Brockhaus
Dubletten der „Inkunabel der Lithographie“ erwarb bereits vor 1857 der Augsburger Antiquar und Sammler Fidelis Butsch (1805-1879).[35] Dieser verkaufte sie seinerseits 1865 an den Leipziger Verleger Heinrich Brockhaus.[36] Die Sammlung Brockhaus ist seit dem 2. Weltkrieg verschollen. Möglicherweise befindet sie sich im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der DNB in Leipzig.[37]
3. “Annalen der Lithographie”
Die minutiösen Aufzeichnungen über die Geschichte der Lithographie und das Werk Senefelders verblieben im Besitz der Familie Senefelder. Die Enkelin verkauft dieses Werk an den Sammler Dogerloh, der es an jüdischen Sammler Julius Aufseeßer weiterveräußerte. [38] Das weitere Schicksal der Annalen war bisher nicht bekannt, sie galten als verschollen.[39] Tatsächlich wurde die „Annalen“ noch vor 1918 durch das Königliche Kupferstichkabinett in Berlin angekauft, wo sie als Ms 360 verwahrt werden. Eher durch Zufall wurde dort die Handschrift, die den Titel „Alois Senefelder. Leben und Wirken“ trägt, durch Jürgen Zeidler entdeckt, der ihre Bedeutung erkannte und sie als das verschollene Ferchlsche Werk identifizierte. Zu diesem Werk gehörige Beilagen fehlen indes, sie wurden getrennt versteigert. Eine Edition des Werks wird derzeit von Jürgen Zeidler vorbereitet.[40]
[1] Z. B. nicht erwähnt bei Rupert Hacker, Bestandsgeschichte der Bayerischen Staatsbibliothek, in: Ders. (Hg), Beiträge zur Geschichte der Bayerischen Staatsbibliothek, München 2000, 377-397.
[2] Franz Maria Ferchl. Nekrolog, in: Allgemeine Zeitung 1862, S. 4386-4388 (= Beilage zu Nr. 265, 22. September 1862), online: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10504441-0; Holland, Hyacinth, „Ferchl, Franz Maria“, in: Allgemeine Deutsche Biographie (1877), S. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd116465433.html?anchor=adb.
[3] Die Ferchl’sche Inkunabel-Sammlung der Lithographie, in: Allgemeine Zeitung 1857, Beilage zu Nr. 173, 22. Juni 1857, S. 2763-2764 (URL: URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10504408-6) „Mit dem Sammeln der Druckproben und ersten ausgeführten Blätter gieng aber die Aufschreibung eigener und fremder Beobachtungen ununterbrochen Hand in Hand, und so entstanden daraus so vollständige gleichzeitige Annalen historischen, technischen und biographischen Inhalts, wie deren sich keine andere derartige Erfindung rühmen kann. Dieselben sind so weit vorbereitet, daß man ihrer baldigen Veröffentlichung entgegensehen darf.“
[4] Nagler, Georg K., Alois Senefelder und der geistliche Rath Simon Schmid als Rivalen in der Geschichte der Erfindung des mechanischen Steindruckes …, München 1862, online: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10376918-9. Bezeichnend ist der ausführliche Untertitel „Abwehr der Behauptungen und masslosen Angriffe in F. M. Ferchl’s Geschichte der ersten lithographischen Kunstanstalt in München“.
[5] Holland, „Ferchl, Franz Maria“ (wie Anm. 2).
[6] Bayerische Staatsbibliothek, Alt. Reg. B V, Ferchl. – Vgl. auch: Paul Ruf, Schmeller als Bibliothekar, in: Rupert Hacker (Hg.), Beiträge zur Geschichte der Bayerischen Staatsbibliothek (Schriftenreihe der Bayerischen Staatsbibliothek 1), München 2000, S. 177-252, hier 226.
[7] Ferchl, Franz Maria, Uebersicht der einzig bestehenden, vollständigen Incunabeln-Sammlung der Lithographie und der übrigen Senefelder’schen Erfindungen …, München 1856, URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10385634-6
[8] Wagner, Carl, Alois Senefelder, sein Leben und Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte der Lithographie, Leipzig 1914, S. 171-173.
[9] Bayerische Staatsbibliothek Alt. Reg. B V, Ferchl, Übergabeprotokoll vom 23. Mai 1857.
[10] Wagner, Alois Senefelder, S. 173, Anm. 1.
[11] Bayerische Staatsbibliothek Alt. Reg. B V, Ferchl, Übergabeprotokoll vom 23. Mai 1857. Vgl. Die Ferchl’sche Inkunabel-Sammlung der Lithographie, in: Allgemeine Zeitung 1857, Beilage zu Nr. 173, 22. Juni 1857, S. 2763-2764 (URL: URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10504408-6) mit dem Bericht über die Übergabe der Sammlung an die Akademie der Wissenschaften und der ihr zugeordneten Sammlungen (dort die Übergabe irrig auf den 23. April datiert). „Die Sammlung, das Resultat eines mehr als fünfzigjährigen liebevollen und glücklichen Sammlerfleißes, ist, nach Umfang und Werth der Drucke die in ihr enthalten sind, sehr bedeutend. Sie umfaßt gegen dreitausend verschiedene Blätter, die sehr häufig, da viele erste Probedrücke von neuer Behandlungsart darunter sind, gerade durch ihre künstlerische Unvollendung wie durch ihre außerordentliche Seltenheit für uns Bedeutung haben. Sie gewährt eine vollständige Uebersicht über Ursprung und Verlauf dieser merkwürdigen Erfindung, und reicht mit ihren frühesten Anfängen bis zu den ersten mechanischen Druckversuchen Senefelders im Jahr 1796 und den seine Erfindung vollendenden Proben der chemischen Druckkunst aus dem Jahr 1798 zurück. Ihr Hauptvorzug vor allen ähnlichen Sammlungen ergibt sich aus der erwähnten Art ihres Entstehens; sie ist keine erst nachträglich und daher lückenhaft angelegte, sondern der Erfindung und ihrer allmählichen Entwickelung gleichzeitige. Mit dem Sammeln der Druckproben und ersten ausgeführten Blätter gieng aber die Aufschreibung eigener und fremder Beobachtungen ununterbrochen Hand in Hand, und so entstanden daraus so vollständige gleichzeitige Annalen historischen, technischen und biographischen Inhalts, wie deren sich keine andere derartige Erfindung rühmen kann. Dieselben sind so weit vorbereitet, daß man ihrer baldigen Veröffentlichung entgegensehen darf.“
Vgl. Donau-Zeitung, 1860 Nr. 11, 11. Januar 1860, S. 1-2 [von Ferchl verfasste Meldung über den Schädel Senefelders]: „Dieser merkwürdige Schädel des unsterblichen Erfinders befindet sich in der reichen und einzig bestehenden kompleten Inkunabeln-Sammlung der Lithographie und der übrigen Senefelder’schen Erfindungen, welche Se. Maiestät der König vor ca. 3 Jahren von dem unterzeichneten Sammler derselben für die wissenschaftlichen Sammlungen des Staates käuflich erworben hat.”
[12] Bayerische Staatsbibliothek, Alt. Reg. B 245.
[13] Bayerische Staatsbibliothek, Alt. Reg. B 245.
[14] Bayerische Staatsbibliothek, Alt. Reg. B 245 (Schriftwechsel von 1863/64 wegen einer Schenkung an die Sammlung mit Erwähnung des Zimmers. Es ging dabei um die Fahne des Vereins der Lithographie-Besitzer). Vgl. Franz Maria Ferchl. Nekrolog (wie Anm. 2), S. 4387: „In dieser jetzt mit der königlichen Hof- und Staatsbibliothek verbundenen Sammlung“.
[15] Centenaire de la Lithographie. Catalogue officiel de l’exposition. 1795-1895, Paris 1895, 117-122. Vermerkt als „Coll. de la Bibliothèque royale de Munich“.
[16] Allgemeine Zeitung, 6. Februar 1898, Ausschnitt in Bayerische Staatsbibliothek, Nachlass Hyazinth Holland unter Ferchl, Franz Maria.
[17] Allgemeine Zeitung, 6. Februar 1898, Ausschnitt in Bayerische Staatsbibliothek, Nachlass Hyazinth Holland unter Ferchl, Franz Maria. Diese Sammlung, „ein wahrhaftiges Dornröschen“ wurde – so der Autor – nach dem Erwerb durch die Akademie der Wissenschaften „wohl aus ganz äußerlichen Gründen, der Staatsbibliothek überwiesen; doch konnte es sich nur um eine Verwahrung handeln, da sie ja mit den Aufgaben derselben keinen Zusammenhang hatten. Der Platz für ihre Aufstellung mangelte. … Eine Uebertragung in das Kupferstichkabinet, das den meisten Anspruch hätte, kann nicht in Frage kommen, denn es leidet ja selbst an betrübenden Platzmangel.“
[18] Winfried Glocker, Drucktechnik. Ein Begleitbuch zur Ausstellung im Deutschen Museum, München 2007, 136/141: „1905 wurden diese bis dahin in der Bayerischen Staatsbibliothek aufbewahrten Originale …“
[19] Wagner, Alois Senefelder, S. 173, Anm. 1.; Glocker, Drucktechnik, 136/141.
[20] http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-i/stangenpresse/ (28.8.2013).
[21] Glocker, Winfrid, „Senefelder, Johannes Nepomuk Franz Alois“, in: Neue Deutsche Biographie 24 (2010), S. 251-252 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118613219.html.
[22] Wagner, Alois Senefelder, S. 172.
[23] Jahrbuch für das Lithographische Gewerbe 1909, S. 30.
[24] http://www.anatomie.med.uni-muenchen.de/index.html (28.8.2013).
[25] Hans-Jürgen Imiela, Geschichte der Druckverfahren. Band 4: Stein- und Offsetdruck (Bibliothek des Buchwesens 10), Stuttgart 1993, S. 36.
[26] http://www.sapm.mwn.de/ (28.8.2013)
[27] Mail des Sekretariats Professor Dr. Jens Waschke, Anatomische Anstalt, vom 11. September 2013 an Florian Sepp.
[28] So beschrieben von Wagner, Alois Senefelder, S. 173 Anm. 1. Vgl. Pallmann, Heinrich, Die Königl. Graphische Sammlung zu München 1758 – 1908, München 1908, S. 51-52. Das frühere Kupferstichkabinett hatte 1901 einen neuen Ausstellungssaal erhalten hatte und 1904/05 war reorganisiert und umbenannt worden.
[29] Künstler zeichnen. Sammler stiften. 250 Jahre Staatliche Graphische Sammlung München. Band 1, München 2008, S. 257.
[30] Bayerische Staatsbibliothek, Alt. Reg. B V, Ferchl (Schreiben der Graphischen Sammlung an die Hof- und Staatsbibliothek vom 22. September 1905)
[31] Mail von Dr. Claudia Bubenik, Bayerische Staatsbibliothek, vom 27.8.2013.
[32] Karl Dachs, Eine ” Reserve seltener Drucke” für die Bayerische Staatsbibliothek, in: Bibliotheksforum Bayern 4 (1976) S. 175-190, hier S. 181.
[33] Mail von Dr. Claudia Bubenik, 27.8.2013.
[34] Mail von Dr. Sabine Kurth, 27.8.2013
[35] Ferchl, Uebersicht, S. 22: „Auch Hr. Antiquar Butsch in Augsburg ist im Besitz von vielen ältesten Lithographien, welche derselbe als Doubletten aus der F.’schen Hauptsammlung schon vor mehreren Jahren erworben hat.“
[36] Wagner, Alois Senefelder, S. 172-173.
[37] Ein maschinenschriftliches Inventar der Ferchl-Butsch-Sammlung befindet sich in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig in der Fachbibliothek des Museums; gefertigt wurde es von Carl Wagner: http://d-nb.info/994349297
[38] Wagner, Alois Senefelder, S. 173 Anm 1.
[39] Archiv für die Geschichte des Buchwesens 8 (1967), S. 90. Genauso die Angabe unter http://www.nachlassdatenbank.de/; der dort unter Franz Maria Ferchl verzeichnete Teilnachlass im Stadtarchiv München stammt von tatsächlich vom Offizier und Archivar des Militär-Max-Josephs-Ordens Georg Ferchl (1846-1923), der als Sohn des Försters Franz Anton Ferchl in Ruhpolding geboren wurde. Eine Verwandtschaft zu Franz Maria Ferchl ist nicht nachweisbar (Freundliche Hinweise von Dr. Manfred Heimers, Stadtarchiv München, Mail vom 2. September 2013).
[40] Freundliche Mitteilung von Jürgen Zeidler am 12. November 2013 bei einem Treffen in München.
Neuzugänge zur FWF-E-Book-Library
Burger, Hannelore: Heimatrecht und Staatsbürgerschaft österreichischer Juden. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2014.
http://e-book.fwf.ac.at/o:440
Kramer, Anke/Pelz, Annegret (Hg.): Album. Organisationsform narrativer Kohärenz. Göttingen: Wallstein, 2013.
http://e-book.fwf.ac.at/o:340
Teich, Mikulá: Bier, Wissenschaft und Wirtschaft in Deutschland 1800-1914. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2000.
http://e-book.fwf.ac.at/o:267
Wien 1, 44
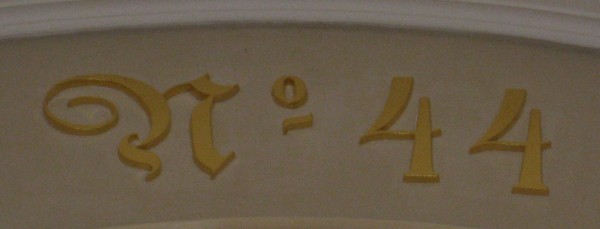
1010 Wien, Bankgasse 9: Das Liechtensteinsche Stadtpalais
Buchvorstellung – Römisches Mainz – Begleitpublikation zur Ausstellung „Im Dienst des Kaisers. Mainz – Stadt der römischen Legionen.“
Römisches Mainz, Mainz Vierteljahreshefte, Sonderausgabe Mai 2013
96 Seiten, 8,50 €, ISSN 0720-5945
Agentur & Verlag Bonewitz
Quelle: http://provinzialroemer.blogspot.com/2013/12/buchvorstellung-romisches-mainz.html
Schon heute an den Sommer denken: Sommeruniversität 2014 in Leipzig
Vom 21. Juli bis zum 02. August 2014 findet an der Universität Leipzig eine vom ESU DH “Kulturen & Technologien” und Clarin-D organisierte Sommeruniversität statt. Inhaltlich wird es vor allem um die Nutzung von Sprachressourcen in den digitalen Geisteswissenschaften gehen. Aufgrund der Förderung durch den DAAD und das Electronic Textual Culture Lab der University of Victoria können Stipendien für Graduierte, Promovierte und Alumni/Alumnae vergeben werden.
Nähere Informationen werden demnächst hier veröffentlicht.
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=2803