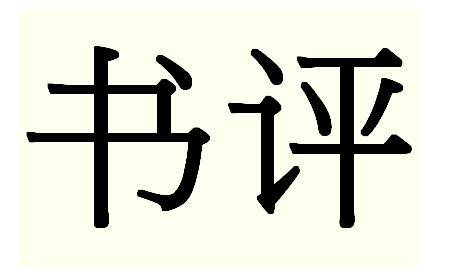New Science on the Blog? Internationale Herausforderungen für wissenschaftliche Blogs
Was passiert, wenn Wissenschaftler selbst zu Medienproduzenten werden? Müssen Wissenschaftskommunikatoren heute Community Manager sein, wenn es keine Zielgruppen mehr gibt, sondern sich alle in dialogischen Netzwerken bewegen? Welche Bedingungen brauchen wir, um die Potenziale der Sozialen Medien effektiv zu nutzen? Und welche Rolle spielt wissenschaftliches Bloggen weltweit?
Diese und andere Fragen werden Mareike König, Nadia von Maltzahn, Lars Fischer, Henning Krause und ich am 1. Dezember beim 8. Forum Wissenschaftskommunikation in Nürnberg diskutieren. Zum Einstieg in das Gespräch haben sich die Panelisten bereits “Küchenzurufe” überlegt:
Lars Fischer (Fischblog / SciLogs): “Gemeinsam ist allen Wissenschaftsblogs, dass sich ihre AutorInnen damit zur Wissenschaft positionieren: Zum Beispiel erklärend, teilnehmend oder beobachtend.
[...]
Für eine Kultur des Miteinanders in der Wissenschaft
In loser Folge publizieren wir bis zum Beginn von #RKB15 eine Serie von Statements der Redner und Diskutanten. Wir bieten Ihnen damit die Gelegenheit, sich schon einmal warmzudiskutieren – entweder im stillen Selbstgespräch oder hier in den Kommentaren.
von Mareike König
muss noch was schreiben für #rkb15 über “Wollen wir sie wirklich, die Kultur des Miteinanders?” Antwort: JA -reicht das @Konferenz_RKB15?
Quelle: http://rkb.hypotheses.org/1009
Granular-kollaborativ = kleinteilig-diffus? Oder kurz: Wie ich die Welt sehe. Ich bitte um Zweifel.
In loser Folge publizieren wir bis zum Beginn von #RKB15 eine Serie von Statements der Redner und Diskutanten. Wir bieten Ihnen damit die Gelegenheit, sich schon einmal warmzudiskutieren – entweder im stillen Selbstgespräch oder hier in den Kommentaren.

Abbildung: Wikimedia Commons | Paola peralta | CC BY-SA 3.0
von Oliver Čulo
Das RKB-Blog spricht bei der Ausschöpfung digitaler Möglichkeiten des Zusammenarbeitens von einer „granular-kollaborativen“ Arbeitsform (Eintrag vom 12. März 2015). Sicher, in meinem Forschungsgebiet, der Übersetzung, kommt diese Arbeitsform immer häufiger vor. Übersetzungen werden schon lange nicht mehr im stillen Kämmerlein von einer Person, bewaffnet mit Bleistift, Papier und einigen Wörterbüchern, erstellt.
[...]
Quelle: https://rkb.hypotheses.org/852
Reminiszenzen #dhiha6
Genau 24 Stunden, nachdem die #dhiha6-Konferenz begonnen hatte, wurde sie letzten Freitag um 18:00 Uhr offiziell beendet. Wer weiß, wie lange es danach noch mit Champagnerunterstützung weiterging, ich wäre gerne geblieben, hatte aber ein schönes Alternativprogramm vor mir (24 weitere Stunden Paris, von dem ich bis dahin nur die Rue Malher und das DHI gesehen hatte, welches beides allerdings allerliebst anzuschauen ist). Eigentlich dachte ich, dass sich jede|r zweite der Partizipant|inn|en umgehend an einen Blogpost zu den Ereignissen dieser Konferenz setzen würde, jetzt ist es aber doch mir vorbehalten, den ersten Rückblick zu schreiben (auf den hoffentlich weitere folgen, da ich lediglich meine hoffnungslos subjektiven und durch eine Woche Uni-Alltag gefilterten Eindrücke hier unterbringen kann).
Nobel Game
Kaum war ich in Paris angekommen, startete schon am Donnerstag Abend die Konferenz mit einem Vortrag zum “Social game behind science – The collective dynamics of science: Publish or perish, is that all?” von David Chavalarias, der an einer Einrichtung mit dem illustren Namen “INSTITUT DES SYSTÈMES COMPLEXES DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE” forscht. Obwohl David kurzfristig eingesprungen war für die eigentliche Referentin Julianne Nyhan (vom University College London), hätte ich mir keinen besseren Einstieg in die Konferenz vorstellen können.

[...]
Ein Anfang fast von Null für das DHI Moskau
Im Gespräch mit Michail Bojcov und Nikolaus Katzer
In der Nacht zum 31. Januar 2015 wurde das Deutsche Historische Institut (DHI) Moskau durch einen Großbrand schwer beschädigt. Es gab keine Personenschäden, große Teile des Gebäudes, in dem auch die Bibliothek für Gesellschaftswissenschaften der Russischen Akademie der Wissenschaften (INION) untergebracht war, wurden jedoch zerstört.
Wie ist die Situation des DHI Moskau vor Ort, welche Auswirkungen hat der Brand auf den laufenden Betrieb und die aktuellen Forschungsschwerpunkte des Instituts? Und wie sehen Ihre weiteren Planungen für das DHI aus?
[...]
Quelle: http://mws.hypotheses.org/27459
Sensation, Provokation, Illusion? Plädoyer gegen den Zeitschriftenvergleich
Vor Kurzem hatte die geisteswissenschaftliche Blogosphäre einen Grund, sich selbst zu feiern! Klaus Graf veröffentlichte am 10. Februar 2015 im Frühneuzeit-Blog der RWTH Aachen, einem Blog der hiesigen Plattform, seine Analyse eines Handschriftenfundes. Das wird deswegen als bemerkenswert betrachtet, weil der Fund in seiner Wichtigkeit – Sensation – für Forscher vom Fach nicht zu umgehen ist und weil er in seiner Wichtigkeit die Kommunikationsform adelt, in der die Analyse öffentlich gemacht wurde. Am 28. Februar 2015 kommt es mit leichten Überarbeitungen auf dem Mittelalter-Blog zu einer erneuten Publikation, die auch eine 43-seitige PDF-Version bereitstellt. Beide unter einer CC BY 3.0 DE-Lizenz, die vor allem zur Namensnennung verpflichtet.
Wie Mareike König im Redaktionsblog kommentiert, wird (inner-)wissenschaftliches Bloggen vor allem als Möglichkeit zur Diskussion von work in progress betrachtet. Das macht es der Print-Community leicht, wissenschaftliches Bloggen zu übersehen oder zu ignorieren. Deswegen wertet sie Grafs Blogeinträge sowohl als “Geschenk” für die Plattform hypotheses.org und das wissenschaftliche Bloggen allgemein, als auch als “Provokation” an die Print-Wissenschaft, weil dieser wichtige Fund bzw. seine Beschreibung und Analyse nicht in einer gedruckten Fachzeitschrift veröffentlicht wurde.
Natürlich entfacht sich in den anschließenden Kommentaren gleich eine Diskussion darüber, wie provokativ der Blogeintrag Klaus Grafs vor dem Hintergrund anderer Blogprojekte und ihrer Veröffentlichungen von wichtigen Funden und Erkenntnissen wirklich sei und ob er sich nicht vielmehr einreihe in eine – gerade für die Geschichtswissenschaft recht rege – Bloggingpraxis, die wesentliches zu disziplinären und gegenstandsbezogenen Diskursen beitrage.
König stellt im oben erwähnten Eintrag des Redaktionsblogs aber die Vorzüge des Publizierens im Blog heraus:
“Das Blog ermöglichte die schnelle Publikation, die frei zugänglich ist und keine Beschränkungen (Inhalt, Textlänge, Verlinkungen, Abbildungen) aufweist. Eine Zweitpublikation in einer Fachzeitschrift oder das Einstellen in einem Repositorium (Vorschlag Eric Steinhauer) kann auch später noch erfolgen, sofern überhaupt gewünscht. Denn das Frühneuzeit-Blog der RWTH ist bibliothekarisch gesehen eine vollwertige fortlaufende Publikation, sie besitzt eine eigene ISSN, die Inhalte werden von OpenEdition archiviert.”
Ein Blogeintrag steht also einer Zeitschriftenpublikation in nichts nach? Publikationsgeschwindigkeit, Open Access, Darstellungspotenzial, Archivierbarkeit, mit paginierter PDF sogar einfach zu zitieren… das alles spricht für sich selbst. Zumindest scheinbar. Im Diskussionsverlauf wird auch gleich der Vergleich zwischen Blogeinträgen und Peer-Review-Artikeln gezogen. Gewissermaßen das Zünglein an der Wage.
Mag die Stilisierung der betreffenden Publikationsformenwahl gerechtfertigt sein oder nicht; Einträge in Weblogs werden über kurz oder lang keine vollumfänglich gleichwertigen Veröffentlichungen darstellen, wie Beiträge in Zeitschriften oder Sammelbänden. Und es schiene mir auch absurd, sie in gleicher Weise “bei Berufungsverfahren [zu] berücksichtig[en]” (König, s.o). Wollte man das, müsste man sie wohl ihrer medialen Spezifik berauben, ihre Offenheit, Flexibilität und Heterogenität zähmen, indem man sie in die Publikations- und Organisationsinfrastrukturen des innerwissenschaftlichen Diskurses einfädelte. Was bliebe dann noch vom Bloggen übrig?
Ich frage mich auch, in wie weit die Wahl zum Blog als bevorzugten Publikationsort einer originären Arbeit dieses Gewichts nicht wesentlich auch deswegen möglich wurde, weil Klaus Graf nun mal ein schon gestandener Historiker ist. Hätte ein solcher wissenschaftlicher Artikel auch von einem Nachwuchswissenschaftler in einem vielleicht noch recht frischen Blog gepostet werden können und dabei dieselbe Aufmerksamkeit genossen und dasselbe Vertrauen gewonnen?
Viel plausibler scheint es mir da zu sein, dem in der Diskussion ebenfalls erwähnten Credo zu folgen: “Vergesst die wissenschaftliche Anerkennung von Blogs!” Wenn man versuchen wird, Blogs und ihre Einträge in die Anerkennungs-, Vergleichbarkeits- und Qualitätssicherungsmaschinerie der Wissenschaft einzufädeln, werden ihre spezifischen und noch nicht ausgeschöpften diskursiven Potenziale massiv verschoben, wenn nicht aufgehoben werden. Artikel wie der von Klaus Graf zeigen: Fertige Arbeiten werden anders kommentiert als work in progress.
Weblogs mit Zeitschriften zu vergleichen, erscheint mir immer unfruchtbarer, je länger ich an meiner Diss sitze und analysiere, wie ihr Potenzial ‘hier und da’ und auf welche Weise ausgenutzt wird. Weblogs mehr zu behandeln, als ‘wären’ sie Tagungen oder Workshops, scheint mir ihnen gerechter zu werden. Der SozBlog bspw. ist voller Versuche, eine solche Auffassung mal mehr, mal weniger explizit in die Tat umsetzen.
Wissenschaftliches Bloggen mit Monty Python / #wbhyp
Während meines Nebenfach-Studiums der Älteren Deutschen Philologie an der Uni Bayreuth1 habe ich ein Seminar über Monty Python besucht.2 Aus irgendeinem Grund erinnere ich mich in Bezug auf dieses Seminar besonders an den „Upper-Class Twit of The Year“ Sketch, der nicht das Geringste mit dem Mittelalter zu tun hat, also mit dem primären Gegenstand dieses Fachs. Dass sich (Geistes-)Wissenschaftler nicht nur mit auf den ersten Blick „wissenschaftlichen Themen“ beschäftigen müssen, zeigt das erwähnte Seminar. Auch Popkultur kann zum Untersuchungsgegenstand wissenschaftlicher Betrachtung werden. Ebenso können […]
Eristik des Konsens. Zur Spezifik chinesischer Rezensionen
“Wenn man eine Publikation bewertet, sollte man deshalb nicht nur an die Schwäche einer Arbeit denken, sondern vor allem an ihren zu schätzenden Wert.” (Liang 1991: 304)
Im Rahmen einer interessanten Analyse eines nachwuchswissenschaftlichen Blogeintrages habe ich einen kleinen Ausflug in linguistische Analysen wissenschaftlicher Rezensionen gemacht. Im Zug (Köln-Siegen) habe ich gerade den sprach-/kulturvergleichenden Aufsatz von Yong Liang (1991) gelesen, der deutsche und chinesische Rezensionen untersucht und spannende Spezifika der jeweiligen sprachlichen Bewertungsmuster anhand 8 deutscher und 8 chinesischer Texte herausarbeitet.
Den für mich interessantesten Punkt habe ich im obigen Zitat herausgestellt. In Liangs (1991) Untersuchung zeigt sich nämlich eine diametral entgegengesetzte Gewichtung positiver und negativer Bewertungshandlungen. Während nämlich die deutschsprachigen Rezensionen davon geprägt sind, dass kritische Auseinandersetzungen mit dem rezensierten Werk innerhalb der Besprechung einen gewichtigen Teil ausmachen und mit Bezugnahmen auf den Forschungsstand begründet werden, sind chinesische Rezensionen davon geprägt, das rezensierte Werk in seinen Leistungen zu würdigen. Daraufhin wird auch die Einordnung in den Forschungsstand funktionalisiert, die dazu dient, daran ‘das Neue und Wertvolle’ zu kennzeichnen und zu charakterisieren.
Auch in den abschließenden Resümees zeigte sich diese Gewichtungsasymmetrie. Während deutschsprachige Rezensionen vorwiegend abschließend positive Bewertungen vornehmen und diese sich pauschal und recht unbegründet auf das Gesamtwerk beziehen, nutzen chinesische Rezensenten das Resümee, um vereinzelte negative, zu kritisierende Aspekte anzusprechen, ohne diese oft allgemeinen Aspekte aber zu begründen.
“Im Chinesischen zeichnet sich die Stärke wissenschaftlichen Rezensierens vor allem dadurch aus, das Positive im Rahmen des Gültigen zu entdecken und hervorzuheben. Deshalb ist dort die Würdigung der Objektpublikation weitgehend dominant. Die Meinungsverschiedenheit spielt nur eine untergeordnete und stark eingeschränkte Rolle und kann nur dann repräsentiert werden, wenn die Harmonie dadurch nicht beeinträchtigt wird [...]. In deutschen Rezensionstexten spielt hingegen die Meinungsverschiedenheit eine dominierende Rolle.” (Liang 1991: 309)
Liang (1991: 304) begründet diese Spezifik chinesischer Rezensionen einerseits mit der traditionell auch alltäglich äußerst wichtigen “Höflichkeitsmaxime” und andererseits mit dem “Respekt vor der vertikalen akademischen Pyramide, also vor der Autorität”. So würden “kategorisch negative Bewertungen [...] das Ansehen des Rezensenten bei Fachkollegen [sogar] eher schwächen als stärken”.
Dies wirft interessante Fragen zur chinesischen Wissenschaftskultur auf. Während die europäische Wissenschaftstradition am Dissens interessiert ist, um sich der Wahrheit zu nähern, scheint das – wie Liangs (1991) Arbeit ahnen lässt – in der chinesischen Tradition ganz anders auszusehen und sich in den sprachlichen Verfahren der Erkenntnisdarstellung und -besprechung niederzuschlagen. Von dort aus ist es nicht weit, um zu ahnen, dass das auch die Erkenntnisproduktion betrifft. Ich stecke da zu wenig drin, um genaueres herauszustellen. Ich werde in nächster Zeit aber nach Überblickswerken ausschau halten, die mir die Zusammenhänge und (historischen) Hintergründe dieser Wissenschaftstradition durchsichtiger werden lassen. Für Hinweise bin ich immer offen!
Für einen zentralen Begriff meiner Dissertation, für den Begriff der Eristik nämlich, und für die Frage, wie dieser zu Konzeptualisieren ist, bin ich aber abermals in der Idee bestärkt, dass er nicht nur auf streitende, d.h. kritische Sprechhandlungen bezüglich der Geltung wissenschaftlichen Wissens beschränkt werden kann, sondern ebenso affirmative Bezugnahmen auf bestehendes Wissens umfassen muss. Es geht also nicht nur um die sprachliche Verhandlung von Dissens, sondern auch um die sprachliche Verhandlung von Konsens. Damit wird es dann möglich, ‘eristische Strukturen’ (Ehlich) nicht nur als Menge sprachlicher Mittel zu betrachten, sondern ihm einen wissenschaftsspezifischen Zweck zuzuordnen, der in der Modellierung einer forschenden Position im verfügbaren wissenschaftlichen Wissen bestünde. Liangs (1991) Arbeit zeigt eindrücklich, in welcher Weise dieser Zweck neuzeitlicher Wissenschaftskommunikation kulturvariant bearbeitet werden kann.
*
Liang, Yong (1991): Zu soziokulturellen und textstrukturellen Besonderheiten wissenschaftlicher Rezensionen. In: Deutsche Sprache 19, S. 289-311.
Wissenschaft. Und der Rest der Welt
Naturwissenschaft – so scheint der Konsens in Deutschland zu lauten – ist gleichzusetzen mit “Wissenschaft”. Die im Englischen übliche Differenzierung von Science und Humanities scheint also vollständig in die deutsche Sprache und Wissenschaftskultur eingesickert zu sein.
In den vergangenen drei Tagen besuchte ich die Summerschool “Wissenschaft kommunizieren” im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Um es kurz zu machen: Als Geisteswissenschaftlerin fühlte ich mich dort völlig deplatziert — aber warum?
Im Nachhinein – man ist zu diesem Zeitpunkt gemeinhin schlauer! – bin ich ziemlich blauäugig an die ganze Sache herangegangen. Ich bin Wissenschaftlerin mit hoher Web 2.0-Affinität, ich befasse mich gerne und oft mit Sprache, Kommunikation fand ich schon immer super und ich habe in der Vergangenheit schon einige PR-Projekte erfolgreich umgesetzt. Dies waren meine Kriterien, den Claim “Wissenschaft kommunizieren” als direkt als auf meine Person maßgeschneidertes Angebot wahrzunehmen.
Diese Annahme wurde eigentlich sofort enttäuscht und es liegt weder primär an den ReferentInnen, noch an den OrganisatorInnen und nicht einmal an den TeilnehmerInnen. Nein. Es handelt sich, wie ich denke, um ein strukturelles Problem. Die Naturwissenschaften mit ihrem nachgeordneten unmittelbaren Nutzen für verschiedene Industriezweige, angefangen von der Pharmazie bis hin zur Weltraumtechnik, die bekanntlich auch Innovationen wie Thermos-Kannen und Klettverschlüsse ins tägliche Leben bringt: sie alle bewegen mehr Kapital. Es fließen höhere Fördersummen, weil ein Output erwartet wird, der sich langfristig quantifizierbar im Bruttosozialprodukt niederschlägt. Die Politik hat hieran ein höheres Interesse und fördert “Wissenschaftskommunikation”, wie man an den Geldgebern und Kooperationspartnern des Veranstalters , wissenschaft-im-dialog ersehen kann. Nicht zuletzt fand die Veranstaltung an einem Technologiestandort statt.
Schon, wenn ich das schreibe, komme ich mir wie ein lebendes Fossil vor. Welche Relevanz hat das, was ich tue für die Welt? Wenig bis gar keine?
Dabei wird es komplizierter: Mit meinem Weggang von Österreich bin ich nun von der Kunstgeschichte in den Fachbereich “Kunstwissenschaften und Medientheorie” gewechselt. Kunstwissenschaft lässt sich nicht ins Englische übertragen: “Science of Art” oder “Art Science” sind undenkbare Sprachkonstrukte. Einer der Pioniere, welche die Kunstgeschichte aus der Historiographie heraus näher heran an die empirisch operierenden Fächer rücken wollten, war aber Hans Sedlmayr. Sedlmayr favorisierte einen datenbasierten ahistorischen Zugang. Er scheiterte, das Verfahren ist problematisch. Valide Daten und harte Fakten, das sind Werte, die mir beispielsweise per se Wahrheit suggerieren. Auch ich würde gerne nur mit reinen Fakten operieren, aber ich werde gleich schildern, warum das nicht geht.
Daten sind, wie ich meine allesamt – und das schließt meines Erachtens auch die Naturwissenschaften mit ein – abhängig von den Parametern, in denen sie generiert werden sowie ihrer jeweiligen Interpretation. Die Objektivität ist oft eine vermeintliche. Es ist allerdings ein philosophisches Problem zu definieren, ab wann wahre Aussagen produziert werden, darauf möchte ich mich jetzt gar nicht einlassen, weil das auch zu weit führt.
Wissenschaftskommunikation und auch Wissenschaftsjournalismus , so mein Eindruck, betrifft in der Regel naturwissenschaftliche Inhalte. Die Geisteswissenschaften finden im Feuilleton statt. Daher auch der Eindruck meiner KollegInnen (VertreterInnen der dominanten Gruppe, nämlich aus den Naturwissenschaften stammend), nur in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur würde “gerecht”, also objektiv (!) berichtet werden, während man sich nur in der “Wissenschaft” mit dieser fiesen Ökonomie der Aufmerksamkeit herumzuschlagen habe.
Ich sage es an dieser Stelle frei heraus:
Das “Wissenschaft” in der Öffentlichkeit und in der Community so derartig einseitig definiert wird, ist nicht hinnehmbar!
Hier muss man sofort ansetzen und Lobbyarbeit seitens der Dachverbände der Disziplinen starten, um zu kommunizieren, dass es uns gibt, wer wir sind und was wir warum wie machen.
Ich habe drei Tage lang meine eigene Relevanz befragt und kann daher Einiges dazu sagen:
Ich versuche zu verstehen, wie die Kultur in der wir leben, funktioniert. Dafür habe ich mir als konkretes Untersuchungsobjekt eine Person ausgesucht, die einerseits die Kunstgeschichte als Disziplin mitgeprägt hat, andererseits aber auch die öffentliche Meinung über das was Kunst ist und sein kann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beeinflusst hat. “Verlust der Mitte” wird von der Generation der kulturinteressierten 60-Jährigen in Deutschland gekannt. Das Buch transportiert aber nicht nur die persönliche Meinung seines Autors, sondern einen Diskurs, also eine gewisse Menge an Meinungen. Als Diskurs bezeichnen wir – mit Foucault – die Art und Weise wie Wissen produziert und tradiert wird. Diese Struktur ist nicht offensichtlich, sondern sie kann durch Analysen offengelegt werden. Foucault kann deshalb als Poststrukturalist bezeichnet werden, weil er Strukturen dekonstruiert, indem er sie offenlegt, aufzeigt, transparent macht. Ich will zeigen, wann dieser modernekritische Diskurs entstanden ist, wie er sich bei Sedlmayr manifestiert und auf welche Art und Weise er bis heute existiert. Das ist ein unbequemes Thema, weil ich zeigen kann, dass Paradigmen in der Kunstgeschichte und darüber hinaus im Kunstdiskurs herumgeistern, die längst überwunden geglaubte totalitaristische Ressentiments weiter transportieren. Ich hoffe, damit einen Beitrag zur Selbstreflexion der Gesellschaft insgesamt zu leisten. Als Einzelperson muss ich mich auf einen relativ kleinen Bereich konzentrieren – aber das ist in den meisten naturwissenschaftlichen Studien auch so.
In meiner Summerschool, in der ich zunehmend eine Verweigerungshaltung entwickelte, habe ich mir überlegt, diesen Blogartikel zu verfassen. Ich habe einige Ideen, für weitere Blogartikel in petto und ich habe mir vorgenommen, Twitter wieder stärker zu nutzen. Mir ist ein großes Defizit bewusst geworden, denn es besteht in der Wissenschaft und insbesondere in den Geisteswissenschaften eine große Kommunikationsskepsis. Selbstermächtigung – eigenes, unautorisiertes, wildes Publizieren wird nicht oder selten goutiert.
Die Chance für einen Dialog zwischen den Wissenschaftskulturen wurde in Braunschweig versäumt. Ich bin es nicht mehr gewöhnt, frontal unterrichtet zu werden. Dass sich außerhalb der Kaffeepause keiner der überwiegend männlichen Referenten für die zu 90% weiblich Teilnehmerschaft und ihre Motivation, ihnen zuzuhören, interessiert, bin ich im postgradualen Feld in dieser Form nicht mehr gewöhnt. In Arbeitsgruppen eingeteilt wurde ich zuletzt … ja wann eigentlich? Im Kindergarten? Dem einschränkend ist hinzuzufügen, dass ich mit dieser Meinung eine Einzelposition vertrete, die dominante Gruppe, auf die das Ganze zugeschnitten war, übte positives Feedback. Mir persönlich bleiben aber zu wenig greifbare Facts auf viel Unbehagen. Das ist nicht schlimm, es ist oft der erste Schritt in etwas Neues.