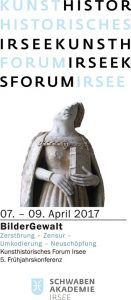Hamburgs Geschichte ist bis heute eng mit dem Hafen und den dort gehandelten Waren verbunden. Neben Tabak und Kakao war Kaffee ein Importschlager des Kaiserreichs. Abgesehen von seiner stimulierenden Wirkung, war es vor allem die exotische Bewerbung, wegen der sich der Kaffee großer Beliebtheit erfreute. – von Benet Dörr
Der Weltmarkt für Kaffee entwickelte sich durch die aufkommende Nachfrage im 18. Jahrhundert. Erstmals entdeckten Fernhändler in Asien den Kaffee und brachten ihn Mitte des 17. Jahrhunderts nach Europa. Schon bald wurde Kaffee eine luxuriöse Alternative zu Wein an den Höfen Europas.
[...]